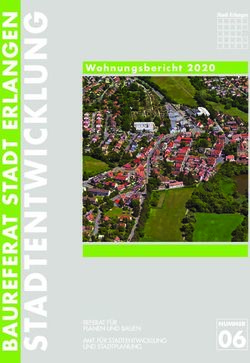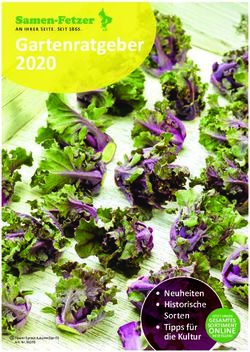Synergien vor Ort in Langenfeld im Rheinland - Bertelsmann ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Inhalt
1 Einführung ....................................................................................................................................... 5
1.1 Soziale, wirtschaftliche und demografische Lage der Stadt .................................................... 6
1.2 Langenfelds lokales Demografiekonzept................................................................................. 6
1.3 Quartiersentwicklung als Baustein einer seniorenfreundlichen Kommune ........................... 8
2 Methodisches Vorgehen ............................................................................................................... 10
3 Akteure, Leistungen und Ressourcen ............................................................................................ 11
3.1 Die Akteure ............................................................................................................................ 11
3.1.1 Das freie Ehrenamt ........................................................................................................ 14
3.1.2 Selbstorganisierte Seniorenarbeit in Langenfeld: ZWAR .............................................. 14
3.1.3 Nachbarschaftsentwicklung im Quartier: „Wir in Mitte“/SONG ................................... 15
3.1.4 Die Quartiersarbeit der evangelischen Kirche ............................................................... 16
3.2 Leistungen und Angebote der Akteure ................................................................................. 18
3.3 Ressourcen ............................................................................................................................ 19
4 Kooperation, Koordination, Vernetzung ....................................................................................... 21
4.1 Die Koordination des Netzwerks ........................................................................................... 21
4.2 Steuerung und Beteiligung .................................................................................................... 21
4.2.1 Beteiligung im Netzwerk ............................................................................................... 22
4.3 Vernetzung der Akteure ........................................................................................................ 23
4.4 Netzwerk ............................................................................................................................... 25
4.4.1 Kooperation mit der Kommune..................................................................................... 28
4.4.2 Beteiligung der Zielgruppe ............................................................................................ 29
5 Ehrenamtliches Engagement und Zivilgesellschaft ....................................................................... 30
5.1 Ehrenamtliches Engagement ................................................................................................. 30
5.1.1 Leistungen für ehrenamtliches Engagement................................................................. 31
5.1.2 Aufgaben der ehrenamtlich Engagierten ...................................................................... 33
5.1.3 Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt................................................................. 34
5.2 Verhältnis von Zivilgesellschaft und Staat ............................................................................. 38
6 Wirkungen und weitere Entwicklungspotenziale.......................................................................... 40
6.1 Wirkungen ............................................................................................................................. 40
6.1.1 Wirkungen für die Zielgruppe........................................................................................ 40
6.1.2 Wirkungen für die Stadt ................................................................................................ 41
6.1.3 Wirkungen für die Träger .............................................................................................. 41
2Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
6.2 Entwicklungspotenziale ......................................................................................................... 42
7 Fazit ............................................................................................................................................... 44
8 Literatur ......................................................................................................................................... 45
Abbildungen
Abbildung 1: Akteurszuordnung ............................................................................................................ 11
Abbildung 2: Einzugsbereich der Akteure ............................................................................................. 13
Abbildung 3: Zielgruppen der Akteure .................................................................................................. 14
Abbildung 4: Leistungen der Akteure .................................................................................................... 18
Abbildung 5: Zusammensetzung der Einnahmen.................................................................................. 19
Abbildung 6: Verteilung der nicht-finanziellen Unterstützung ............................................................. 19
Abbildung 7: Wer gewährt die nicht-finanziellen Unterstützungen? ................................................... 20
Abbildung 8: Kooperationen und ihre Bewertung ................................................................................ 24
Abbildung 9: Wirkungen der Zusammenarbeit ..................................................................................... 24
Abbildung 10: Übersicht über die Kooperationsbeziehungen .............................................................. 26
Abbildung 11: Bewertung der Netzwerkqualität .................................................................................. 27
Abbildung 12: Aspekte, die bei der Zusammenarbeit mit der Kommune als wichtig angesehen werden
............................................................................................................................................................... 28
Abbildung 13: Beteiligung der Seniorinnen und Senioren .................................................................... 29
Abbildung 14: Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit ............................................................... 30
Abbildung 15: Leistungen, die Ehrenamtliche erhalten (Akteursbefragung)........................................ 31
Abbildung 16: Leistungen, die Ehrenamtliche erhalten und sich wünschen (Ehrenamtsbefragung) ... 32
Abbildung 17: Aufgaben, die Haupt- und Ehrenamtliche übernehmen ............................................... 33
Abbildung 18: Aufgaben, die Ehrenamtliche übernehmen ................................................................... 34
Abbildung 19: Bewertung der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen aus Sicht der
Hauptamtlichen ..................................................................................................................................... 35
Abbildung 20: Bewertung der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen aus Sicht der
Ehrenamtlichen ..................................................................................................................................... 35
Abbildung 21: Bewertung von Aspekten einer guten Zusammenarbeit ............................................... 36
Abbildung 22: Regelung der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ........................ 37
Abbildung 23: Wirkungen ehrenamtlicher Arbeit ................................................................................. 37
Abbildung 24: Bewertung des Verhältnisses von Zivilgesellschaft und Staat (Akteursbefragung) ....... 38
Abbildung 25: Bewertung des Verhältnisses von Zivilgesellschaft und Staat (Ehrenamtsumfrage)..... 39
3Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Tabellen
Tabelle 1: Rahmendaten zur Modellkommune Langenfeld .................................................................... 6
Tabelle 2: Übersicht über das methodische Vorgehen ......................................................................... 10
Tabelle 3: Angebote der evangelischen Kirche ..................................................................................... 16
Tabelle 4: Die wichtigsten Kooperationspartner................................................................................... 23
Fotos: Rahel Gersch, nexus Institut
Dieser Bericht ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht vollständig korrekt gegendert. Wenn wir
von Senioren, Rentnern, Teilnehmern etc. schreiben, sind selbstverständlich auch Seniorinnen, Rent-
nerinnen und Teilnehmerinnen gemeint.
4Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
1 Einführung
Das Projekt „Synergien vor Ort“ der Bertelsmann Stiftung verfolgt das Ziel, die Entwicklungschancen
von Kindern und Jugendlichen, die Selbständigkeit und Teilhabe im Alter sowie die Integration von
Flüchtlingen zu verbessern. Dazu arbeitet das Projekt seit 2015 mit Kommunen und gemeinnützigen
Organisationen zusammen, die neue Formen der Zusammenarbeit gewagt haben und die Herausfor-
derungen in der Praxis kennen.
Das nexus Institut hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung in vier Modellkommunen (Dessau-Roßlau,
Hannover, Langenfeld im Rheinland und Pirmasens) und einer Region (Vorpommern-Greifswald) ins-
gesamt sechs Netzwerke der Kinder- und Jugendarbeit, der Altenhilfe und der Flüchtlingshilfe analy-
siert. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Strukturen der Zusammenarbeit aller beteiligten
Akteure sowie ihre verfügbaren und eingebrachten Ressourcen ermittelt. Von Interesse waren eben-
falls die gesetzten Ziele, die gemachten Erfahrungen sowie die im Rahmen der Koproduktion erzielten
Wirkungen, Herausforderungen und Entwicklungspotenziale. Die Ziele der Untersuchung waren fest-
zustellen, wie die Organisation und deren Umsetzung der Leistungen im Feld gestaltet sind, welche
Wirkung demgemäß erreicht wird und wo Maßnahmen zur Optimierung ansetzen könnten. In den Mo-
dellkommunen wurde mit unterschiedlichen Befragungs- und Veranstaltungsformaten die Vernetzung
der verschiedenen Akteure und deren Angebote erfasst.
Die Analyse wurde in einem Methodenmix aus fünf Bausteinen durchgeführt:
1. Qualitative Interviews, mit Koordinator_innen, Vertreter_innen der Kommunen, herausgeho-
benen Akteuren und Ehrenamtlichen. Der qualitative Zugang richtete sich auf die spezifische
Konfiguration des Netzwerks, besondere Stärken, Konfliktpotenzial, Steuerung und Beteili-
gung.
2. Online-Akteursbefragung mit der die erbrachten Leistungen, die Art und Qualität von Koope-
rationsbeziehungen sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen erfasst wurden.
3. Halbstandardisierte Befragung von Ehrenamtlichen, die die Zusammenarbeit von Zivilgesell-
schaft und Staat beleuchtete.
4. Fokusgruppen mit Jugendlichen zu den Wirkungen der vernetzten Arbeit.
5. Partizipativer Workshop: Abschließend wurde in jeder Kommune ein partizipativer Workshop
durchgeführt, der mit breiter Beteiligung aller Gruppen die Möglichkeiten der Weiterentwick-
lung der Netzwerke zum Inhalt hatte.
Die Erhebungen in den Modellkommunen fanden im Zeitraum Januar bis September 2016 statt.
Der folgende Bericht stellt die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der wissenschaftlichen Analysen des
nexus Instituts als kommunaler Schlussbericht für die Stadt Langenfeld dar.
Kontakt:
nexus - Institut für Kooperationsmanagement u. interdisziplinäre Forschung GmbH, Berlin
Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin | www.nexusinstitut.de
Dr. Christine von Blanckenburg | blanckenburg@nexusinstitut.de
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256, 33311 Gütersloh | www.synergien-vor-ort.de
Dr. Andrea Walter | andrea.walter@bertelsmann-stiftung.de
5Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
1.1 Soziale, wirtschaftliche und demografische Lage der Stadt
Der demografische Wandel verläuft in der Tabelle 1: Rahmendaten zur Modellkommune Langenfeld
Stadt Langenfeld im Landkreis Mettmann Quellen: 1Wegweiser Kommune, 2Agentur für Arbeit Mettmann
(NRW) vergleichsweise wenig ausgeprägt. Zu-
Bevölkerung
letzt ist die Bevölkerung Langenfelds sogar
Einwohner (2014)1 57.083
leicht gestiegen von 56.989 im Jahr 2011 auf
1
57.083 in 2014. Es wird dennoch prognosti- Einwohner (Prognose 2030) 55.720
ziert, dass die Einwohnerzahl in Langenfeld bis Lage der Senior/-innen in Langenfeld
zum Jahr 2030 auf 55.702 zurückgehen wird. Anteil der Über-65-Jährigen
21,3 %
Dies entspräche einem Rückgang von 2,2 %. (2012)1
Damit geht die Wohnbevölkerung in der Stadt Anteil der Über-65-Jährigen (Prog-
28,1 %
Langenfeld weniger stark zurück als im Land- nose 2030)1
kreis Mettmann (–5 %) und im Land NRW ins- Altersarmut (2014)1 2,6 %
gesamt (–2,7 %). Gleichzeitig steigt der Bevöl- Wirtschaftliche Situation der Stadt
kerungsanteil der Über-65-Jährigen von Einnahmen der Kommune (2013)1 2.721 €/Ew.
21,3 % um 6,8 Prozentpunkte auf 28,1 %. Ähn- Arbeitslosigkeit (Mai 2016)2 5,3 %
liche Anstiege verzeichnen auch der Landkreis
Mettmann von 23,2 % auf 29,3 % und das Land NRW von 20,3 % auf 26,5 %. Das Medianalter wird im
gleichen Zeitraum von 46,9 Jahre auf 49,5 Jahre steigen. Damit wäre die Stadt Langenfeld etwas jünger
als der Landkreis (50,1 Jahre), jedoch älter als im Landesdurchschnitt (47,4 Jahre).
Wirtschaftlich geht es der Stadt Langenfeld gut. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,3 % niedriger als der
Bundesschnitt (6,0 %) und es beziehen weniger Rentner Leistungen der Grundsicherung im Alter (Lan-
genfeld: 2,6 %; Deutschland: 3,3 %). Auch die öffentlichen Finanzen sind in guter Verfassung. Langen-
feld ist seit Oktober 2008 schuldenfrei.
Diese gute wirtschaftliche und soziale Lage der Stadt und ihrer Bewohner wurde von allen Gesprächs-
partnern als Rahmen des eigenen Handelns hervorgehoben.
1.2 Langenfelds lokales Demografiekonzept
Die soliden Finanzen der Stadt haben sicher dazu beigetragen, dass sich die Stadt schon früh mit dem
demografischen Wandel und den Möglichkeiten der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen befasst
hat. Die Stadt hat ihr Vorgehen auf diversen Veranstaltungen in Land und Bund vorgestellt und gilt als
„Best Practice“, als Beispiel für andere. Treibende Kraft war dabei die erste Beigeordnete Marion Prell.
Schon im Jahr 2002 begann die aktive Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel, indem
zunächst die Daten gesammelt und im 1. Demografiebericht 2003–2030 aufbereitet wurden. Die dar-
aus abgeleiteten Maßnahmenempfehlungen wurden bis zum Jahr 2006 umgesetzt: Der Mangel an
Pflegeplätzen wurde durch den Neu- und Ausbau von Pflegeeinrichtungen behoben. Im Rathaus wurde
mit der Einrichtung des Seniorenbüros eine niedrigschwellige, zentrale Anlaufstelle zu allen Fragen
rund ums Alter geschaffen. Zusätzlich wurde ein Seniorenratgeber erarbeitet, in dem alle Angebote
von freien Trägern, städtischen Einrichtungen oder kommerziellen Anbietern nach Themen gegliedert
aufgeführt wurden. Eine Übersicht über die Angebote und Leistungen konnten sich die Langefelder
auch auf der Seniorenmesse verschaffen, die von 2004–2008 durchgeführt wurde. Mittlerweile ist sie
mit der Bildungs- und Erziehungsmesse sowie der Handwerkermesse fusioniert und wird alle zwei
6Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Jahre mit großem generationenübergreifendem Zuspruch als Langenfelder Familienmesse durchge-
führt.
Eng verknüpft mit dem Seniorenbüro ist auch die ehrenamtlich geführte Freiwilligenagentur in Träger-
schaft der Stadt, die sich mit ihrem Angebot vor allem an die Menschen richtet, die nach dem Aus-
scheiden aus dem Beruf nach einer sinnvollen, bereichernden Tätigkeit suchen. Im Seniorenbüro wird
auch das Netzwerk Demenz koordiniert, das die verschiedenen Akteure im Themenfeld zusammen-
bringt und wichtige Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema leistet.
Die intergenerationelle Weichenstellung kennzeichnet die zweite Phase der Demografiepolitik von
2007–2010. Die junge Generation und Familienfreundlichkeit rückten stärker in den Mittelpunkt des
Interesses und ergänzten die Seniorenarbeit. Im Netzwerk „JUNGE ... ALTErnative“, dem 94 Vereine,
Verbände und Organisationen angehörten, wurden gemeinsam intergenerationelle Projekte entwi-
ckelt.
Seit 2010 ist mit der Quartiersentwicklung ein neuer Baustein hinzugekommen, der den Schwerpunkt
der folgenden Analyse der Seniorenarbeit der Stadt Langenfeld im Rahmen des Projektes Synergien
vor Ort bildet.
Beispielhaft ist die Langenfelder Demografiearbeit nicht nur, weil die Verwaltung frühzeitig Daten ge-
sammelt und Maßnahmen daraus abgeleitet hat, sondern auch weil die Beteiligung der Bürger an allen
Vorhaben ein integrativer Bestandteil des Vorgehens ist. Es werden Befragungen durchgeführt, z. B.
die Seniorenbefragung 2003 oder die Ehrenamtsbefragung 2012, um belastbare Daten im Handlungs-
feld zu erhalten und Maßnahmen zu entwickeln, die dem Bedarf entsprechen. In diskursiven Formaten
wie dem Demografie-Kongress im Jahr 2011 oder dem World-Café des Demenznetzwerks können sich
Bürger direkt in Meinungsbildungsprozesse einbringen. An den Runden Tischen, die in den von der
Stadt koordinierten Netzwerken zum Zweck des Austausches und der Abstimmung eingerichtet wur-
den, können nicht nur Vertreter von Trägern, Einrichtungen oder Vereinen teilnehmen, sondern auch
Bürger, die diesen Status nicht haben, aber z. B. in der Quartiersarbeit aktiv sind. Das Interesse der
Stadt an Engagement und Eigeninitiative von Bürgern kommt auch in der Bereitstellung einer Engage-
ment fördernden Infrastruktur zum Tragen. Auf Initiative der Stadt wurde eine ehrenamtlich geführte
Freiwilligenagentur gegründet. Die Stadt stellt der Freiwilligenagentur einen Raum im Rathaus zur Ver-
fügung. Darüber haben die Ehrenamtlichen einen festen hauptamtlichen Ansprechpartner. Auch der
im Jahr 2008 aus einer Sonderrückstellung in Höhe von 5 Mio. € anlässlich der Schuldenfreiheit einge-
richtete Gesellschaftsfonds gehört zur Engagement fördernden Infrastruktur. Beim Fondsmanager
können Vereine oder andere Organisationen die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen beantra-
gen, die über die eigentliche Vereinsausstattung hinausgehen und in besonderer Weise das ehren-
amtliche Engagement fördern. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Langenfeld beschließt die
jährlichen Ausschüttungen. Dazu erarbeitet die Verwaltung einen Vorschlag auf Grundlage der An-
träge. Darüber hinaus werden auch Qualifizierungen im Ehrenamt über den Gesellschaftsfonds geför-
dert.
Für ihre innovative und nachhaltige Entwicklungsstrategie, die durch einen ressortübergreifenden, in-
tegrativen und partizipativen Ansatz gekennzeichnet ist, wurde die Stadt Langenfeld im Jahr 2015 vom
Land NRW als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet.
7Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
1.3 Quartiersentwicklung als Baustein einer seniorenfreundlichen
Kommune
Im Jahr 2010 begann die Stadt Langenfeld, einen weiteren Baustein der Demografiearbeit zu entwi-
ckeln: die Quartiersentwicklung. Auch hier wurde zunächst die Datengrundlage auf Quartiersebene
ausgewertet. Darauf aufbauend wurden verwaltungsinterne Leitlinien für ein funktionierendes Quar-
tier erarbeitet.
In der Quartiersarbeit fließen Ansätze der vorangegangenen Phasen der Demografiearbeit zusammen,
die die Lage der Senioren und das Miteinander der Generationen und Familienfreundlichkeit fokussiert
hatten. Das ist deutlich an der Zielbestimmung der Quartiersarbeit zu erkennen:
Senioren: „Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Menschen ein möglichst langes Verblei-
ben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen; das Heimerfordernis ist letzte Möglichkeit.
Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ wird mit Leben gefüllt.“1
Miteinander der Generationen: „Angebote für alle Generationen im jeweiligen Stadtteil zu
schaffen und bekannt zu machen, um dadurch generationenübergreifende Lebenswelten für
alle Bewohner des Quartiers zu ermöglichen.“1
Funktionierende Nachbarschaften werden als Weg angesehen, um diese Ziele zu erreichen, denn im
konkreten Lebensumfeld, dem Quartier, kommt zu den bereits vorhandenen und ausgebauten Ange-
boten etwas hinzu: die sozialen Beziehungen, auf denen Sorge und informelles Engagement beruhen.
Sie garantieren Teilhabe und Unterstützung im Alltag, die jenseits der Angebote von freien Trägern der
Wohlfahrtshilfe liegen. Für die selbstständige Lebensführung hochbetagter und/oder gesundheitlich
eingeschränkter Menschen sind sie außerordentlich wichtig und wirken auch präventiv. Diese Funktion
wird in der dritten Zielstellung der Quartiersarbeit formuliert:
„Langenfeld lebens- und liebenswert zu erhalten, indem Nachbarschaften gepflegt werden
und ein Klima geschaffen wird, in dem die Menschen aufeinander Acht geben.“1
Langenfeld orientierte sich zu Beginn des Prozesses bei der Realisierung der Quartiersarbeit an zwei
Modellprogrammen. Zum einen an SONG – Soziales neu gestalten – und zum anderen an ZWAR – zwi-
schen Arbeit und Ruhestand. SONG, das von verschiedenen Stiftungen und Trägern entwickelt wurde,
gestaltet die Entwicklung der Nachbarschaft von Wohneinrichtungen aus. Partner der Stadt für die
Umsetzung in Langenfeld war das CBT-Wohnhaus St. Franziskus in Mitte, das schon vor der Koopera-
tion mit der Stadt durch die Teilnahme von Mitarbeiterinnen an Fortbildungen zur Nachbarschaftsar-
beit in die Quartiersentwicklung eingestiegen war und das SONG-Konzept auf Langenfelder Verhält-
nisse abgestimmt und modifiziert hat. Das Projekt trägt heute die Bezeichnung „Wir in Mitte“. ZWAR
verfolgt einen anderen, stärker auf Selbstorganisation von Senioren beruhenden Ansatz. Es will den
Aufbau sozialer Beziehungen fördern, weil diese eine Schutzwirkung entfalten und so ein möglichst
langer Verbleib in den Phasen des Alterns möglich ist, indem keine oder nur partielle Hilfe benötigt
wird. ZWAR richtet sich an Menschen um die Grenze zum Ruhestand, die selbstorganisiert gemein-
schaftlich aktiv sind.
1
Quelle: Homepage der Stadt Langenfeld
8Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Die ZWAR-Gruppen werden von der ZWAR Zentralstelle Dortmund unterstützt. Beide Quartiersansätze
werden von dem CEfAS Institut der Universität Köln wissenschaftlich begleitet.
Für ZWAR Immigrath ist die Arbeiterwohlfahrt Partner der Stadt, für „Wir in Mitte“/ SONG die Caritas
Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH. An diese Partner vergab die Stadt Mittel für die haupt-
amtliche Moderation über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Die beiden ersten Quartierspro-
jekte wurden 2012/2013 ins Leben gerufen. 2015 sind noch zwei weitere ZWAR-Gruppen in Reusrath
und in Richrath gegründet worden. Träger sind die Diakonie des Kirchenkreises Leverkusen bzw. der
Seniorentreff St. Martin der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e. V. Die Gründung
einer ZWAR-Gruppe in Mitte ist für 2017 geplant. Die Unterstützung der neueren Gruppen durch ZWAR
ist im Vergleich zu den Pilotprojekten ist die zurückgefahren worden. So sind die Initiierungsprozesse
der ZWAR-Projekte heute nicht mehr auf zwei, sondern nur auf ein Jahr angelegt. Entsprechend un-
terstützt die Stadt Langenfeld neue Prozesse mit finanziellen Zuschüssen für die Dauer eines Jahr.
Die Projekte ZWAR und „Wir in Mitte“ sind wesentliche Bausteine der Quartiersentwicklung. Sie ste-
hen aber nicht für sich, sondern sind in die nachhaltige Quartiersentwicklung der Stadt eingebunden.
So werden alle Träger von der Stadt über die monatlichen Arbeitstreffen, die die Quartierskoordinato-
rin mit den Ansprechpartnern der Quartiersprojekte abhält, und den vierteljährlich tagenden Runden
Tisch in den Informationsfluss eingebunden. In welcher Phase sich die Quartiersprojekte befinden,
d. h., ob sie sich noch in der ersten Phase der externen Moderation befinden oder schon länger beste-
hen, spielt für die Einbindung in die Strukturen der Quartiersentwicklung keine Rolle. Die Träger führen
die Quartiersentwicklung fort, indem sie z. B. Räume bereitstellen und einen festen, in der Regel haupt-
amtlichen Ansprechpartner benennen, der an den Treffen teilnimmt und sich aktiv in die Prozesse ein-
bringt. Für diese Leistungen erhalten sie eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt. „Die Koope-
ration mit allen Trägern ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen auf Augenhöhe, bei dem die jeweili-
gen Besonderheiten der Struktur des Trägers berücksichtigt werden“, fasst die Quartierskoordinatorin
das Zusammenwirken der Stadt mit den verschiedenen Trägern zusammen.
9Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
2 Methodisches Vorgehen
In Langenfeld wurden nach eingehender Dokumentenanalyse eine Reihe von qualitativen Expertenin-
terviews, eine Online-Umfrage unter Akteuren der Quartiersentwicklung bzw. Seniorenarbeit sowie
eine Fragebogenerhebung unter ehrenamtlich Engagierten durchgeführt. Zudem fand eine Fokus-
gruppe mit „Betroffenen“, in diesem Fall mit Seniorinnen und Senioren, statt. Zum Abschluss stand ein
partizipativer Workshop. In der folgenden Übersicht (siehe Tab. 2) werden die einzelnen Erhebungsin-
strumente näher erläutert.
Tabelle 2: Übersicht über das methodische Vorgehen
Erhebungsinstru- Vorgehen
mente
- grundlegende Analyse von Dokumenten (z. B. Konzepte, statistische
Dokumentenanalyse Daten) bezüglich vorhandener Strukturen, Akteuren und ihrer Leistun-
gen vor Ort
- Grundlage der Befragung war eine von der Stadt zur Verfügung ge-
stellte Anbieterliste
Online-Akteursbefra- - Teilnahme: 11 Anbieter + 8 mit verkürztem Fragebogen
gung - Fragen zu Leistungen und Ressourcen, Kooperations- und Netzwerktä-
tigkeiten sowie Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt (Fragen
mit Auftraggeber und Ansprechpartnern vor Ort abgestimmt)
- Datenauswertung über Excel
- 12 leitfadengestützte Experteninterviews mit Akteuren der Quartiers-
entwicklungsprojekte „Wir in Mitte“/SONG und ZWAR sowie der Ver-
waltung
Experteninterviews - über Interviews Einblicke in eigene Arbeit, Bedeutung von Kooperatio-
nen, Koordination, Netzwerke und Ehrenamt sowie daraus entste-
hende Wirkungen
- qualitative Auswertung über atlas.ti
- 9 Teilnehmende = Senioren, größtenteils im Alter zwischen 60 und 70
Jahren, die an den Quartiersentwicklungsprojekten ZWAR bzw. „Wir in
Fokusgruppe Mitte“/SONG teilnehmen
- Austausch zum Thema „Selbstständiges Leben im Alter“ mittels Erar-
beitung einer Mindmap und Diskussion mit Kartenabfrage zu Wirkun-
gen der Quartiersentwicklungsprojekte
- Fragebögen wurden von der Stadt verteilt bzw. versendet
- Teilnahme: 28 Ehrenamtliche
Ehrenamtsbefragung - Fragen zu den Bedingungen des Ehrenamts, der Qualität der Zusam-
menarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt und der zivilgesellschaftli-
chen Bedeutung des Ehrenamts
- Workshop mit Akteuren von ZWAR und „Wir in Mitte“/SONG, der Ver-
Partizipativer waltung, Politik und ehrenamtlich Engagierten
- Teilnehmeranzahl: 25 Personen
Workshop - Präsentation der vorläufigen Forschungsergebnisse und Kartenabfrage
mit anschließender Bepunktung zu Themen, bei denen das Plenum
Verbesserungsbedarf sah
10Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
- intensive Diskussion mittels World-Café über Problemstellungen und
Lösungsansätze zu folgenden drei Themen: Wohnen, Infrastruktur, Fi-
nanzierung
3 Akteure, Leistungen und Ressourcen
3.1 Die Akteure
Die Diagramme, die die Akteurslandschaft der Seniorenarbeit in Langenfeld anschaulich machen, be-
ruhen auf den Angaben, die in der Onlineumfrage gemacht wurden. Teilweise wurden in die Daten-
grundlage auch direkt Aussagen aus den Interviews übernommen, da sonst ein verfälschtes Bild ent-
standen wäre.
Kirche/religiöse Einrichtung 5
Initiative 4
Träger der freien Wohlfahrtspflege 4
Sonstige 3
Verein 3
Kommune 2
Unternehmen 0
Stiftung 0
Verband 0
Abbildung 1: Akteurszuordnung
Quelle: eigene Erhebung (n=21, Mehrfachantworten)
In Abbildung 1 wird deutlich, dass zahlenmäßig am stärksten Kirchen oder religiöse Einrichtungen ver-
treten sind. In Langenfeld sind das die evangelischen Kirchengemeinden in den Stadtteilen Immigrath
und Mitte, Reusrath und Richrath sowie zwei Initiativen, die als eigene Akteure unter dem Dach der
evangelischen Kirche wahrgenommen werden: das Reparaturcafé und das Jugendhaus „Alte Schule“.
Die katholische Kirche betreibt eine bislang nicht an den ZWAR-Prozessen ausgerichtete Seniorenar-
beit. Da sie zum Zeitpunkt dieser Untersuchung noch nicht als vertraglicher Kooperationspartner der
Stadt in der Quartiersarbeit auftritt, ist sie in dieser Darstellung nicht berücksichtigt worden. Ab Anfang
des Jahres 2017 wird die katholische Kirche allerdings Kooperationspartnerin der Stadt Langenfeld im
Rahmen der Initiierung eines ZWAR-Prozesses im Stadtteil Langenfeld-Mitte. Die katholische Senio-
renarbeit wird unter dem Stichwort „Schützen“ erfasst. Sie werden auf der Webseite der katholischen
Kirchengemeinde in Langenfeld als „katholische Gruppierung“ eingeordnet. An der Befragung haben
die Richrather Schützen, die allerdings keine religiöse Einrichtung, sondern ein Verein der Brauchtums-
pflege sind, teilgenommen. Sie betreiben den Seniorentreff St. Martin in Richrath, was wiederum der
Name der Richrather katholischen Kirche ist.
11Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Die freien evangelischen Kirchengemeinden, auf deren Angebote im „Wegweiser für Seniorinnen und
Senioren“ der Stadt Langenfeld hingewiesen wird, haben an der Befragung nicht teilgenommen, weil
sie nicht im Verteiler der Quartierskoordinatorin aufgeführt sind.
Unter die Zuordnung „Initiative“ fallen die drei ZWAR-Gruppen und die “Wir in Mitte“-Gruppe. Sie
haben keine feste organisatorische Rahmung, wollen auch kein Verein sein. Träger und Vertrags-
partner der Stadt für diese Initiativen sind die AWO, die CBT-Caritas-Betriebsführungs- und Trägerge-
sellschaft mbH, die Diakonie Leverkusen und die Richrather Schützen.
12Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Die starke Vertretung der Träger der freien Wohlfahrtspflege in der Umfrage rührt auch daher, dass
AWO, CBT und Diakonie Träger der Quartiersprojekte ZWAR und „Wir in Mitte“ sind. Zu den freien
Trägern, die in Langenfeld arbeiten, gehören unter anderem auch der Sozialdienst katholischer
Frauen (SKF), die Caritas, die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz. Die drei Letztgenannten sind in
der Umfrage nicht berücksichtigt worden, da sie nicht zur Quartiersentwicklung gerechnet werden.
In Vereinen sind sicher viele Langenfelder im Seniorenalter aktiv. In dem Diagramm werden nur die
drei Vereine angezeigt, die in die Quartiersentwicklung eingebunden sind. Das sind die Richrather
Schützen und zwei Vereine, die bürgerschaftliches Engagement für das Gemeinwesen zum Zweck ha-
ben: der Bürgerverein Langfort und die Langenfelder Initiative für Bürger – mit Bürgern e. V.
Die Kommune ist mit zwei Organisationen vertreten, die nicht zur Verwaltung gehören, aber von der
Stadt initiiert und unterstützt wurden, nämlich der ehrenamtlich betriebenen Freiwilligenagentur und
dem Integrationsrat.
11
8
0
Stadtteil/Stadtbezirk Stadt Landkreis
Abbildung 2: Einzugsbereich der Akteure
Quelle: eigene Erhebung (n=19, Mehrfachantworten)
Die Akteure, die ihren Wirkungsschwerpunkt oder Einzugsbereich auf einen Stadtbezirk bezogen sehen
(siehe Abb. 2), sind zum einen die als Quartiersprojekte initiierten ZWAR- und „Wir in Mitte“/SONG-
Gruppen sowie die Kirchengemeinden, deren kirchlicher Auftrag auf den Pfarrbezirk bezogen ist. Auch
die AWO ist ein wichtiger Akteur, sowohl über verschiedene Einrichtungen als auch über den i-Punkt
für Senioren.
13Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Keine bestimmte Zielgruppe 7
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen 5
Flüchtlinge 5
Seniorinnen und Senioren 5
Menschen mit Behinderung 4
Sozial schwächer gestellte Menschen 4
Menschen mit Migrationshintergrund 2
Familien 1
Sonstige 10
Abbildung 3: Zielgruppen der Akteure
Quelle: eigene Erhebung (n=33, Mehrfachantworten)
Seniorinnen und Senioren werden auf den ersten Blick überraschend selten als Zielgruppe der Akteure
der Seniorenarbeit in den Quartieren der Stadt Langenfeld genannt (siehe Abb. 3). Das liegt zum einen
daran, dass z. B. Kirchen, aber auch die Wohlfahrtsverbände zwar viele Angebote für Senioren haben,
sich jedoch nicht auf diese Zielgruppe fokussieren. Zum anderen treten Seniorinnen und Senioren sel-
ber als Akteure in Erscheinung und engagieren sich für Flüchtlinge oder intergenerationell für Familien
und Kinder. Unter sonstigen Zielgruppen wurden genannt: Frauen und Menschen, die einen Verlust
erfahren haben.
3.1.1 Das freie Ehrenamt
Besonders interessant sind die „sonstigen“ Akteure. Hierbei handelt es sich um Seniorinnen und Seni-
oren, die eigeninitiativ Projekte machen, teilweise in Kooperation mit Trägern, teilweise auch ohne.
Hintergrund für einen Teil dieser „frei ehrenamtlichen“ Arbeit ist das Qualifizierungsprogramm „Erfah-
rungswissen für Initiativen“, das zwei der Akteure durchlaufen haben.
Die Flüchtlingshilfe in Langenfeld ist wie in vielen anderen Orten in Deutschland eine Aufgabe, die
selbstorganisiertes Ehrenamt anzieht oder auch engagierte Menschen zu einem bis dahin nicht ausge-
übten Maß an Selbstorganisation herausfordert. Das freie Ehrenamt beschränkt sich aber nicht auf
diese Aufgabe. Verschiedene Akteure machen schon länger Projekte für ältere Menschen oder inter-
generationelle Projekte für Alte und Junge gemeinsam.
3.1.2 Selbstorganisierte Seniorenarbeit in Langenfeld: ZWAR
Die von der Stadt Langenfeld initiierten und mit einer Anschubfinanzierung geförderten Quartierspro-
jekte für Senioren nach den Modellen ZWAR und „Wir in Mitte“/SONG entziehen sich der Angebotslo-
gik. Das Angebot, das sie machen, heißt Selbstorganisation. Selbstorganisiert entsteht dann eine Fülle
von gemeinschaftlichen Aktivitäten. Sie verstehen sich auch nicht als Akteure der Seniorenarbeit, zu-
mindest hat kein Ansprechpartner der Gruppen den Fragebogen für ZWAR oder SONG ausgefüllt. Die
wichtige Funktion, die diese Gruppen trotz des breiten Angebotes in der Stadt haben, liegt darin, die
soziale Vernetzung gerade derjenigen zu fördern, die über die reiche Vereinslandschaft, die Familie
14Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
oder die speziellen Seniorenangebote weniger gut eingebunden sind. Dazu zählen Menschen, die zu-
gezogen sind und auch Menschen, die z. B. aufgrund ihrer anspruchsvollen Jobs, wenig soziale Bezie-
hungen am Wohnort Langenfeld gepflegt haben. Nach dem Ausstieg aus dem Beruf können sie nicht
an Bestehendes anknüpfen, sondern müssen neue Kontakte aufbauen. Keine leichte Aufgabe im Alter.
Nach den Ergebnissen der ersten Befragungswelle der Universität Köln zur Umsetzung von ZWAR und
„Wir in Mitte“/SONG in Langenfeld erfüllen die ZWAR-Gruppen tatsächlich diesen Anspruch. Die Mit-
glieder der ZWAR-Gruppen hatten im Vergleich zu den Vergleichsgruppen häufiger keine Kinder und
keinen Kontakt zu den Nachbarn (vgl. CEfAS 2013, S. 31). Dieser Befund wird auch durch zwei Inter-
viewpartner bestätigt, die im Ruhestand über die ZWAR-Gruppe bzw. über eigenes Engagement neue
Kontakte aufgebaut haben. Interessante Leute kennenzulernen und ein soziales Netz zu weben, wird
explizit als Antriebsfeder für das eigene Engagement genannt.
Dass sie das soziale Netz in Zeiten der Unterstützungsbedürftigkeit auffangen soll, hat keiner der In-
terviewpartner so benannt. Das Ziel der Stadt, eine sorgende Gemeinschaft per ZWAR oder „Wir in
Mitte“/SONG zu etablieren, ist in den Überlegungen zu ZWAR aber präsent, denn gegenseitige Unter-
stützung, vor allem durch Nachfragen, wenn jemand nicht kommt, wird als Wirkung erlebt und daran
auch eine Hoffnung für die Zukunft, in der man voraussichtlich stärker auf Hilfe angewiesen sein wird,
geknüpft.
ZWAR hat auch eine Verbindung zum selbstorganisierten freien Ehrenamt, denn die Gruppen funktio-
nieren auch als Kontaktbörsen für ehrenamtliche Aktivitäten. Das hat sich vor allem in der Flüchtlings-
arbeit bewährt. Freies Ehrenamt ist aber nicht auf ZWAR angewiesen. Projekte werden auch ganz un-
abhängig davon entwickelt und dabei ebenfalls viele interessante Kontakte geknüpft.
3.1.3 Nachbarschaftsentwicklung im Quartier: „Wir in Mitte“/SONG
Auch die an SONG angelehnte Gruppe „Wir in Mitte“, die zunächst von den CBT-Mitarbeiterinnen, Frau
Kniep und später von Frau König, moderiert wird, erreicht Menschen, die häufig allein leben, sozial
schlechter eingebunden sind als Vergleichsgruppen und stärker unter Einsamkeit leiden. Die soziale
Zusammensetzung der Gruppe unterscheidet sich deutlich von den ZWAR-Gruppen: Die Mitglieder
sind ausschließlich weiblich und erheblich älter. 2013 lag das Durchschnittsalter bei 78 Jahren, wäh-
rend die Aktiven bei ZWAR im Schnitt fast 20 Jahre jünger sind. Auch das Bildungsniveau war niedriger.
Aus diesen Bedingungen erklärten verschiedene Interviewpartner, dass sich die Wir-in-Mitte-Gruppe
weniger dynamisch entwickle und auch die Eigeninitiative weniger ausgeprägt sei, als bei ZWAR. Ei-
geninitiativ werden die Wir-in-Mitte-Damen nach dem Vorbild von ZWAR, wenn sie gemeinsam ihre
Freizeit verbringen, z. B. zusammen Ausflüge unternehmen oder Veranstaltungen besuchen. Die Initi-
ative der Frauen richtet sich aber nicht vornehmlich auf die Freizeitgestaltung, sondern auf das Zusam-
menleben im Quartier. Als wichtige Initiative ist der Brief an den Bürgermeister zur Ansiedlung eines
Supermarktes in Mitte im kollektiven Gedächtnis verankert. Auch das Bepflanzen von Baumscheiben
bzw. die Ausstattung mit Gerät zum Jäten und Gießen oder das Aufstellen einer Bank zum „Rumtöt-
tern“ gehen auf das Engagement der Frauen zurück. In diesen Aktionen, so unspektakulär wie sie sind,
offenbaren sich die konzeptionellen Unterschiede zu ZWAR. „Wir in Mitte“/SONG versucht Begeg-
nungsräume zu schaffen und damit Beziehungen möglich und Bedarfe gegenseitig sichtbar zu machen,
sodass Unterstützungsstrukturen entstehen, die oft auch intergenerationell sind. Intergenerationelle
Projekte wie ein Computerkurs oder der Handy-Führerschein wurden von den „Wir in Mitte“/SONG-
Mitgliedern gewünscht und von Frau Kniep organisiert, führten, zum Bedauern der Älteren, aber nicht
15Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
zu dauerhaften Kontakten zwischen den Generationen. Die Mitglieder der „Wir in Mitte“/SONG-Basis-
gruppe sind in einem Alter, in dem ihnen schon manches schwerfällt und sie die Erfahrung machen,
dass kleine Hilfe- und Unterstützungsleistungen das selbstständige Leben erleichtern würden. Das
kommt auch in dem mehrfach vorgetragenen Wunsch nach jüngeren Mitgliedern – genannt wird ein
Alter von 50–70 Jahren – und nach Männern, die kleine Reparaturen vornehmen könnten, zum Aus-
druck.
3.1.4 Die Quartiersarbeit der evangelischen Kirche
Ein wichtiger Akteur der Seniorenarbeit im Quartier ist auch die evangelische Kirche, die regelmäßig
eine Vielzahl von Veranstaltungen anbietet.
Tabelle 3: Angebote der evangelischen Kirche
Angebot teilnehmende Senioren
Gregorianik für Männer 150 wöchentlich
Regenbogen-Engel 10 monatlich
Begegnungscafé Gemeindezentrum 20 monatlich
Frauengruppe „Senfkorn“ 30 monatlich
Oasenzeit 8 monatlich
Geselliger Nachmittag Reusrath 18 wöchentlich
Frauenhilfe Martin-Luther-Kirche 5 wöchentlich
Senioren-Fahrdienst 6 wöchentlich
Reparaturcafé 14 tägig
Mittagstisch für Alleinstehende 25 monatlich
Bastelkreise
Besuchsdienst
Hörmuschel wöchentlich
Frauenhilfe an der Erlöserkirche
Kurs „Gesellschaftliches Engagement im Umbruch“
Seniorengymnastik 25 wöchentlich
Seniorenkreis Richrath
Seniorentanz Gemeindezentrum Johanneskirche
Volksliedersingen
Männerfrühstück 16
Spieletreff, Mitte, 1 Aktive, 8 Teilnehmende 8
Schreibstube, Mitte, 1 Aktive, 6 Teilnehmende 6
Gesprächskreis, Mitte 20
Volksliedersingen 40 monatlich
Seniorenadventsfeiern 700 jährlich
Seniorenfrühlingsfeiern 60 jährlich
Gottesdienste in vier Altenheimen 40 monatlich
Fortbildungen „Demenzielle Gemeinde“
Auch in der Fokusgruppe mit Mitgliedern von ZWAR-Gruppen und Senioren, die sich dem i-Punkt für
Senioren der AWO nahe fühlen, wurde betont, wie wichtig die Funktion der Kirche für ältere Menschen
ist. Kirche ist nach Auffassung der Teilnehmer ein Rahmen, in dem ältere Menschen über ein kosten-
loses und frei zugängliches Angebot Kontakt finden und soziale Einbindung erleben können. Die Kirche
16Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
macht Quartiersarbeit, weil sie sich als Volkskirche versteht. Die „Zielgruppe (…) geht weit über die
Gottesdienstbesucher hinaus“. Eigentlich sind es alle, die im Stadtteil leben.
Nicht nur, was die Zielgruppe betrifft, sondern auch, was die Inhalte der Angebote anbelangt, geht die
Kirche weit über eine religiös gefasste Zuständigkeit hinaus. Sie versucht, auf die unterschiedlichen
Bedarfe, die die Pfarrer z. B. bei Hausbesuchen wahrnehmen, zu reagieren. Es gibt Gottesdienste, seel-
sorgerliche Begleitung und regelmäßige Gruppenangebote, bei denen auch religiöse Themen behan-
delt werden. Das Themenspektrum umfasst aber auch Information, Beratung und Austausch zum Le-
ben im Alter und Geselliges. Es gibt Sportgruppen, die sich in der Kirche treffen, Bastelkreise, Frauen-
gruppen und Chöre. Diese Angebote bieten, über ihren eigentlichen Zweck hinaus, für die älteren Men-
schen eine Tages- oder Wochenstruktur. Die Angebote sind nach Möglichkeit aktivierend gestaltet. In
der Übertragung von Methoden der kirchlichen Jugendarbeit werden die Teilnehmer an den kirchli-
chen Kreisen dazu motiviert, sich selbst einzubringen und aus dem eigenen Leben zu erzählen. Eine
besondere Form der Aktivität in der kirchlichen Seniorenarbeit ist das Ehrenamt. „Die Kirche lebt vom
Ehrenamt“, allerdings werden die Angebote in der Regel von hauptamtlichen Pfarrern oder z. B. bei
den Sportangeboten von professionellen Honorarkräften geleitet.
Im Vergleich zu ZWAR betreibt die evangelische Kirche einen höheren Aufwand für ihre Angebote, die
in der Regel hauptamtlich erbracht werden. Sie hat dabei aber auch immer die im Blick, die weniger
Ressourcen haben, um sich selbst zu organisieren. Diese Sorge um die Schwachen drückt sich auch in
der Sichtweise auf das Miteinander von Zivilgesellschaft und Staat aus: „In Langenfeld macht sich der
Staat für bürgerschaftliche Belange stark. Da gibt es ein perfektes Miteinander. Der Staat ist kein Für-
sorgestaat, der alles machen würde. Und schon gar kein totalitärer Staat, der in allen Belangen der
Bürger das Sagen hätte. (…) das wollen wir auch nicht. Nur wollen wir auch nicht den Staat, der sich
heraushält und denkt, die Bürger machen das schon selber. Das geht ja nur für die Bürger, die die
Freiheit und die Kraft haben, die können das machen, aber da fallen viele durch den Rost.“ (Näheres
zum Verhältnis von Zivilgesellschaft und Staat siehe Kapitel 5.2)
17Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
3.2 Leistungen und Angebote der Akteure
Die Leistungen, die von den befragten Akteuren erbracht werden (siehe Abb. 4), konzentrieren sich
auf den Bereich der Freizeitgestaltung – darunter fallen sowohl „klassische“ Angebote wie der Senio-
rennachmittag mit Kaffeetrinken als auch selbstorganisierte Aktivitäten in den ZWAR-Gruppen. Auch
die Angebote in den Bereichen Sport und Bildung kann man der gemeinsamen Freizeitgestaltung zu-
rechnen, ebenso die Veranstaltungen. Stark vertreten sind auch Beratung und Bereitstellung von In-
formationen. Damit wird ein Bedarf aufgenommen, der in der Fokusgruppe mit Senioren als besonders
wichtig herausgestellt worden war. Soziale Dienstleistungen und Hilfen, nach denen vor allem mit fort-
schreitendem Alter Bedarf besteht, sind hingegen verhältnismäßig schwach vertreten. Unter Sonstiges
fallen die niedrigschwelligen Quartiersaktionen von „Wir in Mitte“/SONG sowie Hilfe zur Selbsthilfe.
Angebote zur Freizeitgestaltung 11
Information und Öffentlichkeitsarbeit 8
Organisation von Veranstaltungen 7
Vernetzung bestimmter Gruppen 6
Gesellschaftliche/politische Teilhabe 6
Beratungsangebote 6
„Offene Tür“ 5
Vermittlung 5
Angebote im Bereich „Gesundheit“ 5
Sportangebote 5
Bildungsangebote 5
Bereitstellung von Infrastruktur/Geräten etc. 4
Soziale Hilfen und Dienstleistungen 4
Angebote im Bereich Religion/Weltanschauung 3
Sonstige 2
Vertretung und Pflege gemeinsamer Werte und… 2
Abbildung 4: Leistungen der Akteure
Quelle: eigene Erhebung (n=84, Mehrfachantworten)
18Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
3.3 Ressourcen
Öffentliche Mittel 7
Spenden und Sponsorengelder 6
Mitgliedsbeiträge 5
Kirchensteuer 4
Selbsterwirtschaftete Mittel 3
Vermögenserträge 2
Sonstige 1
Fördermittel anderer Organisationen 1
Abbildung 5: Zusammensetzung der Einnahmen
Quelle: eigene Erhebung (n=29, Mehrfachantworten)
In der Umfrage wurde lediglich die Art der Einkünfte (siehe Abb. 5), nicht aber die jeweilige Höhe oder
der Anteil am Gesamtbudget erfragt. In welchem Umfang die Stadt die offene Seniorenarbeit fördert,
bleibt daher unklar, aber dass die finanzielle Unterstützung durch die Kommune für viele Akteure wich-
tig ist, wird aus den Antworten deutlich, denn von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie dem Bürger-
verein Langfort e.V. und dem von der evangelischen Kirche getragenen Reparaturcafé, nehmen die
Akteure der Seniorenarbeit öffentliche Gelder in Anspruch. Diese öffentlichen Gelder stammen fast
ausschließlich von der Stadt. Landesmittel wurden von drei, Bundesmittel nur von einem der Befragten
angegeben. Für die ZWAR-Gruppen, die Freiwilligenagentur und die „Wir in Mitte“/SONG-Gruppe, leis-
tet ausschließlich die Stadt finanzielle Unterstützung. In den Seniorengruppen der Quartiersarbeit wer-
den die Gelder als Anschubfinanzierung für die Moderation der Gruppen in der Anfangsphase verge-
ben. Später sollen die Gruppen selbstorganisiert, ohne Moderator laufen – das ist bereits im Stadtteil
Immigrath der Fall.
Bei der Nennung der Einnahmen folgen Mitgliedsbeiträge und Spenden, typische Einnahmequellen
von Vereinen und Verbänden. Die evangelische Kirche, die als evangelische Kirchengemeinde, als Ju-
gendhaus „Alte Schule“ und als Reparaturcafé geantwortet hat, greift auf Kirchensteuermittel zurück.
Selbsterwirtschaftete Mittel sind im Bereich der Seniorenarbeit eher die Ausnahme. Im Umkehrschluss
kann man davon ausgehen, dass das umfängliche Angebot zur Freizeitgestaltung, Beratung o. ä. in der
Regel kostenlos zur Verfügung steht. Unter Sonstiges wurde von einer Einzelperson im freien Ehrenamt
„eigenes Vermögen“ angegeben – ein beeindruckendes Zeichen des Engagements.
Überlassung von Infrastruktur 57%
Sachmittel/Sachspenden (z.B. Papier) 57%
Serviceleistungen und Dienste 43%
Ideelle Unterstützung 43%
Abbildung 6: Verteilung der nicht-finanziellen Unterstützung
19Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
Quelle: eigene Erhebung (n=15, Mehrfachantworten)
Unterstützung kann auch nicht-finanziell geleistet werden (siehe Abb. 6, 7). Die Akteure der Senioren-
arbeit in Langenfeld werden in dieser Hinsicht zu etwa gleichen Teilen durch die Überlassung von Räu-
men, durch Sachspenden, ideelle Unterstützung oder Dienstleistungen unterstützt. Besonders gut
fühlt sich die evangelische Kirche in Langenfeld unterstützt. In der Umfrage hat sie sowohl alle nicht-
finanziellen Unterstützungsformen, mit Ausnahme der Überlassung von Personal, angegeben, als auch
alle Kategorien von Unterstützern bejaht. Die Kommune hat wie bei der finanziellen Unterstützung
auch bei der nicht-finanziellen Unterstützung eine herausgehobene Rolle. Insgesamt scheint in Lan-
genfeld die nicht-finanzielle Unterstützung aber keinen hohen Stellenwert zu haben, denn nur die
Hälfte der Akteure, die an der Umfrage teilgenommen haben, hat diese Frage beantwortet.
Kommune 4
Andere Organisationen 2
Sonstige 1
Privatpersonen/Spender 1
Wirtschaftsunternehmen 1
Öffentliche Einrichtungen 1
Abbildung 7: Wer gewährt die nicht-finanziellen Unterstützungen?
Quelle: eigene Erhebung (n=10, Mehrfachantworten)
20Kommunaler Schlussbericht Langenfeld im Rheinland
4 Kooperation, Koordination, Vernetzung
4.1 Die Koordination des Netzwerks
Die Stadt Langenfeld fördert die gute Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren durch
die Einsetzung einer Mitarbeiterin als Quartierskoordinatorin, Frau Theis. Die Zusammenarbeit wird in
den Interviews sehr positiv bewertet. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Persönlichkeit der Koordinato-
rin. Sie wird als „Idealbesetzung“ beschrieben, „weil sie so positiv eingestellt ist und Menschen ermu-
tigt“. Sie stellt Verbindungen her, sorgt für Ausgleich und bringt die richtigen Leute in Kontakt. Dass sie
sich als Mitglieder des Netzwerks empfinden, liegt bei manchen Interviewpartnern nur an der Koordi-
natorin.
Zu den Aufgaben der Quartierskoordinatorin gehört die Information der Netzwerkpartner und der
Öffentlichkeit. Dazu werden Newsletter, Infobroschüren erstellt und die Kerndaten der jeweiligen
Quartiersprojekte nebst Ansprechpartner auf der städtischen Internetseite beschrieben. Ferner wird
die Öffentlichkeit über wöchentliche Pressearbeit immer wieder auf die entsprechenden Aktionen hin-
gewiesen und auf Teilnahmemöglichkeiten aufmerksam gemacht. Wenn die Koordinatorin selber sagt,
dass für sie der Informationsfluss an erster Stelle stehe, dann bezieht sie sich weniger auf Informati-
onserzeugnisse, die auch ihren Stellenwert haben, sondern vielmehr auf die Moderation des Netz-
werks, in dem Transparenz für alle Akteure hergestellt werden muss. Dafür sind auch viele Kontakte
und Einzelgespräche nötig. Die Moderation des Netzwerks ist ein Service der Stadt, zu dem die Orga-
nisation und Protokollführung des Runden Tisches gehört. Die Koordinatorin schafft mit dem Runden
Tisch einen Rahmen zum gegenseitigen Austausch und für selbstorganisierte Kooperationen. Nur wenn
die Selbstorganisation nicht zufrieden stellend läuft, greift sie ein, klärt schwierige Situationen, spricht
mögliche Kooperationspartner an und erleichtert so die Arbeit. Sie gibt auch Impulse von außen in das
Netzwerk, indem sie etwa wissenschaftliche Partner zu Vorträgen einlädt.
Die Moderatorin entwickelt auch eigene Projektideen mit Bürgern zusammen, sieht sich aber nicht als
Akteurin. Dazu sagt sie: „Ich streue die Ideen in die Bürgerschaft“, als Angebot. „Ich habe nicht die
Erwartung, dass meine Ideen so aufgenommen und umgesetzt werden. Ich respektiere die Ehrenamt-
lichen, die das ja in ihrer Freizeit machen.“
Die Moderation des Netzwerks fungiert auch als Servicestelle für Ehrenamtliche. Sie stellt die Schnitt-
stelle zwischen dem Ehrenamt und der Verwaltung, dar und „dolmetscht“ zwischen beiden Bereichen.
Außerdem organisiert sie über die Freiwilligenagentur die Fortbildungen für die Ehrenamtlichen.
4.2 Steuerung und Beteiligung
Die erste Beigeordnete der Stadt, Marion Prell, hat das Demografiemanagement angestoßen und die
verschiedenen Bausteine nach und nach entwickelt und umgesetzt. Dabei sieht sie die Stadt nicht als
Akteur, wohl aber als „Motor des Ganzen.“
Mit der konzeptionellen Rolle ist auch ein Steuerungsanspruch verbunden. Dieser ergibt sich außer-
dem aus der Mittelvergabe an die Träger der Quartiersentwicklung. Zu den Aufgaben der Quartiersko-
ordinatorin gehört daher auch, zu überprüfen, ob die intendierten Ziele der Quartiersentwicklung er-
reicht werden. Der Überblick über die Quartiersentwicklung, den sich die Koordinatorin in den monat-
lichen Treffen mit den Quartierskoordinatoren und beim Runden Tisch verschafft, dient also nicht nur
der Begleitung und Unterstützung der Ehrenamtlichen, sondern auch der Evaluierung. Da die Ziele der
21Sie können auch lesen