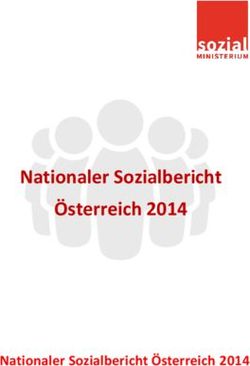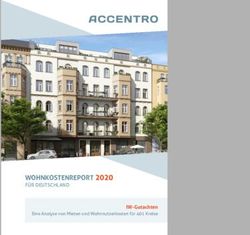Wirtschaftsbericht Österreich - Juni 2020 - Switzerland Global ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Formulaire APIS: A754
Représentation suisse à: Vienne
Pays: Autriche Date de la dernière mise à jour: Juin 2020
Wirtschaftsbericht Österreich – Juni 2020
0. Zusammenfassung
En 2019, la croissance de l’économie autrichienne a faibli à 1,5%. La crise du COVID-19 provoque
en revanche en 2020 une sévère crise économique dont les dimensions ne peuvent être à ce
stade qu’estimées de manière approximative (- 7,2% du PIB). En 2021, l’Autriche renouera avec
la croissance mais il faudra du temps pour retrouver les niveaux du PIB et de l’emploi d’avant la
crise. Le chômage a atteint un pic à la mi-avril 2020. Depuis il est en recul mais reste nettement
plus haut qu’en 2019.
Alors que les comptes de l’Etat, y compris les entités locales et les assurances sociales, ont clôturé
en 2019 avec un surplus (+0,7% du PIB) et la dette de l’Etat a baissé à 70,4% du PIB, les efforts
pour contenir la crise du COVID-19 creusent cette année le déficit et la dette publique.
L’économie autrichienne est confrontée à des rigidités structurelles importantes. Dans son pro-
gramme, le gouvernement promettait d’améliorer les conditions cadre et l’équilibre budgétaire.
Face à la récession, les priorités sont désormais le maintien de l’emploi, la survie des entreprises
– qui luttent avec le manque de liquidité – et la relance économique. Avec les paquets de mesures
de soutien le gouvernement soutiendra aussi les objectifs environnementaux.
Le commerce extérieur autrichien – biens et services – avait déjà perdu en dynamique en 2019
tout en maintenant une légère croissance (+2,6% nominal autant pour les exportations que pour
les importations). En 2020 l’évolution sera fortement négative même si le deuxième semestre de-
vrait renouer avec la croissance.
En ce qui concerne le commerce bilatéral entre la Suisse et l’Autriche, dont le montant total (biens
et services) avait dépassé en 2015 pour la première fois le seuil de 20 milliards Euro, il n’a en
2019 que légèrement baissé (20,75 Mrd. Euro) par rapport à 2018 (20,9 Mrd. Euro), les dévelop-
pements positifs dans les services ayant compensé la contraction du commerce en marchandise.
Alors que les exportations suisses avait connus une forte reprise au premier trimestre 2020, la
récession intervenue ne permet pas des prévisions fiables pour l’ensemble de l’année.
En dehors des difficultés dues à la fermeture de la frontière entre mars et juin, les échanges ne
rencontrent pas de problèmes particuliers, même si la mise en œuvre des mesures d’accompa-
gnement de la libre circulation pour les prestations transfrontalières continue à représenter une
source d’insatisfaction pour les Autrichiens.
La Suisse reste un partenaire attractif et les entreprises suisses peuvent compter sur l’appui du
Swiss Business Hub Austria (SBHA) soit pour entrer sur le marché autrichien soit pour développer
des activités existantes. En plus de nombreux services gratuits, le SBH fournit aussi des presta-
tions selon les besoins spécifiques des entreprises.1. Wirtschaftspolitische Entwicklungen und Probleme
1.1 Konjunkturentwicklung
Seit dem Jahr 2018 schwächt sich die österreichische Wachstumsdynamik, nach einer Hochkonjunk-
turphase, allmählich ab. Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft reduzierte sich auf 2,3% im
Jahr 2018, im Jahr 2019 ging es auf 1,5% zurück. Wesentliche bremsende Faktoren waren die globalen
Handelskonflikte, die Stagnation in Deutschland und Italien sowie die hohe Unsicherheit im Zusam-
menhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Auch für das Jahr 2020 wurde eine
weitere Verlangsamung des Wachstums prognostiziert. Die rasche Verbreitung des Coronavirus und
dessen Bekämpfung hat dies in eine tiefe Rezession verwandelt.
Die Ausbreitung des Coronavirus hat Österreich schnell und hart getroffen. Während zuerst hauptsäch-
lich das Bundesland Tirol betroffen war, hat sich die Lage aufgrund Anfangs lascher Vorgehensweise
innerhalb kürzester Zeit verschlechtert, so dass rasch mit drastischen Massnahmen reagiert werden
musste. Die Regierung verkündete Mitte März strikte Ausgangsbeschränkungen sowie die Schliessung
aller nicht systemrelevanten Geschäfte, Gastronomie und der Tourismuswirtschaft. Diese konnten die
Verbreitung der Epidemie bremsen, aber hatten erhebliche Auswirkungen auf die österreichische Re-
alwirtschaft. Die aktuelle Krise ist damit keineswegs mit der Finanzkrise 2008/09 vergleichbar, in der
sich das Zusammenbrechen der Finanzmärkte erst später auf die Realwirtschaft ausgewirkt hat.
Die österreichische Nationalbank (OeNB) erwartet dementsprechend einen Rückgang des realen BIP
im Ausmass von 7,2%. Die Jahre 2021 und 2022 werden von einem teilweisen Aufholprozess gekenn-
zeichnet sein, der zu einem Wachstum von 4,9% bzw. 2,7% führen soll. In der ersten Jahreshälfte 2020
wird die Wirtschaftsleistung in Österreich um 13,5% einbrechen. Bereits für das zweite Halbjahr 2020
wird aber ein deutlicher Aufholeffekt erwartet. Der oben erwähnten Prognose der OeNB liegen aller-
dings zwei wesentliche Annahmen zugrunde: Es kommt zu keiner zweiten Infektionswelle im Herbst
und Mitte 2021 steht eine medizinische Lösung (Medikament oder Impfung) zur Verfügung.
Die Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie haben drastische Auswirkungen auf die
österreichische Wirtschaft zur Folge. Zusätzlich zum starken Rückgang des Aussenhandels verminder-
ten grossflächige Betriebsschliessungen die auf den Inlandsmarkt ausgerichtete Wertschöpfung. Der
gesamtwirtschaftliche Kreislauf von Gütern und Dienstleistungen wurde gestört, wodurch sich die damit
verbundenen Zahlungsströme zwischen den Wirtschaftssektoren verringerten. Das verursachte einen
Rückgang von Nachfrage und Wertschöpfung und drängte die Unternehmen in einen Liquiditätseng-
pass. Besonders betroffen sind vom Tourismus abhängige Betriebe, Konsum, Verkehr, Handel sowie
die Veranstaltungs-, Kunst- und Kulturbranche. Das hat zu einer beispiellosen staatlichen Intervention
geführt (siehe Kapitel 1.2).
2019 hat die Dynamik im Warenhandel deutlich nachgelassen. Sowohl die Exporte als auch die Importe
zeigten mit jeweils +1% ein verlangsamtes Wachstum. Per saldo lagen die Einnahmen aus dem Güter-
verkehr mit +3,8 Mrd. Euro aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau. Österreichs wichtigster
Absatzmarkt blieb weiterhin die Europäische Union, in die 68% aller Güterexporte gingen. Ein ähnliches
Bild zeigten die Güterimporte, die zu 74% aus der EU kamen. Die Auswirkungen der 2020 einsetzenden
COVID-19-Pandemie auf Österreichs Aussenwirtschaft zeichnen sich in den Ergebnissen des aktuellen
Exportindikators der OeNB ab. Im März 2020 ergab sich ein Rückgang der nominellen Güterexporte
um 10,4%, der sich im April auf 27,3% beschleunigte. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass sich der
Rückgang zuletzt abgeschwächt hat und die Güterexporte im Mai weniger stark zurückgegangen sind
als noch im April.
Bis Ende 2019 ging die Arbeitslosigkeit sukzessive zurück, allerdings machte sich bereits im letzten
Jahr eine Abschwächung der Dynamik bemerkbar. Anfang 2020 stieg die Arbeitslosigkeit in einigen
Bereichen, wie zum Beispiel bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen, wieder an. Seit Beginn der Covid-
19 Pandemie und der Massnahmen zur Eindämmung der Krankheit stieg die Zahl der Arbeitslosen
erheblich und erreichte ihren Höhepunkt Mitte April 2020. Seitdem geht die Arbeitslosigkeit langsam
wieder zurück, verharrt aber dennoch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Laut Eurostat-Defini-
tion steigt die Arbeitslosenquote 2020 auf 6,8%, bis zum Jahr 2022 soll sie auf bis zu 5,3% zurückge-
hen. Aufgrund der Rezession ist auch die Zahl der Personen in Kurzarbeit explodiert: am Höhepunkt
Mitte April waren rund 1,3 Mio. Personen in Kurzarbeit und 530.000 Personen arbeitslos. Durch die
Neuausrichtung der Kurzarbeitsregelung konnten viele Arbeitsplätze gesichert und so ein stärkerer An-
stieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Im Rahmen der schrittweisen Lockerungen ging auch die
2/14Arbeitslosigkeit sukzessive wieder zurück und sank mit Stand 23.6. auf rund 471.000 Personen arbeits-
los und 813.000 Personen in Kurzarbeit.
Die nach EUROSTAT- Kriterien kalkulierte Inflation (HVPI) erreichte für das Gesamtjahr 2019 eine
Inflationsrate von 1,5%. Im Jahr 2020 soll sie weiter auf 0,8% sinken, im Jahr 2021 auf diesem Niveau
verharren und sich erst im Jahr 2022 wieder auf 1,5% beschleunigen.
Das Vereinigte Königreich hat mit Ablauf des 31. Januars 2020 die EU verlassen. Das Austrittsabkom-
men ist damit am 1. Februar in Kraft getreten. Dieses Abkommen sieht eine Übergangsphase bis zum
31. Dezember 2020 vor, in der der EU-Rechtsbestand weiterhin auf das Vereinigte Königreich anwend-
bar bleibt. Daher treten bis zum Ende der Übergangsperiode zunächst keine Änderungen ein. Für die
Zeit ab 2021 ist noch unklar, wie die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich
gestaltet sein werden. Die Wirtschaftskammer Österreich rechnet damit, dass keine enge Wirtschafts-
kooperation erreicht werden wird und das VK daher den EU-Binnenmarkt verlassen wird. Daraus wür-
den sich erhebliche Änderungen in den Geschäftsbeziehungen ergeben. Unternehmen müssen mit
Friktionen im Handel von Waren und Dienstleistungen rechnen. Insgesamt gehen 2,9% der österreichi-
schen Exporte ins VK und ist bei den Ausfuhren unter den Top 10 (auf Rang 9). Es wird aber nicht mit
erheblichen BIP Einbussen aufgrund des Brexits gerechnet.
1.2 Wirtschaftspolitische Massnahmen
Die ÖVP-grüne Regierung nahm Anfang des Jahres ihre Regierungsarbeit auf. Die Grundrichtung der
vormaligen ÖVP-FPÖ Regierung wird im Bereich Wirtschaft auch mit den Grünen als Koalitionspartner
fortgeführt. Der wirtschaftspolitische Fokus lag darin stabile Rahmenbedingungen herzustellen und ei-
nen ausgeglichenen Bundeshaushalt zu erreichen. Die Senkung der Schuldenquote auf 60% des BIP
wurde angestrebt. Neu dazu kamen die Verlinkungen zu Klima- und Zukunftsinvestitionen, die unab-
hängig davon sichergestellt werden sollen. Diese Ziele wurden noch vor der Covid-19 Pandemie im
gemeinsam Regierungsprogramm formuliert. Seitdem Corona auch Österreich erreicht hat und restrik-
tive Massnahmen zur Eindämmung der Krankheit erforderlich wurden, mussten sich die Prioritäten der
neu gebildeten Regierung schlagartig ändern. Dementsprechend wurden kaum wirtschaftspolitische
Massnahmen bis zum Beginn der Coronakrise gesetzt. Nachdem die Regierung einen Lockdown ver-
ordnete, kämpften Unternehmen schlagartig mit Liquiditätsengpässen und eingebrochener Nachfrage.
Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft einzudämmen war eine Abkehr vom Streben
nach einem Nulldefizit notwendig. Finanzminister Blümel signalisierte mit seiner Bekundung, die Wirt-
schaft zu unterstützen «koste es was es wolle» ein hohes Level an Flexibilität, um auf die im Zuge der
Krise auftretenden Herausforderungen zu reagieren. Je drastischer sich die Pandemie auf die österrei-
chische Wirtschaft auswirkte, desto notwendiger wurde ein grosszügiges Hilfspaket. Die Regierung be-
schloss deshalb ein 38 Mrd. schweres Hilfspaket, dass sich aus einem Soforthilfefonds von 4 Mrd. Euro,
neun Mrd. Euro an Garantien und Haftungen zur Kreditsicherung, 15 Mrd. Euro für Notfallhilfe 1, um
Branchen zu unterstützen die besonders hart von der Krise getroffen wurden, zusammensetzt. Zusätz-
lich wurden zehn Mrd. Euro für Steuerstundungen veranschlagt um die Liquidität der Unternehmen zu
sichern. Von den 38 Mrd. Euro wurden 12 Mrd. Euro insbesondere für Kurzarbeit aufgewendet.
Zusätzlich zu diesem Hilfspaket wurde am 15.6. ein erstes 14 Mrd. schweres Konjunkturpaket ange-
kündigt. Dieses Paket beinhaltet eine Senkung der Umsatzsteuer in ausgewählten Sektoren (dafür fehlt
allerdings noch die Erlaubnis der EU, da Umsatzsteuerregelungen eng mit EU-Regelungen verflochten
sind) – so soll die Umsatzsteuer bis Jahresende in der Gastronomie auf fünf Prozent sinken und zwar
für alle Speisen und Getränke. Die Umsatzsteuersenkung soll zudem sowohl für die Hotel-, als auch
für die Kulturbranche gelten. Personen die zwischen Juli und September mindestens zwei Monate ar-
beitslos sind erhalten eine Einmalzahlung von 450 Euro. Dem gingen lange Debatten über die Erhö-
hung des Arbeitslosengeldes voraus, was die ÖVP schliesslich ablehnte. Ein Teil der schon geplanten
Steuerreform wird mit diesem Konjunkturpaket vorgezogen, so soll die Senkung der ersten Tarifstufe
der Lohn- und Einkommenssteuer – nicht wie ursprünglich geplant erst im kommenden Jahr – sondern
bereits rückwirkend mit Beginn 2020 gelten. Konkret wird der Eingangssteuersatz, der auf Einkom-
mensteile zwischen 11.000 und 18.000 Euro gezahlt wird, von 25 auf 20% gesenkt (maximale Entlas-
tung pro Jahr 350 Euro). Pro Jahr kostet die Senkung den Staat rund 1,5 Mrd. Euro an Einnahmen.
Von dieser Steuersenkung profitieren Personen die unter 11.000 Euro im Jahr verdienen nicht, da sie
1
Die Notfallhilfe beinhaltete Fixkostenzuschüsse für die Gastronomiebranche, Hilfspakete für die Kulturbranche und den Sport,
Kreditgarantien und ähnliches.
3/14nicht steuerpflichtig sind. Um auch diese grosse Gruppe der Geringverdiener zu begünstigen, hat die
Regierung angekündigt, die Negativsteuer – also eine Steuergutschrift, die man vom Finanzamt be-
kommt – um 100 Euro jährlich zu erhöhen. Unklar ist noch, ob die Erhöhung der Negativsteuer dauer-
haft im System verankert wird oder nur einmalig für 2020. Um bei Familien für zusätzliches Einkommen
und damit Kaufkraft zu sorgen, will die Regierung sie pro Kind mit einem Bonus in Höhe von 360 Euro
unterstützen. Dabei handelt es sich um eine einmalige Massnahme, die nur für dieses Jahr vorgesehen
ist. Um Investitionen wieder anzukurbeln, soll es eine Investitionsprämie von mindestens 14% des in-
vestierten Kapitals geben. Einige dieser Massnahmen sind an Klimaziele gebunden, so werden bei-
spielsweise insbesondere klimafreundliche Investitionen gefördert. Auch beim Unterstützungspaket der
Austrian Airlines (der Staat unterstützte die Airline mit 600.000 Euro) knüpfte die Regierung die Gelder
an Klimaziele. Dies wird insbesondere den Grünen, die erstmals in einer österreichischen Regierung
sind, zugeschrieben.
Abgesehen von den Corona bedingten wirtschaftspolitischen Massnahmen hatte die Regierung auf-
grund der Krise keine Zeit weitere Massnahmen zu verabschieden. Ein Teil der geplanten Steuerreform
wird mit dem Konjunkturpaket umgesetzt, ob weitere Teile dieses Jahr folgen, ist derzeit noch unklar.
Diese Steuerreform übernimmt wichtige Elemente der von der vormaligen ÖVP-FPÖ Regierung ge-
planten Reform, die aufgrund der abrupten Auflösung der Koalition nicht umgesetzt werden konnte. Ein
weiterer unvollendeter Plan war die Reform der Bankenaufsicht. Zur auf Eis gelegten Reform der Ban-
kenaufsicht beinhaltete das Regierungsprogramm keine Angaben und die Regierung gab in den letzten
Monaten keine Informationen dazu bekannt (weitere Details unter 1.3.3).
Der Stärkung des Wirtschaftsstandort Österreichs wird weiterhin viel Bedeutung beigemessen. Dem-
entsprechend sind die vorgeschlagenen Massnahmen wie Fachkräfteoffensive, Entbürokratisierung,
Förderung des Unternehmertums, Modernisierung der Lehre, Senkung der Körperschaftssteuer, Re-
duktion von Gold Plating im Grossen und Ganzen eine Fortschreibung des alten Regierungsprogram-
mes. Neue Ideen umfassen die Förderung von Entrepreneurship, so soll unternehmerisches Denken
bereits in der Schulzeit forciert, eine Kultur der 2. Chance (insbesondere bei Gründern von innovativen
Start-ups) verankert und eine EU-weit einheitliche, zeitgemässe Gesellschaftsform («EU-Limited») für
innovative Start-ups und KMUs umgesetzt bzw. gefordert werden. In welchem Zeitraum dies nun tat-
sächlich umgesetzt werden soll ist unklar, da die Auswirkungen der Coronakrise auf die Unternehmen
in Österreich noch nicht genau abzuschätzen sind. Wahrscheinlich ist, dass der Fokus vorerst auf der
Erhaltung der Arbeitsplätze und der Liquiditätssicherung der aktuell existierenden Unternehmen liegt,
bevor die Förderung des Unternehmertums wieder aktiv angestrebt werden kann.
Ursprünglich wollte die österreichische Bundesregierung wieder zu einem jener Länder mit der gerings-
ten Arbeitslosigkeit in der EU werden (wie dies zuletzt 2011 der Fall war). Besonderes Augenmerk sollte
unter anderem auch auf Personengruppen gelegt werden, die von der positiven Arbeitsmarktsituation
der letzten Jahre kaum oder gar nicht profitieren konnten, zum Beispiel durch den Ausbau konkreter
Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderungen oder ein Ausbau der Sprachkurse für Mig-
ranten. Insgesamt wollte man auch den Fachkräftebedarf sichern und die betriebliche Lehrausbildung
aufwerten und stärken. Doch diesem Vorhaben machte die Coronapandemie einen Strich durch die
Rechnung. Prioritär ist jetzt so viele Menschen wie möglich in die Arbeitswelt zurückzuführen; wie viele
Ressourcen und Aufmerksamkeit für besonders fragile [oder exponierte] Gruppe bleibt ist offen.
1.3 Finanz und Budgetpolitik
1.3.1 Budgetrahmen
Seit 2017 verbessern sich die öffentlichen Finanzen sukzessive. Im Jahr 2019 wurde in Österreich das
zweite Jahr in Folge ein Budgetüberschuss erreicht. Der gesamtstaatliche Budgetsalto betrug 2019
+0,7% des Bruttoinlandsprodukts. In absoluten Zahlen betrug der Überschuss laut Statistik Austria 2,9
Mrd. Euro. Gegenüber 2018 fiel das Plus um 700 Mio. Euro höher aus (+0,2%). Der öffentliche Schul-
denstand verringerte sich von 285,3 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 280,4 Mrd. Euro. Die öffentliche Schul-
denquote sank weiter und zwar von 74% im Jahr 2018 auf 70,4% des BIP im Jahr 2019. Der Budget-
überschuss kam grösstenteils dank eines starken Anstiegs der Staatseinnahmen, aufgrund der positi-
ven Konjunkturentwicklung 2019 zustande. Relativ gering fiel hingegen der Anstieg der Staatsausga-
ben aus.
4/14Alle vier Teilsektoren des Staates (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) verzeichneten
im Jahr 2019 einen Überschuss. Auch alle einzelnen Bundesländer konnten einen Budgetüberschuss
erreichen und Schulden abbauen. Erstmals seit 2007 hat die Stadt Wien 2019 keine neuen Schulden
mehr gemacht, sondern einen Überschuss von 9,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Nulldefizit wurde
damit ein Jahr früher erreicht als ursprünglich geplant. Budgetüberschüsse und eine konsequente Til-
gung der Schulden waren für dieses Jahr in allen Bundesländern geplant. Aufgrund der Coronakrise,
wird sich dies aber wahrscheinlich ändern. Prognosen über die Budgets der Bundesländer wurden noch
keine erstellt.
Die Budgetverhandlungen des Bundes für das Jahr 2020 erwiesen sich zu Beginn – vor allem aufgrund
der Überschattung der Coronakrise – als schwieriger als geplant. Schliesslich konnte das Budget aber
Ende Mai beschlossen werden und trat am 1. Juni in Kraft. Da die Staatsausgaben aufgrund der
Corona-Hilfszahlungen dramatisch höher sein werden, als die Einnahmen, rechnet die Regierung mit
einer Überschreitung des Budgets von 28 Mrd. Euro, das Defizit dürfte bei mindestens 7,5% des BIPs
liegen, die Staatsverschuldung auf 80% oder mehr steigen. Der im Bundesfinanzrahmengesetz 2020-
2023 vorgesehene Nettofinanzierungssaldo ist aus derzeitiger Sicht nicht mehr haltbar. Auch die Bud-
gets der nächsten Jahre werden von der Coronakrise überschattet, es wird auch hier zu starken An-
passungen des Finanzrahmens kommen müssen. Der Staatshaushalt 2020 ist von enormen Unsicher-
heiten gekennzeichnet, die in weiten Teilen nur bedingt quantifiziert werden können. Dies betrifft ins-
besondere Dauer und Umfang der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise, makroökonomische
Risiken und eine Ausweitung der Massnahmen zur Konjunkturbelebung.
1.3.2 Frankenkredite verlieren an Brisanz
Viele Kreditnehmer hatten vor 2008 ihre Kredite in Schweizerfranken abgeschlossen. Mit der Aufwer-
tung durch die Eurokrise und der Aufhebung des Mindestkurses wurden diese Kredite zu einer Heraus-
forderung. Nun normalisiert sich die Lage langsam, aber stetig. Der Betrag der ausstehenden Fremd-
währungskredite sinkt weiter: Ende Dezember 2019 hatten diese einen Gegenwert von 13,25 Mrd. Euro,
davon 96,1% in CHF und der Rest beinahe zur Gänze in Japanische Yen. Der Fremdwährungsanteil
an allen aushaftenden Krediten an private Haushalte wurde 2019 um 1,3% auf 8,3% gesenkt. Damit
ist der Betrag um «wechselkursbereinigte» 74,60% gegenüber dem Höhepunkt von 2008 gesunken.
Damals hatte die Finanzmarktaufsicht die Vergabe von neuen Frankenkrediten an Privathaushalte ver-
boten. Die Entspannung betrifft auch Unternehmen, Städte und Gemeinden die noch Frankenkredite
haben.
Einige Verfahren von Kunden gegen Banken sind anhängig. Banken und Vermittler hätten ihre Kunden
aufklären müssen, was im Fall der Beendigung des Mindestkurses passiert. Wurde das nicht gemacht,
bestehen nun möglicherweise gute Chancen vor Gericht. Mittlerweile gibt es ein rechtskräftiges Urteil
vom Handelsgericht Wien, das als Basis dienen kann:2 eine Bank wurde wegen mangelhafter Beratung
verurteilt. Da die Verjährungsfrist am 15. Januar 2018 ablief, sind neue Verfahren jetzt ausgeschlossen.
Wie viele Verfahren am Laufen sind, ist öffentlich nicht bekannt.
1.3.3 Finanz- und Bankensektor
Im Jahr 2019 erzielten die österreichischen Kreditinstitute ein konsolidiertes Jahresergebnis von rund
6,7 Mrd. Euro und damit um 0,2 Mrd. Euro weniger als im Vorjahr. Der 2019 erzielte Gewinn der Banken
wurde von einem Anstieg beim Ergebnis aus Wertberichtigungen, Wertminderungen und Wertaufho-
lungen sowie Rückstellungen für das Kreditrisiko sowie von deutlich höheren „sonstigen Rückstellun-
gen“ belastet. Zudem ging das Betriebsergebnis aufgrund von gestiegenen Abschreibungen und Wert-
minderungen von immateriellen Vermögenswerten zurück. In Anbetracht der COVID-19 Krise mahnt
die österreichische Nationalbank die Kreditinstitute für dieses Jahr zur Zurückhaltung bei Ausschüttun-
gen von Gewinnen, Boni und Dividenden. Die Kreditqualität hat sich auch im Jahr 2019 weiterhin ver-
bessert. Die Kapitalisierung der österreichischen Banken lag Ende 2019 im Durchschnitt bei 15,6%.
Das anziehende Kreditwachstum sowie steigende Dividendenausschüttungen erschweren den Banken
2
Hintergrund: Einem Kunden aus Oberösterreich wurde ein Frankenkredit als Modell für die Pensionsvorsorge verkauft. Die
von dem Kunden eingebrachte Klage wurde darauf gestützt, dass es bei der Beratung zwar Thema gewesen sei, dass die Min-
destbindung von 1,20 aufgehoben werden könnte, dem Kunden aber nicht gesagt worden sei, was mit dem Kurs des Franken
dann passieren würde. Das Gericht habe sich folglich auf ein Gutachten gestützt, das besage, dass Experten wissen müssten,
dass der Kurs steige und dies die Kredite verteuere. Das Gericht entschied, dass die Beratung in diesem Punkt mangelhaft
gewesen sei. Der Vermittler musste dem Betroffenen seinen Schaden von rund 30.000 Euro ersetzen. Weil der Kredit im
Herbst 2016 fällig geworden war, war der Schaden auch klar zu beziffern.
5/14einen weiteren Kapitalaufbau. Seit dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-
2009 haben sich die Kapitalquoten der österreichischen Banken allerdings aufgrund von gesteigerten
Markt- sowie regulatorischen Anforderungen mehr als verdoppelt.
Die Ratingagentur Fitch bewertet Österreichs Bonität weiterhin mit der zweitbesten Note AA+, hat den
Ausblick aber von „positiv“ auf „stabil“ herabgesetzt. Die Revision des Ausblicks spiegelt die erhebli-
chen Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie auf Österreichs Wirtschaft und die öffentlichen
Finanzen, wider. Fitch zufolge bestehen erhebliche Abwärtsrisiken für diese Prognosen, die davon aus-
gehen würden, dass die Beschränkungen relativ rasch aufgehoben würden und die COVID-19-Pande-
mie im zweiten Halbjahr eingedämmt werde, was eine wirtschaftliche Erholung 2021 ermögliche. Die
wirtschaftlichen Ergebnisse könnten 2020 und 2021 aber deutlich schwächer ausfallen, falls es zu einer
zweiten Infektionswelle und einer Wiederaufnahme der Sperrmassnahmen kommt oder falls sich die
Handelspartner Österreichs nicht erholen.
Änderungen wurden im Herbst 2018 auch bei der Bankenaufsicht beschlossen, so sollte ein Teil der
sich bei der Österreichischen Nationalbank befand, auf die Finanzmarktaufsicht ausgelagert werden,
wo sich ebenfalls bereits ein Teil der Kompetenzen befand. Ziel der vormaligen Regierung war der
Abbau von Überschneidungen und somit die Regulierung und die Aufsicht strenger zu trennen. Die
Regulierung sollte im Parlament und beim Finanzministerium angesiedelt werden. Die Nationalbank
hätte damit lediglich die Kompetenz im Bereich der Finanzmarktstabilität tragen sollen. Geplant war die
Umsetzung dieser Reform für das Jahr 2019. Aufgrund der frühzeitigen Auflösung der Regierung, wur-
den die Vorarbeiten zur Umsetzung der Reform auf Eis gelegt. Seit Antritt der türkis-grünen Regierung
wurde das Vorhaben nicht noch einmal thematisiert. Es ist daher unklar, ob die Pläne im Laufe der Zeit
weiterverfolgt werden.
Ein wichtiger Schritt für die Reputation Österreichs auf den Finanzmärkten war die Lösung bei der
Entschädigung der HETA (ehemalige Hypo Alpe Adria) Gläubiger. Das Angebot wurde im Herbst 2016
von 98,71% der Gläubiger (Kapitalsumme) angenommen. Der Bund stellte einen Kredit von mehr als
9,5 Milliarden Euro zur Verfügung, davon soll das Land Kärnten 1,2 Milliarden über 30 Jahre zurück-
zahlen. Weitere Mittel werden aus der Liquidation der noch vorhandenen Aktiva der HETA in den nächs-
ten Jahren zurückfliessen. Diese Liquidation entwickelte sich 2018 sowie auch im Jahr 2019 besser als
erwartet, da sie aus dem Verkauf ihrer Vermögenswerte etwas mehr Geld einnahm, als ursprünglich
erwartet. Aufgrund der Coronakrise wird sich der Abbauplan etwas verzögern: gemäss einer Neuein-
schätzung der erwarteten Abwicklungsdauer wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2023 das ge-
samte Abbauportfolio verwertet wurde. Anschliessend wird ein Liquidationsverfahren eröffnet und es
wird angenommen, dass bis Ende 2025 (davor war das Planende 2023) noch bestehende Abwicklungs-
erschwernisse innerhalb der Liquidation aktiv von der HETA beseitigt werden. Derzeit sind rund 87,96%
(+1,5% im Vergleich zum Vorjahr) aller Vermögenswerte abgebaut und bar realisiert.
1.4 Standort
Mittelfristig hat Österreich seit 2015 im IMD-Ranking – betreffend internationalen Standortvergleich -
einen bedeutenden Sprung nach vorne gemacht und lag 2018 auf Rang 18, rückte im letzten Jahr aber
um einen Rang nach hinten. Im Juni 2020 verbesserte sich Österreich allerdings wieder und konnte 3
Plätze aufholen und liegt damit auf Platz 16. Damit hat Österreich in diesem Jahr seinen wichtigsten
Handelspartner, Deutschland (Rang 17), überholt. Besonders hervorgehoben wurden die Produktivität
und Motivation der Arbeitnehmer sowie die Effizienz der Klein- und Mittelbetriebe. Den Wirtschafts-
standort zeichnen laut Ranking die gut qualifizierten Fachkräfte aus.
Im jährlich publizierten WEF Global Competitiveness Report 2019 verbesserte sich Österreich um
einen Rang von Platz 22 auf Platz 21 von 141 untersuchten Staaten. Im Ranking punktet Österreich
unter anderem mit guter Infrastruktur, makroökonomischer Stabilität, einer günstigen Budgetentwick-
lung, Rechtssicherheit und zuverlässigen öffentlichen Institutionen. Nachholbedarf ortet das WEF bei
der Unternehmensfinanzierung, der Nutzung digitaler Netze, der Dauer von Unternehmensgründungen
sowie der allgemeinen Unternehmensdynamik. Negativ bewertet wird die starke Belastung der Unter-
nehmen durch öffentliche Regulierungen, die mangelhafte Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte mit
digitalen Kompetenzen, die massive Besteuerung des Faktors Arbeit sowie generell die zu hohe Steuer-
und Abgabenquote in Österreich.
6/142. Internationale und regionale Wirtschaftsabkommen
2.1 Prioritäten Österreichs
Die EU ist Österreichs prioritärer politischer und wirtschaftlicher Handlungsrahmen. Die Erweiterungs-
und Aussenhandelspolitik, einschliesslich des Abschlusses von Freihandelsabkommen (FHA), liegen
in EU-Kompetenz. Als kleines EU-Mitglied bleibt Österreich nur ein begrenzter aussenwirtschaftspoliti-
scher Spielraum. Der überwiegende Anteil der österreichischen Aussenwirtschaft ist damit eine EU-
Binnenwirtschaft und wird durch EU-Recht, nicht durch internationale Verträge, geregelt. So hat Öster-
reich derzeit gültige, bilaterale Investitionsschutzabkommen (ISA) mit 60 Staaten, allerdings werden
seit der Einführung der diesbezüglichen Unionskompetenz, Investitionskapitel direkt im Rahmen der
EU-Abkommen mit Drittstaaten ausgehandelt und umgesetzt. Betreffend den ISAs zwischen EU-Mit-
gliedstaaten, hielt Österreich an seinen zwölf Investitionsschutzabkommen mit Mitgliedsstaaten fest.
Im sogenannten Achmea-Urteil urteilte der Gerichtshof der Europäischen Union aber Ende 2018, dass
das Unionsrecht Investitionsschiedsklauseln in völkerrechtlichen Abkommen zwischen Mitgliedsstaa-
ten der EU entgegensteht. Im Lichte dieses Urteils hat sich Österreich gemeinsam mit anderen Mit-
gliedsstaaten zur Beendigung aller intra-EU Abkommen bis Ende 2019 bekannt und beabsichtigt in
diesem Sinne das von der grossen Mehrheit der EU Mitgliedstaaten mitgetragene plurilaterale Abkom-
men zur Beendigung der Intra-EU BITs Anfang nächsten Jahres zu unterzeichnen, hat dies aber bisher
noch nicht getan. 23 EU Staaten haben das Abkommen bereits unterzeichnet, damit stellt Österreich
eine Ausnahme dar.
Österreich setzt mit seiner Osteuropa- und Westbalkan Ausrichtung einen deutlichen, politischen und
aussenwirtschaftlichen Schwerpunkt. Dies gilt für die Aussenpolitik im Allgemeinen (regionale Partner-
schaftsinitiative, Unterstützung des Beitrittsprozesses der südosteuropäischen Länder, der Donaustra-
tegie und der östlichen Partnerschaft der EU usw.) ebenso wie für die Aussenwirtschaftspolitik. Auf
bilateraler Ebene werden grundsätzlich, parallel zu den immer weiter nach Osten ausgreifenden Wirt-
schaftsbeziehungen, auch die politischen und diplomatischen Beziehungen zum Schwarzmeerraum
und bis nach Zentralasien verstärkt, nicht zuletzt auch mit Blick auf die energiepolitischen Interessen
(ÖMV). Zentralasien und der Kaukasus spielen auch im Kontext der gemeinsamen EU-Energie-Aus-
senpolitik eine wichtige Rolle. Mit der neuen Aussenwirtschaftsstrategie wird Asien als Zukunftsmarkt
eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Die Aussenwirtschaftsstrategie wurde am 17.12.2018 unter
der Federführung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) in Zu-
sammenarbeit mit dem Aussenministerium und der Wirtschaftskammer Österreich vorgestellt. Die Stra-
tegie wurde in einem partizipativen Prozess erarbeitet und umfasst folgende 7 Arbeitsschwerpunkte:
Aussenwirtschaftspolitik (AWP) mit Perspektive, AWP mit Werteorientierung, AWP mit Standort-Effekt,
AWP mit Schwerpunkten (Stärken ausserhalb der klassischen Exportmärkte, strategische Zukunfts-
märkte, Branchenoptimierung, Beteiligung an internationalen Infrastrukturprojekten), AWP mit Zu-
kunftsorientierung (Digitalisierung, Innovation), AWP mit klaren Fakten, AWP aus einer Hand 3.
2.2 Auswirkungen auf die Schweiz, Diskriminierungspotential
Österreich trägt grundsätzlich die EU-Aussenwirtschaftspolitik mit und profitiert von den entsprechen-
den Abkommen (Beitritte, Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommen). In diesem Sinne besteht ge-
genüber der Schweiz kein spezifisches, jedoch ein generelles Diskriminierungspotenzial infolge der
EU-Nichtmitgliedschaft der Schweiz. Andererseits profitierte die Schweiz bisher von der stabilisie-
renden Wirkung, die vom EU-Beitritt wie auch von Assoziierungsabkommen auf die betroffenen Län-
der ausging (erhöhte Rechtssicherheit, Verbesserung des Marktzugangs durch die Ausdehnung der
Abkommen CH-EU auf neue EU-Mitglieder).
Die Beschlüsse betreffend die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative wurden mit grossem In-
teresse verfolgt. Der Schweizer Entscheid eines „Arbeitslosen-Vorrangs“ wurde eher positiv und mit
einer gewissen Erleichterung wahrgenommen. Die bürokratische Praxis seitens der Kantone und der
Sozialpartner bei der Anwendung der FLaM wird kritisch diskutiert. Die Trinationale Arbeitsgruppe (CH-
AT-DE) erlaubt in diesem Bereich eine offene Diskussion sowie eine effiziente Suche nach Lösungen.
Die Frustration betreffend FLaM bleibt aber und in diesem Bereich betont Österreich die Bedeutung der
Unterstellung der FLaM im Rahmenabkommen, wobei Lohnschutz und der Kampf gegen Lohndumping
als legitime Ziele anerkannt werden.
3
https://www.chatworld.eda.admin.ch/Pages/GetDocument.aspx?docid=464006&returnurl=/Pages/Home.aspx
7/14Österreich hat ein klares Interesse am Schutz von bestehenden Wertschöpfungsketten und ist daher
bereit Schweizer Anliegen im Bereich Schutzmassnahmen zu Aluminium und Stahl zu unterstützen. Es
betont aber gleichzeitig, dass die Regelungen WTO konform sein müssen.
3. Aussenhandel
3.1 Entwicklung und Perspektiven
Das Exportland Österreich hat einen weit verzweigten und hoch differenzierten Aussenhandel mit einer
Exportquote von knapp 55% des BIP entwickelt. Im Jahr 2019 beliefen sich die österreichischen Güter-
und Dienstleistungsexporte laut den Daten des österreichischen Wirtschaftsministeriums auf 220,4
Mrd. Euro und stiegen damit um nominell 2,6% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Gesamtimporte
stiegen um nominell 2,6% auf 206,2 Mrd. Euro. Der Anteil des Handels mit Dienstleistungen am ge-
samten Außenhandel betrug im Durchschnitt (2006 - 2018) 27,9% (Exporte) bzw. 23,1% (Importe),
wobei der Anteil eine steigende Tendenz aufweist. Im längerfristigen Trend konnte sich die Außenhan-
delsbilanz (Güter und Dienstleistungen) insbesondere auch durch den Abbau der Defizite im Güterhan-
del verbessern. Deutschland bleibt sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen der wichtigste
Handelspartner.
3.1.1 Warenhandel
2019
Im Warenhandel hat die Dynamik 2019 deutlich nachgelassen. Sowohl die Exporte als auch die Importe
zeigten mit jeweils +1% (real) ein verlangsamtes Wachstum. Per saldo lagen die Einnahmen aus dem
Güterverkehr mit +3,8 Mrd. Euro aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau. Österreichs
wichtigster Absatzmarkt blieb weiterhin die Europäische Union, in die 68% aller Güterexporte gingen.
Ein ähnliches Bild zeigten die Güterimporte, die zu 74% aus der EU kamen.
Im Jahr 2019 exportierte Österreich Waren im Wert von rund 153,8 Mrd. Euro. Die österreichischen
Ausfuhren erreichten damit einen Höchststand. Das wichtigste Abnehmerland war Deutschland mit ei-
nem Exportwert von ca. 45,1 Mrd., was 29,4% des Gesamtexports entsprach. Die Vereinigten Staaten
(Anteil am Gesamtexport 6,7%) blieben zweitwichtigster Handelspartner. Darauf folgen Italien (Anteil
6,3%) auf dem dritten und die Schweiz (Anteil 4,7%; +3,6%) auf dem vierten Platz.
Auch bei den Importen erreichte Österreich einen Rekordwert. Waren im Wert von rund 158 Mrd. Euro
wurden nach Österreich importiert. Als Herkunftsland war wiederum Deutschland mit einem Importwert
von ca. 55,3 Mrd. Euro und einem Importanteil von 35% der wichtigste Handelspartner. Italien war
zweitwichtigster Handelspartner mit einem Anteil am Gesamtimport von 6,6%. Darauf folgen China
(6,2%), die USA (4,5%), Tschechien (4,2%) und schliesslich die Schweiz (3,8%, -10,7%) auf dem 6.
Platz.
Das bedeutendste Exportgut stellten Maschinen und Fahrzeuge dar, die im Wert von etwa 61,8 Mrd.
Euro ausgeführt wurden und damit 40,2% des gesamten Exports ausmachten. Bei den Importgütern
standen Maschinen und Fahrzeuge mit etwa 56,8 Mrd. Euro Importwert und einem Importanteil von
35,9% auf dem ersten Rang.
Vorschau 2020
Nachdem sich die wirtschaftliche Wachstumsdynamik bereits 2019 abschwächte, brachte die Covid-19
Krise einen erheblichen Einbruch im österreichischen Aussenhandel. Seitdem die Massnahmen aller-
dings gelockert wurden, erholt sich die Wirtschaft wieder. Sollte sich die Situation weiterhin günstig
entwickeln und weitere Lockerungsschritte möglich machen, erwartet die österreichische Nationalbank
eine Erholung bereits im 2. Halbjahr 2020. Insgesamt wird für das Jahr 2020 ein Rückgang der öster-
reichischen realen Gesamtexporte um 11,6% erwartet. Bei den Importen wird ein Einbruch von -8,6%
erwartet.
3.1.2 Handel mit Dienstleistungen
Österreich hat 2019 gemäss OeNB 67,1 Mrd. Euro an Dienstleistungen exportiert, was einem Zuwachs
von 6,1% im Vergleich zu 2018 entspricht. Mehr als ¾ der Dienstleistungen werden in die EU exportiert.
Die Dienstleistungsimporte stiegen um 7,1% auf 56,8 Mrd. Euro. Seit dem Einbruch des Aussenhandels
8/14mit Dienstleistungen im Krisenjahr 2009 stieg der Anteil am BIP kontinuierlich an und erreichte 2019
neue Höchstwerte. Der Reiseverkehr gilt weiterhin als Stabilisator (was 2020 aber aufgrund der Pan-
demie nicht der Fall sein wird) und tragende Säule der österreichischen Leistungsbilanz. Der Anteil des
Reiseverkehrs an den Gesamtdienstleistungen ist jedoch rückläufig. Die wichtigste Dienstleistungska-
tegorie im Bereich der Exporte ist nach wie vor der Reiseverkehr, der fast 30,5% der Ausfuhren aus-
macht und dessen dominante Position gehalten werden konnte. Dieser Sektor erzielt auch die höchsten
Überschüsse mit 10,2 Mrd. Euro gefolgt von den Wissensintensiven Unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen (Knowledge Intensive Business Services) mit 2,1 Mrd. Euro. Die so genannten Knowledge
Intensive Business Services gewinnen zunehmend an Bedeutung und werden in zwei grössere Subka-
tegorien unterteilt: Technisch-innovative Dienstleistungen (Telekommunikation, EDV- und Informati-
onsdienstleistungen, Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung, Architektur- , Ingenieur- und
sonstige technische Dienstleistungen) und Wissensbasierte Dienstleistungen (Rechts- und Wirtschafts-
dienste, Werbung und Marktforschung, Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erho-
lung). Deren Anteil bei den Exporten stieg insgesamt von 22,5% (2006) auf 30,4% (2019) und bei den
Importen von 22,5% (2006) auf 32,2% (2019). Daraus resultiert eine positive Dienstleistungsbilanz von
10,4 Mrd. Euro (2018: 10,3 Mrd. Euro). Wie beim Güterexport ging der grösste Anteil – rund 76,7% der
Dienstleistungsexporte in die EU 28. Deutschland ist auch bei den Dienstleistungen der wichtigste Han-
delspartner, der Exportanteil beträgt 39,7%. Auch bei den Importen lag die EU 28 mit einem Anteil von
79,9% an der Spitze, der Anteil deutscher Dienstleistungsimporte beträgt 29,1%.
3.2 Bilateraler Handel Schweiz - Österreich
3.2.1 Bilateraler Warenhandel
2019
Der bilaterale Handel zwischen der Schweiz und Österreich verzeichnete 2019 eine durchzogene Bi-
lanz. Besonders hervorzuheben sind die markant sinkenden Schweizer Exporte seit Anfang 2018: die
Exporte sind jedes Quartal, inkl. dem der ersten drei Quartale 2019 im Vorjahresvergleich gesunken.
Im ersten Quartal 2019 sanken die Exporte um 24,1%, im dritten Quartal konnten sich die Exporte
merklich erholen, lagen aber dennoch bei um 2,3% weniger als im Vorjahresvergleich, im 4. Quartal
sanken sie wieder erheblich um 26,6%.
Gemäss Statistik Austria verzeichnet Österreich einen Zuwachs der Ausfuhren von 3,6% auf 7,26 Mrd.
Euro im Vergleich zum Vorjahreswert. Die Schweiz macht damit wie auch im Vorjahr 4,7% der öster-
reichischen Exporte aus.
Bei den Einfuhren nach Österreich liegt die Schweiz (gemäss AT-Angaben) nach Deutschland, Italien,
China, den USA und Tschechien an sechster Stelle, und zwar mit einem Volumen von 6,07 Mrd. Euro.
Dies entspricht einem Anteil von 3,8% der österreichischen Gesamtimporte. Damit führte Österreich
10,7% weniger als 2018 ein. Dieser regelrechte Einbruch hat über ein Jahr angehalten und zieht sich
durch nahezu alle Produktkategorien.
Aus schweizerischer Perspektive sieht die Entwicklung des Warenhandels 2019 wie folgt aus: Die ös-
terreichischen Importe in die Schweiz stiegen um 1,6% auf rund 8,45 Mrd. CHF. Die wichtigsten Pro-
dukte nach Schweizer Statistik waren Produkte der Chemisch-pharmazeutischen Industrie (33,9%) so-
wie Maschinen, Apparate und Elektronik (15,6%) und Metalle (11,8%).
Die Schweizer Exporte nach Österreich beliefen sich auf 6,36 Mrd. CHF und sanken somit um 15%.
Die wichtigsten Produkte waren – gemäss Schweizer Statistik – Produkte der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie (38%) gefolgt von Maschinen Apparate, Elektronik (14,4%), Metalle (11,7%) sowie
Edelmetalle, Edel- und Schmuckteile (8,7%).
Wichtigste Exportgüter Österreichs waren Chemikalien (vor allem auch Arzneien und Rohstoffe für die
Pharmaindustrie) sowie Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Metalle, Holz- und Papierwaren sowie Möbel.
Die wesentlichen Importwaren sind pharmazeutische Rohstoffe, Gold, Maschinen und Anlagen, Arz-
neien und Uhren.
2020
Mit einem Anteil von 5,4% aller österreichischen Exporte belegt die Schweiz von Januar bis März 2020
Rang 4, gemäss Statistik Austria. In diesem Zeitraum stiegen die Exporte um 6,5% auf knapp 2 Mrd.
Euro. Die Importe stiegen von 1,5 Mrd. Euro um 41,5% auf 2,1 Mrd. Euro. Damit erzielten die Schweizer
9/14Exporte ein Rekordquartal und so konnten die Verluste an Marktanteilen von 2019 wettgemacht wer-
den.
Gemäss Schweizer Statistik (EZV), standen in der Zeit von Januar bis März 2020 2,1 Mrd. CHF Schwei-
zer Exporte (+40,1%) rund 2,3 Mrd. CHF Importen aus Österreich (+ 7%) gegenüber.
3.2.2 Bilateraler Dienstleistungshandel
Schon wie in den Jahren 2016, 2017 und 2018 stellte die Schweiz – gemäss Statistik der österreichi-
schen Nationalbank – auch 2019 den wichtigsten Absatzmarkt für österreichische Dienstleistungen
ausserhalb der EU dar. Mit Ausfuhren von 5,2 Mrd. Euro (2018: 4,86 Mrd.) und Einfuhren von 2,22
Mrd. Euro (2018: 2,22 Mrd.) wurde eine Steigerung in beide Richtungen verzeichnet. Die Schweiz ist
die zweite Kundin (nach Deutschland) und die vierte Dienstleistungslieferantin (nach Deutschland, Ita-
lien und dem Vereinigten Königreich). Bei den österreichischen Ausfuhren blieben die wichtigsten Be-
reiche, der Reiseverkehr mit 1,432 Mrd. Euro sowie die sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleis-
tungen mit 1,258 Mrd. Euro. Bei den österreichischen Importen sind die Spitzenplätze von Transport-
dienstleistungen (468 Mio. Euro) und sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen (592 Mio.
Euro) belegt.
4. Direktinvestitionen
4.1 Generelle Entwicklung und Perspektiven
2019 konnten wieder sowohl aktiv als auch passivseitig höhere Zuflüsse bei den Transaktionen ver-
zeichnet werden. Die aktiven Transaktionen verdoppelten sich nahezu auf einen Wert in Höhe von 9,4
Mrd. Euro. Die passiven Direktinvestitionen erreichten einen Wert von 4,1 Mrd. Euro und waren damit
mehr als doppelt so hoch wie 2018. Auch bei den Direktinvestitionsbeständen gab es sowohl auf der
aktiven als auch auf der passiven Seite neue Höchstbestände. Die aktiven Bestände erreichten einen
Wert von rund 209 Mrd. Euro, die passiven von 183 Mrd. Euro.
Laut Statistik Austria standen Ende 2016 (neuere Zahlen nicht verfügbar) 10’800 Firmen in Österreich
unter Kontrolle ausländischer Konzerne. Diese haben 576’000 Menschen beschäftigt. 75% der aus-
landskontrollierten Unternehmen wurden von Konzernzentralen innerhalb der EU gesteuert; mit Ab-
stand wichtigstes Land war dabei mit einem Anteil von 39% Deutschland. Danach folgte schon die
Schweiz mit 11%. In Schweizer Betrieben in Österreich sind über 25’000 Arbeitnehmer beschäftigt
(Rang 4 bei den Direktinvestitionen), in österreichischen Unternehmen in der Schweiz ca. 18’000.
4.2 Bilaterale Investitionsbestände und -flüsse
Die österreichischen Direktinvestitionen in der Schweiz haben in den letzten 20 Jahren sukzessive zu-
genommen. Ende 2019 belief sich der Kapitalbestand bei rund 8,1 Mrd. Euro und machte knapp 4%
des Gesamtbestandes der österreichischen Direktinvestitionen aus. Die Transaktionsflüsse betreffend,
war die Schweiz das fünftwichtige Zielland hinter Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Luxemburg und Malaysia, und zwar mit einem Transaktionsfluss von 549 Mio. Euro.
Allgemein gehört die Schweiz zu den bedeutendsten Investoren in Österreich. Der Gesamtbestand an
Investitionen von Schweizer Firmen ist 2019 um 7% gestiegen und liegt bei einem Rekordwert von 11,8
Mrd. Euro, was etwa 6,4% des Gesamtbestandes der österreichischen passiven Direktinvestitionen
entsprach. Die Trankaktionsflüsse betreffend war die Schweiz 2019 das achtwichtigste Herkunftsland
nach Deutschland, Japan, Russland, Luxemburg, Niederlande, Brasilien und Frankreich und zwar mit
einem Transaktionsfluss von 299 Mio. Euro.
Im ersten Halbjahr 2020 fanden nach Wissensstand der Botschaft keine Firmenübernahmen statt. Die-
ser ungewöhnliche Umstand ist vermutlich der Coronakrise geschuldet.
10/145. Handels-, Standort- und Tourismusförderung, Landeswerbung
5.1 Aussenwirtschaftsförderung
Österreich ist für die Schweiz ein wichtiger „naher Markt“, der in der Aussenhandelsstatistik der Schweiz
unter den ersten zehn Exportmärkten rangiert. Schon seit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanz-
krise 2008/09 hatte sich der österreichische Markt für Schweizer KMUs als äusserst stabil erwiesen.
Die wachsende österreichische Wirtschaft öffnet neue Chancen für Schweizer Exporteure. Trotzdem
gingen die Schweizer Exporte nach Österreich seit dem 1.Quartal 2018 mit wenigen Ausnahmen suk-
zessive zurück (siehe Kapitel 3.2.1.). Für Österreich als Exportmarkt spricht aus Schweizer Sicht, dass
KMUs, gerade wenn sie am Beginn ihrer Exportaktivitäten stehen, hier in einen geographisch und kul-
turell gut zugänglichen Markt exportieren können. Sprachliche Hindernisse sind kein Thema. Damit
bietet Österreich zumindest für Deutschschweizer KMUs einen geeigneten Einstieg in den europäi-
schen Binnenmarkt. Zudem bemühte sich die erste Regierung Kurz um den Abbau von bürokratischen
Hürden und um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den «Standort Österreich». Dieser
Prozess ist noch in der Anfangsphase sollte aber von der zweiten Regierung Kurz fortgesetzt werden.
Mit Österreichs traditionell engen Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa verfügt die hiesige Volks-
wirtschaft zudem über eine zusätzliche regionale Dimension, die für Schweizer KMUs dank dem spe-
zifischen österreichischen Know-how in diesen Märkten einen weiteren Mehrwert bietet.
Die Beratung von schweizerischen und liechtensteinischen Unternehmen, die ihre Produkte und Leis-
tungen nach Österreich exportieren wollen, erfolgt durch den Swiss Business Hub Austria (SBHA) als
Teil der Schweizerischen Botschaft in Wien und unter der fachlichen Leitung von Switzerland Global
Enterprise (S-GE), Darüber hinaus unterstützt der Swiss Business Hub Austria österreichische Unter-
nehmen die sich in der Schweiz ansiedeln wollen. Der Swiss Business Hub verzeichnet seit Anfang
2019 eine erhöhte Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.
5.2 Potenziale für Österreich in der Schweiz
5.2.1 Tourismus & Freizeitwirtschaft, Ausbildung, andere Gebiete
Der Tourismus und die Freizeitwirtschaft Österreichs spielen in der österreichischen Volkswirtschaft
eine bedeutende Rolle. Im internationalen Wettbewerb ist die österreichische Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft konkurrenzfähig. Die jährlichen Zuwächse setzen sich auch 2019 wieder fort. Im Jahr 2019
wurden knapp 153 Mio. Nächtigungen (+1,9% im Vergleich zum Vorjahr) erzielt. Die grössten relativen
Zuwächse unter den Top 15 Herkunftsmärkten verzeichnen Rumänien (+8,8%), Tschechien (+6,9%)
und die USA (+6,5%). Die Schweiz und Liechtenstein bleiben auch 2019 der drittwichtigste Herkunfts-
markt. Einen nennenswerten Rückgang verzeichnen Großbritannien (-3,3%) und Russland (-1,3%).
Die vorläufigen Daten zur Wintersaison 2019/20 verzeichnen sowohl bei den Ankünften (-22%) als auch
bei den Nächtigungen (-18,1%) einen Rückgang, der bereits auf die Covid-19 Pandemie zurückzufüh-
ren ist. Bis einschliesslich Februar 2020 hatte die laufende Wintersaison noch einen Nächtigungszu-
wachs von 7,2% im Vergleich zur Vorjahresperiode erzielt. Im April gab es erwartungsgemäss kaum
Ankünfte und Nächtigungen. Mit einem Rückgang auf 96,5% wurden um 7,92 Mio. Nächtigungen we-
niger registriert als im April des Vorjahres. Aufgrund des wahrscheinlichen Wegfalls der meisten aus-
sereuropäischen Touristen in der Sommersaison, ist Österreich (wie auch die Schweiz) ganz besonders
auf die nahen Märkte angewiesen. Das bedeutet wahrscheinlich auch eine erhöhte Aufmerksamkeit
gegenüber Schweizer Touristen und einen stärkeren Wettbewerb insbesondere um den deutschen
Markt.
Auch die Schweiz verzeichnete 2019 einen Rekord bei den Nächtigungen. Mit 39,6 Mio. Nächtigungen
(+1,9%) im Vorjahresvergleich erreicht die Schweiz einen neuen Höchstwert. Sowohl aus dem Inland
als auch aus dem Ausland ist die Nachfrage im letzten Jahr gestiegen. Mit 21,6 Mio. Nächtigungen war
die ausländische Nachfrage höher als je zuvor. Positiv sind vor allem die ansteigenden Nächtigungen
aus dem amerikanischen Kontinent und Asien. Bei Touristen aus Österreich ist ein Nächtigungsrück-
gang von -0,5% und bei den Ankünften von -1,9% zu verzeichnen.
Die Schweiz und Österreich weisen als Tourismusländer eine ähnliche Faktorausstattung auf (Alpen,
Umweltqualität, Städtetourismus). Dabei ist Österreich bei Preis und Servicequalität der Hotellerie und
Gastronomie mit Ausnahme des obersten Preissegments attraktiver. Im Vorteil ist die Schweiz aller-
dings wiederum beim öffentlichen Verkehr, den Superlativen bei der Topografie (Anzahl 4’000er), vier
11/14Sprach- und Kulturräumen, etc. Das preisliche Niveau der Schweiz schreckt allerdings immer wieder
Gäste aus Österreich ab – womit auch das Tourismuspotential limitiert ist.
5.2.2 Verkehr & Verbindungen
Der Bau des Brennerbasistunnels hat im März 2015 begonnen. Dieser Tunnel wird mit seinen 64 Kilo-
metern die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt sein. Bis 2028 soll das auf 8,3 Mrd.
Euro geschätzte Projekt in Betrieb genommen werden; wobei eine zweijährige Verzögerung nicht aus-
geschlossen ist. Die Kosten werden zu 40% von der EU getragen, den Rest teilen sich Österreich und
Italien (je 30%).
Der Semmeringbasistunnel ist eines der wichtigsten Projekte der neuen Südstrecke und erfüllt als Teil
des Baltisch-Adriatischen Korridors von Danzig bis Ravenna eine Schlüsselfunktion. Der Korridor ver-
bindet 5 Staaten und 14 Regionen zwischen der Ostsee und der Adria. Der Tunnel soll 2027 fertig sein.
5.2.3 Die Schweiz als Investitionsziel, Potenzial
In den letzten 8 Jahren (2012-2019) haben sich mindestens 29 österreichische Firmen in der Schweiz
angesiedelt (ca. 1,5 % aller Ansiedlungen). Diese Zahl wurde von den Kantonen gemeldet, was bedeu-
tet, dass bei diesen Firmen die kantonale Wirtschaftsförderung oder Switzerland Global Enterprise in-
volviert war. Es haben möglicherweise weitere Ansiedlungen stattgefunden, diese werden jedoch nicht
von den Kantonen erhoben. Die Volatilität und die unterschiedlichen Methoden der schweizerischen
und österreichischen Statistiken erschweren eine Analyse, welche auf quantitativen Angaben beruht.
Es ist aber festzuhalten, dass der Austausch zwischen den beiden Ländern gross ist und sehr viele
Firmen in beiden Ländern präsent sind. Was das Interesse von österreichischen Firmen, sich in der
Schweiz niederzulassen, betrifft, zeigt sich, dass viele österreichische KMUs neben den bekannten
Standortvorteilen der Schweiz, wie hoher Innovationskraft, liberalem Wirtschaftssystem und hervorra-
gender Infrastruktur vor allem dem Prinzip „Follow the customer“ folgen. Durch eine eigene Repräsen-
tanz in der Schweiz können die KMUs ihren Schweizer Kunden ein besseres Service bieten - was von
Schweizer Seite, als nicht EU-Mitglied, wieder sehr geschätzt wird. Eine geplante Ansiedlung und In-
vestition in der Schweiz kann der Swiss Business Hub Austria unterstützen.
5.2.4 Interesse für den Schweizer Finanzplatz
Bei den schweizerischen Investitionen im Bankwesen konnte man in den letzten Jahren auf dem hei-
mischen Finanzplatz nur wenig Bewegung verzeichnen. Die zuletzt getätigte, neue Investition war der
Ende 2013 und rückwirkend auf 1. Januar 2013 datierte Verkauf der österreichischen Kreditkartenge-
sellschaft Paylife (Visa, Mastercard) an die schweizerische Six-Gruppe. Mit dem Zukauf in Wien kam
Six nun auch in den Besitz einer Banklizenz. Diese kann bei der weiteren Auslandsexpansion genutzt
werden.
Verschiedene Versicherungsunternehmen (Zürich, Helvetia) und Schweizer Banken sind am österrei-
chischen Markt aktiv. Die UBS hat 2016 ihre Tätigkeiten in die europäische Gesellschaft mit Sitz in
Frankfurt eingebracht. Die CS ist seit 2007 über Zweigniederlassungen ihrer Sitze in Luxemburg ver-
treten. Neben Wien wird auch Salzburg als Festspielstadt mit ihrem zahlungskräftigen Publikum von
den auch im Kultursponsoring aktiven Schweizer Banken als Ort einer Niederlassung genutzt (UBS,
CS, ZKB als Hauptsitz). Einige dieser Unternehmen verfügen über Vertretungsbüros, andere betreuen
ihre Kunden möglicherweise aus der Schweiz; die ZKB hat sich durch die Übernahme einer Drittbank
(Privat-Invest AG, Salzburg und Wien) in Österreich etabliert. Der Versicherer Swiss Life Select ist im
Finanzberatungsbereich am österreichischen Markt präsent und ist mit seinem Erwerb einer österrei-
chischen Wertpapierfirma hierzulande auf Expansionskurs. Für kleinere schweizerische Privatbanken
und Finanzdienstleister bleibt das Österreich-Geschäft schwierig. Auf rechtlicher Ebene wird zudem der
Marktzutritt der in Österreich tätigen schweizerischen Finanzunternehmen durch die Lizenzierungs-
pflicht erschwert, der alle Finanzintermediäre aus Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder des EWR unter-
stehen.
Die am 1.1.2013 in Kraft getretenen Erleichterungen des Marktzugangs konnten beim Übergang zum
automatischen Informationsaustausch bestätigt werden. Das bilaterale Abkommen zum automatischen
Informationsaustausch ist seit 1.1.2017 in Kraft.
12/14Sie können auch lesen