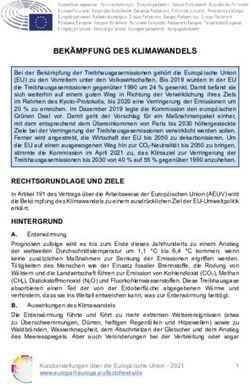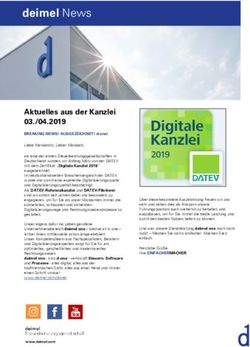Vergleich der Raumord-nungspolitik der EU und der Bundesrepublik Deutschland
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vergleich der Raumord-
nungspolitik der EU und der
Bundesrepublik Deutschland
Oberseminar Volkswirtschaftslehre
Europäische Raumordnungs- und Regionalpolitik
Vorgelegt von Christian Arndt
Nellstraße 37 A
54295 Trier
Matrikelnr.: 703643
Universität Trier
Fachbereich IV/Volkswirtschaftslehre
Stadt- und Regionalökonomie
Prof. Dr. Harald Spehl /Dipl.-Geogr. Michaela Gensheimer
Sommersemester 2005Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 2
2. Begriffsbestimmung 2
2.1 Raumordnung 2
2.2 Raumordnung in der EU 2
2.2.1 Das Europäische Raumordnungskonzept
EUREK 3
2.2.2 Kompetenzen der EU-Raumordnungspolitik 4
2.3 Raumordnung in der Bundesrepublik 5
2.3.1 Kompetenzen 6
2.3.2 Raumordnungspläne als Instrument der
bundesdeutschen Raumordnungspolitik 7
3. Vergleich der Raumordnungspolitik der EU
und der Bundesrepublik Deutschland 8
3.1 Gemeinsamkeiten 8
3.2 Unterschiede 8
4. Rolle der Regionen und die Zukunft einer gemeinsamen
EU-Raumordnungspolitik 10
11. Einleitung
Die folgende Arbeit hat zum Ziel, den Begriff der Raumordnung und die
Raumordnungspolitik der Bundesrepublik Deutschland und der Europäi-
schen Union darzustellen. Die Darlegung der Zielsetzungen der Raum-
ordnungspolitik in der Bundesrepublik und der EU soll gleichzeitig wichti-
ge Merkmalsunterschiede aufzeigen und in einer abschließenden Be-
trachtung einer kritischen Prüfung unterzogen werden.
2. Begriffsbestimmung
2.1 Raumordnung
Der Begriff der Raumordnung beschreibt die planmäßige Ordnung, Ent-
wicklung und Sicherung von größeren Gebietseinheiten. Konkret bedeutet
das, den physischen Raum, seine Nutzung und Entwicklung so zu gestal-
ten, dass dieser Eingriff auch die Lebensbedingungen für künftige Gene-
rationen sichert.1
2.2 Raumordnung in der Europäischen Union
Die Europäische Union verfolgt – losgelöst von den Raumordnungspoliti-
ken ihrer Mitgliedsstaaten – eine eigenständige Raumordnungspolitik.
Leitgedanke ist die Angleichung der verschiedenen Raumordnungspoliti-
ken der EU-Mitgliedsstaaten aneinander. Die EU-Raumordnung ist leit-
bildgetragen und versteht sich als europäischer Überbau über die nationa-
len Raumordnungspolitiken.
Bereits seit Ende der 70er Jahre hatte es Versuche gegeben, eine einheit-
liche europäische Raumordnung zu schaffen und die raumordnerische
Kompetenz auf die europäische Ebene zu verlagern. Vorreiter waren hier
Frankreich, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland. Wäh-
rend bisweilen schwieriger Verhandlunge gelang es jedoch nicht, alle Mit-
gliedsstaaten von der Notwendigkeit einer europäischen Raumordnungs-
behörde zu überzeugen. So scheiterten in den 80er und 90er Jahren
1
Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Handwörterbuch der Raumordnung
2mehrere der dafür einberufenen Konferenzen zwischen den Nationalstaa-
ten und der Europäischen Union.2
In erster Linie waren Kompetenzstreitigkeiten der Nationalstaaten unter-
einander und mit der EU für das Scheitern verantwortlich. Allerdings wur-
de in den 90er Jahren letztendlich doch eine gemeinsame Raumord-
nungspolitik auf EU-Ebene installiert. Diese ist allerdings so gehalten,
dass sie nicht in die Kompetenzen der Nationalstaaten eingreift.
Die in den 90er Jahren entstandene EU-Raumordnungspolitik ist leitbild-
basiert. Sie versucht, durch die Schaffung eines gemeinsamen Gerüstes
zur Raumordnung Vorschläge für die nationalstaatlichen Raumordnungs-
politiken zu generieren. Die Leitbilder werden dabei durch Ziele beschrie-
ben:
• Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt
• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und des
kulturellen Erbes
• Ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit des europäi-
schen Raumes
• Ausgewogenes und polyzentrisches Städtesystem und
eine neue Beziehung zwischen Stadt und Land
• Gleichwertiger Zugang zu Infrastruktur und Wissen
• Nachhaltige Entwicklung, intelligentes Management
und Schutz von Natur und Kulturerbe
Diese Ziele sind eingebettet in das Raumordnungskonzept EUREK der
EU.
2.2.1 Das Europäische Raumentwicklungskonzept EUREK
Zur Manifestierung der oben genannten Leitbilder wurde auf der Raum-
ordnungskonferenz der EU in Potsdam 1999 unter Teilnahme aller Mit-
gliedsstaaten der EU ein gemeinsames Raumordnungskonzept für die
Europäische Union verabschiedet: das EUREK. Es nimmt alle genannten
Leibildentwürfe auf und bündelt sie zu einem gemeinsamen Leitbildkata-
log. Allerdings stellt das EUREK ausdrücklich nur einen allgemeinen Be-
2
FALUDI, Andreas; S. 6
3zugsrahmen für die zukünftige Entwicklung der Raumordnung in der EU
dar. Auf Verbindlichkeit des Programmes wurde bewusst verzichtet.3
2.2.2 Kompetenzen der EU-Raumordnungspolitik
Aufgrund der Streitigkeiten aus den Vorbereitungskonferenzen zu einer
gemeinsamen europäischen Raumordnungspolitik wurde bei deren Aus-
gestaltung auf Unverbindlichkeit für die Nationalstaaten gesetzt. Damit
wollte man verhindern, dass diese „abgespeckte“ Variante der Raumord-
nungspolitik völlig von den Mitgliedsstaaten ignoriert und bekämpft wird.
Die EU besitzt damit faktisch keinerlei raumordnerische Kompetenz und
ist fast ohne Einfluss auf die nationalen Raumordnungspolitiken.
Allerdings hat die EU sich über einen Umweg doch Einfluss auf die natio-
nale und regionale Raumordnungspolitik in den Mitgliedsstaaten gesi-
chert. Dies erfolgte mit Hilfe diverser EU-Förderprogramme für die Regio-
nalentwicklung. Diese Programme werden für Regionen aufgelegt, die in
puncto Wirtschaftskraft unter dem EU-Durchschnitt liegen, hier zum Bei-
spiel unter 75% des EU-Bruttoeinkommens:
Abb. 1: Das Prinzip der EU-Raumordnungspolitik (eig. Darstellung)
Die hier 75% unter dem EU-Durchschnitt liegenden Regionen können an
bestimmten Förderprogrammen der EU teilnehmen, um ihre regionale
Wirtschaftskraft zu stärken. Voraussetzung für die Teilnahme ist jedoch
3
FALUDI, Andreas; S.6
4die Einhaltung vorgegebener Kriterien bei der Mittelverwendung. Hier
kommt nun das EUREK ins Spiel. Dessen Leitbilder werden bei den Vor-
gaben zur Förderung von EU-Seite angeführt. Über diesen Umweg („Poli-
tik der goldenen Zügel“) ist die EU in der Lage, ihre Vorstellung von
Raumordnung und das Ziel einer EU-einheitlichen Raumordnung zu ver-
folgen und durchzusetzen und unter bestimmten Umständen die nationa-
len Raumordnungspolitiken vollständig zu umgehen.
2.3 Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland
Die deutsche Raumordnung besteht seit Gründung der Republik 1949
und ist im Laufe der Zeit stets angepasst worden. Sie findet ihren verbind-
lichen Rahmen im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG). Auch die
bundesdeutsche Raumplanung ist getragen von generellen Leitbildern für
die Raumordnung und Raumentwicklung. Das Hauptleitbild ist dabei das
der nachhaltigen und ausgeglichenen Entwicklung. Folgende Leitvorstel-
lungen tragen die bundesdeutsche Raumordnung:
• Die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und in
der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen
• Die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und entwickeln
• Schaffung der Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche Ent-
wicklungen
• Langfristige Offenhaltung der Gestaltungsmöglichkeiten der
Raumnutzung
• Stärkung der prägenden Vielfalt der Teilräume
• Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen
Ferner existieren zwei Leitbilder, die erst in jüngster Zeit hinzugekommen
sind:
• Ausgleich der räumlichen und strukturellen Ungleichgewichte zwi-
schen den bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands getrenn-
ten Gebieten
5• Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Zusammen-
halt in der Europäischen Union und im größeren europäischen
Raum
Diese allgemein gehaltenen Leitbilder werden durch Grundsätze der
Raumordnung ergänzt beziehungsweise konkretisiert. Diese beziehen
sich auf die Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung, Infrastruktur,
Natur- und Landschaftsschutz, sowie den Wohnungsbau, Kultur, Sport
und Freizeit sowie den Zivilschutz und der militärischen Verteidigung.4
2.3.1 Kompetenzen in der bundesdeutschen Raumordnung
Die Kompetenzen in der bundesdeutschen Raumordnung sind föderalis-
tisch geprägt und abgestuft. Die konkrete Umsetzung der Leibilder der
Raumordnung erfolgt nach dem Raumordnungsgesetz „vor Ort“ in den
Ländern (§6 ROG). Die Länder sind hierbei verpflichtet, Raumordnungs-
pläne aufzustellen, die dazu dienen, Teilgebiete der Länder zu kategori-
sieren und ihre Nutzung zu benennen. Die Aufstellung der Pläne erfolgt in
enger Abstimmung mit der Regional- und Kommunalplanung in den Län-
dern, sowie den jeweils betroffenen Fachplanungen (Verkehr, Küsten-
schutz, etc.). Folgende Grafik verdeutlicht die Zusammenarbeit:
Abb. 2: Die Bundesraumordnung
Quelle: BBR, Raumordnungsbericht 2000
Hieraus wird deutlich, dass die bundesdeutsche Raumordnung sehr klar
hierarchisch und mit klarer Kompetenzzuweisung aufgebaut ist. Die Bun-
desraumordnung stellt Grundsätze auf, die Länder konkretisieren sie in ih-
rer Landesraumordnungsplanung, umgesetzt wird die Planung in Zusam-
4
§1f. ROG vom 18.08.1997
6menarbeit mit der Planung in den Regionen und in den Kommunen unter
Begleitung der Fachplanungen (Gegenstromprinzip).
2.3.2 Raumordnungspläne
Als Konkretisierung der Bundesraumplanung stellen die Raumordnungs-
pläne das eigentliche Entwicklungsinstrument für die Länder, Regionen
und Kommunen der Bundesrepublik dar. In ihnen werden Teilräume und
ihre konkrete Nutzung benannt und ausgewiesen. Am Beispiel der Region
Trier soll das hier verdeutlicht werden:
Abb.3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan von Rheinland-Pfalz für
die Region Trier
Quelle: http://www.geacarta.de/landesplanung-rlp.rop.htm.gif
In der obigen Abbildung aus dem Raumordnungsplan des Landes Rhein-
land-Pfalz sind die verschiedenen Nutzungskategorieren der Gebiete in
der Stadt Trier erkennbar. Orange-braune Gebiete sind für die Wohnnut-
zung ausgewiesen, gelbe Gebiete sind ausgewiesene Gebiete mit Misch-
nutzung für Wohnen und Gewerbe. Hier ist also von Landesseite in Zu-
sammenarbeit und unter Einbeziehung der Vorstellungen und Planung
7der Region und der Kommune eine bestimmte Nutzungsart vorgesehen
und ausgewiesen worden. Das Raumordnungsgesetz verpflichtet die
Länder zum Aufstellen von Raumordnungsplänen (in den Freien und
Hansestädten und im Stadtstaat Berlin Flächennutzungspläne), die die
Vorgaben des Raumordnungsgesetzes erfüllen und die Leitbilder der
Bundesraumordnung beinhalten.5
3. Vergleich der Raumordnungspolitiken der Europäischen
Union und der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Gemeinsamkeiten
Die Raumordnungspolitik der EU und die der Bundesrepublik weisen eine
Reihe von Gemeinsamkeiten auf. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die
deutsche Raumordnungspolitik bei den Verhandlungen über eine ge-
meinsame europäische Raumordnungspolitik zusammen mit der der Nie-
derlande einen erheblichen Einfluss ausgeübt hat.
So finden sich viele Ziele aus den bundesdeutschen Leitbildern für die
Raumordnung auch in den Leitbildern der europäischen Raumordnungs-
politik wieder. Auch diese haben eine nachhaltige Entwicklung zum Ziel,
die Rücksicht auf die regionalen Gegebenheiten und auf die Bewahrung
des kulturellen Erbes nimmt. Es werden in beiden Raumordnungspolitiken
Leitbilder entwickelt, die Einfluss auf die konkrete Planung nehmen sollen
und helfen sollen, einen Rahmen für die Planungspraxis zu stecken.
3.2 Unterschiede
Vergleicht man nach der Feststellung, dass beide Raumordnungspolitiken
über große Ähnlichkeiten bei der Leitbildgestaltung verfügen, die weiter-
gehende Raumordnungspolitik, so werden sehr schnell gravierende Un-
terschiede zwischen europäischer und bundesdeutscher Raumordnungs-
politik deutlich. Weiter oben wurde bereits angesprochen, dass die EU-
Regionalpolitik sich auf die Gestellung von Leitbildern beschränkt und
somit keinerlei raumordnerische Kompetenzen bei der praktischen Aus-
gestaltung in den Nationalstaaten besitzt. Sie ist also auf die Ausarbeitung
5
§8 ROG
8eines Überbaus beschränkt, den sie den nationalen Raumordnungspla-
nungen zu vermitteln versucht, auf dass diese in jene einfließe.
Demgegenüber ist die bundesdeutsche Raumordnungspolitik in puncto
Kompetenzen und Zuständigkeiten sehr genau abgegrenzt und organi-
siert. Den Überbau und das raumordnerische Leitbild stellt der Bund, die
konkrete Planung gestalten die Länder in Absprache mit den Regionen
und Kommunen. Hierzu muss bemerkt werden, dass der Schwerpunkt der
planerischen Kompetenz eindeutig bei den Ländern liegt, die – sich an
den Leitbildern nach Möglichkeit orientierend – die jeweilige Raumord-
nungspolitik und Raumplanung in Eigenregie weitestgehend ohne Einbe-
ziehung des Bundes durchführen.
Im Vergleich zur bundesdeutschen Raumordnungspolitik fehlt der EU-
Raumordnungspolitik also der ausführende Unterbau, der die EU-
Leitbilder in konkrete Planungen umsetzt. Doch ist die EU gänzlich ohne
Kompetenzen, ihre Vorstellungen von Raumordnung durchzusetzen?
Dank der EU-Regionalpolitik, die eng mit der EU-Raumordnungspolitik
verzahnt ist, gelingt es der EU dennoch, eigene Vorstellungen umzuset-
zen beziehungsweise umsetzen zu lassen. Verschiedene Strukturförde-
rungsprogramme von EU-Seite geben die Möglichkeit, die Entwicklung in
den Mitgliedsstaaten der EU zu beeinflussen. So werden für die Gewäh-
rung der Fördermittel für bestimmte Projekte Bedingungen gestellt. Diese
beinhalten zumeist Vorstellungen der EU-Raumordnung, die es dann für
die den Förderantrag stellenden Regionen einzuhalten und umzusetzen
gilt. Die EU-Raumordnungspolitik bedient sich daher also einem fiskali-
schen Instrument der Intervention in den Mitgliedsstaaten, um ihren Vor-
stellungen von Raumordnung zu Durchsetzungskraft zu verhelfen. Damit
ähnelt die EU-Raumordnungspolitik eher der Frankreichs, das seine
Raumordnungspolitik auch eher regionalpolitisch ausrichtet, während die
Bundesrepublik eher auf eine interventionistische und vorbestimmte
Raumordnungspolitik setzt.
Ein kritischer Punkt bei der Betrachtung von Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden ist der des Ziel-Konfliktes zwischen beiden Raumordnungspo-
litiken. Das ist in der Hinsicht zu verstehen, als dass es in der Bundesre-
publik seit 1993 möglich ist, dass die Länder auch am Bund und damit
dessen Leitbildern für die Raumordung in der Bundesrepublik vorbei bei
9der EU um Fördergelder für bestimmte regionale Vorhaben vorstellig wer-
den können. Damit würde in diesen Regionen oder Ländern für diese
Vorhaben einzig und allein die EU-Raumordungspolitik samt Leitbilder
gültig werden, die bundesdeutsche Raumordnung geriete hierbei ins Ab-
seits. Im Falle der Bundesrepublik sind hier Konflikte mit der EU aufgrund
der hohen Übereinstimmung der Leitbilder kaum zu erwarten. Konflikte
könnten allerdings dann entstehen, wenn es um die Gewährung von För-
dermitteln für Regionen geht, die zwar im europäischen Vergleich finan-
ziell gut dastehen, im bundesdeutschen Vergleich jedoch nicht. Zur Zeit
ist ein möglicher Konfliktpunkt zwischen EU, der Bundesrepublik und den
Regionen im §12 (1) ROG enthalten. Dieser besagt, dass zeitlich befristet
Planungen und Maßnahmen der Länder und Regionen untersagt werden
können, wenn sie Ziele der Bundesraumordnung unmöglich machen oder
„wesentlich“ erschweren würden. Damit wäre es denkbar, dass sich der
Bund – nähme er seine Rolle in der Raumordnungspolitik sehr ernst – ge-
gen eine direkte Verbindung Länder – EU stellt und auf Beteiligung an
den Planungen und Absprachen drängt. 6
4. Die Rolle der Regionen und die Zukunft einer gemeinsa-
men EU-Raumordnungspolitik
Wie gesehen existieren bis dato im Prinzip zwei parallele Raumordnungs-
politiken auf EU-Ebene und in der Bundesrepublik. Die EU verfährt hier
so, dass Leitbilder aufgestellt werden, deren Durchsetzung unter Zuhilfe-
nahme der Regional- und Strukturförderung (operationale Raumord-
nungspolitik) der EU sichergestellt wird.
In der Bundesrepublik ist die Raumordnung hierarchisch organisiert, die
Kernkompetenz kommt hier den Ländern und Regionen zu, der Bund
stellt die raumordnerischen Leitbilder dafür auf und sichert sich hierüber
den grundlegenden Einfluss auf die Landes- und Regionalplanung.
Es steht die grundsätzliche Frage an, wie mit der Raumordnungspolitik in
der EU weiter zu verfahren ist. Sollen die Nationalstaaten ihren Einfluss
behalten? Sollen der EU mehr Kompetenzen zufallen? Soll sie am Ende
gar die Kompetenz der Nationalstaaten übernehmen und direkt mit den
6
§12, (1), (2) ROG
10Ländern und Regionen die Raumordnungspolitik und -planung abstim-
men?
Zur Beantwortung dieser Fragen muss zunächst grundsätzlich überlegt
werden, welchen Vorteil eine EU-weit einheitliche Raumordnungsplanung
insgesamt hätte. Zunächst würde sie sicherlich zur Auflösung des natio-
nalstaatlichen Denkens führen und den Europäischen Gedanken in die
Raumordnungspolitik einbringen. Erstmals wäre die Möglichkeit gegeben,
gleiche Kriterien für die Raumordnungspolitik in allen EU-Mitgliedsstaaten
einzuführen, um so ein einheitliches Raumordnungsprinzip für die ganze
EU durchzusetzen. Damit wäre es auch denkbar, dass nachteilige Unter-
schiede zwischen EU-Staaten aufgrund unterschiedlicher Raumnutzungs-
konzepte in den Hintergrund treten oder sogar ausgeschaltet würden.
Dies könnte beispielsweise bei der Ausweisung von Gewerbeflächen gel-
ten, wo es bis dato hinsichtlich der Standortfestlegung in der EU erhebli-
che nationale Unterschiede gibt. Somit würde dem Gedanken der Trans-
parenz und der Einheitlichkeit Rechnung getragen und der Leitgedanke
der einheitlichen und gleichmäßigen Entwicklung der EU-Regionen könn-
te bedient werden.
Eine einheitliche EU-Raumordnungspolitik birgt jedoch auch die Gefahr,
dass sie kaum Rücksicht auf die unterschiedliche Struktur der Mitglieds-
staaten nimmt. So sind die Mitgliedsstaaten der EU keineswegs einheit-
lich entwickelt, weder von der Infrastruktur, noch von der Siedlungsstruk-
tur her. Daher müsste eine europäische Raumordnungspolitik der unter-
schiedlichen Entwicklung der EU-Staaten diesem Faktum Rechnung tra-
gen. Am einfachsten wäre dieses zu bewerkstelligen, indem die Raum-
ordnungspolitik der EU eben keinen einheitlichen Raumordnungsplan für
den EU-Raum aufstellt. Dieses wäre vermessen und würde den Bedürf-
nissen der EU-Länder nicht gerecht werden. Vielmehr könnte man sich
hier der raumordnerischen Praxis zwischen den deutschen Bundeslän-
dern und der EU seit 1993 bedienen: Die Länder können raumordneri-
sche Maßnahmen seit 1993 direkt mit der EU verhandeln und Förderun-
gen für ihre Raumordnungs- und Entwicklungskonzepte aquirieren. Es
würde ein „Netzwerk von Aushandlungsprozessen“ entstehen.7 Es wäre
also denkbar, dass die Regionen der EU regionale Entwicklungspläne
7
FÜRST, Dietrich; S. 7
11aufstellen, die sich an raumordnerischen Leitbildern der EU-
Raumordnungspolitik orientieren. Damit wäre den Bedürfnissen und den
Verhältnissen der Regionen Rechnung getragen und der Ausgleich der
bisher in verschiedene Richtungen zielenden nationalen Raumordnungs-
politiken und die bessere Einbindung der verschiedenen Fachpolitiken
wäre auch möglich.
Allerdings dürfte hier mit erheblichem Widerstand der Nationalstaaten zu
rechnen sein, da diese ihre raumordnerische Kompetenzen auf EU und
Länder/Regionen verteilen müssten. Jedoch sind die Vorteile bei dieser
Verfahrensweise nicht zu unterschätzen: Strukturprobleme wären so auf
regionaler und supranationaler Ebene zu betrachten und zu lösen. Prob-
leme von Grenzregionen würden grenzüberschreitend angegangen, so
dass eine Gefällebildung vor/hinter der Grenze ausgeglichen würde und
es sogar zur Bildung regionaler Netzwerke (auch die nationalen Grenzen
überschreitend!) käme, die die neuen mit hoher Kompetenz ausgestatte-
ten Raumordnungsinstitution der EU-Raumordnungspolitik würden.
Damit würde dem Begriff vom „Europa der Regionen“ ein neues Gesicht
und eine neue Dimension verliehen. Der Bedeutung von Regionen auch
und gerade im grenzüberschreitenden Bereich würde Rechnung getragen
und die Kompetenz der Regionen würde genutzt. Eine EU-
Raumordnungspolitik, die sich als Hilfsmittel der Fördertöpfe der EU-
Regionalpolitik bedient, würde einer echten EU-Raumordnungspolitik wei-
chen. Hierzu wäre auch eine Diskussion über die Zukunft der EU-
Regionalförderung nötig, denn denkbar sind auch negative Effekte einer
solchen Neuausrichtung:
Wären die Regionen in direkter Verbindung mit der Europäischen Union
bezüglich der Umsetzung der Raumordnungspolitik, entstünde ein erheb-
licher Verwaltungs- und Koordinierungsbedarf auf EU-Ebene. Stattet man
die Regionen mit weitreichenden Kompetenzen aus und befasst sich le-
diglich mit dem Überbau der Raumordnungsppolitik (Leitbilder), so be-
steht die Gefahr, dass bei ungenügender Kontrolle der Umsetzung von
Maßnahmen der Raumordnung die Regionen zu selbständig agieren und
die gemeinschaftlich gesetzten Ziele nicht einhalten. Hier besteht für die
nächsten Jahre also erheblicher Diskussionsbedarf.
12Soll die Raumordnungspolitik der Nationalstaaten also vollständig in die
EU-Raumordnungspolitik integriert werden? Oder soll sie weiterhin als
Schwerpunktförderung erhalten bleiben?
Leider ist in allen Papieren zur Weiterführung der EU-Struktur- und Regi-
onalföderung nichts von der Integration in eine europaweit einheitliche
Raumordnungspolitik zu lesen, letztere findet keinerlei Erwähnung. Von
daher steht zu befürchten, dass die EU-Raumordnungspolitik auch in den
nächsten zehn Jahren ein schöner Gedanke bleibt, der sich an die zu-
nehmend schmaler werdenden Goldenen Zügel der Regionalpolitik fest-
hält, um die Regionen als Zugpferde der EU unter Kontrolle zu halten.
Wünschenswert wäre jedoch in Zukunft eine Klärung der Zuständigkeiten
von EU und Nationalstaaten, um Doppelinstanzen abzubauen, eine Ein-
heitlichkeit bei der Entwicklung des EU-Raumes zu erwirken und dabei
den Kompetenzen und Bedürfnissen der Regionen Rechnung zu tragen.
Vorerst wird die europäische Raumordnungspolitik genau so weiterge-
führt, wie sie bis dato durchgeführt wurde.
13Literaturverzeichnis
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (1991):
Zur geschichtlichen Entwicklung der Raumordnung, Landes- und
Regionalplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Hannover
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (1995):
Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover.
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.) (2000):
Raumordnungsbericht 2000, Band 7, Bonn.
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.) (2000): Infor-
mationen zur Raumentwicklung, Heft 3/4.2000, Bonn.
Eser, Thiemo W. (1998): Europäische Raumordnungspolitik – quo
vadis?, Bonn.
Dokumente aus dem Internet:
EUREK, Europäisches Raumentwicklungskonzept (1999), Potsdam
(Vollständiges PDF-Dokument)
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/
pdf/sum_de.pdf (Abruf am 02.06.05)
EUREK, Europäisches Raumentwicklungskonzept (1999), Potsdam
(Powerpoint-Präsentation)
http://www.bbr.bund.de/raumordnung/europa/download/eurek.ppt (Abruf
am 02.06.05)
Faludi, Andreas (2004): Wie Raumordnung zur Politik des territoria-
len Zusammenhalts wurde. (oO):
http://www.stb.tuwien.ac.at/lehre/down/Faludi/Europ_%2520Raumord3.pd
f
(Abruf am 02.06.05)
Fürst, Dietrich (1997): Auf dem Weg zu einer europäischen Raum-
ordnung und die Rolle der Regionen in Deutschland. (oO):
http://www.nsl.ethz.ch/index.php/en/content/download/222/1255/file/
(Abruf am 02.06.05)
Allgemeine Internetquellen:
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (oJ): Kurzinformation
Raumordnung.
http://www.bbr.bund.de/raumordnung/inf_raumo.htm (Abruf am 02.06.05)
14Sie können auch lesen