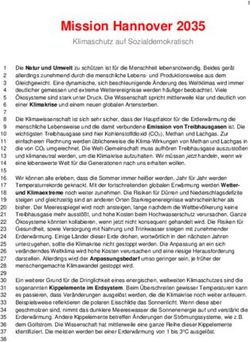VERKEHRSKONZEPT Stadtentwicklungsplan Wiener Neustadt - Endbericht Mai 2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stadtentwicklungsplan Wiener Neustadt VERKEHRSKONZEPT Grundsätze I Ziele I Schwerpunkte Endbericht Mai 2021
Stadtentwicklungsplan Wiener Neustadt 2030
Verkehrskonzept – Endbericht Mai 2021:
Grundsätze I Ziele I Schwerpunkte
Auftraggeber
Magistrat der Stadt Wiener Neustadt
Gruppe V/3, Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Energie
Neues Rathaus, Neuklosterplatz 1
2700 Wiener Neustadt
Auftragnehmer
ARGE Knollconsult – Rosinak & Partner ZT GmbH
KnollConsult
Obere Donaustraße 59
1020 Wien
Rosinak & Partner ZT GmbH
Schloßgasse 11
1050 Wien
Verfasser
in
Dipl.-Ing. Andrea Weninger
Dipl.-Ing. Dr. Werner Rosinak
Rosinak & Partner ZT GmbH
Wien, Mai 2021
Datei: 16703_VK_WienerNeustadt_Grundsaetze_Ziele_Schwerpunkte_Endbericht_2021601.docx
Foto Titelseite: istock
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 1Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .......................................................................................................................................... 3
2 Rückblick .......................................................................................................................................... 5
3 Verkehrspolitischer Rahmen ............................................................................................................ 6
3.1 Europäische Verkehrspolitik .................................................................................................. 6
3.2 Verkehrspolitik in Österreich .................................................................................................. 6
3.3 Niederösterreichische Verkehrspolitik ................................................................................... 7
3.4 Klimaschutz und Klimawandelanpassung ............................................................................. 8
4 Ausgangslage und Befunde ............................................................................................................. 9
4.1 Bevölkerung ........................................................................................................................... 9
4.2 Wirtschaft ............................................................................................................................... 9
4.3 Schulen und Ausbildung ...................................................................................................... 11
4.4 Mobilität ................................................................................................................................ 11
4.5 Strassenräume ..................................................................................................................... 15
4.6 Verkehrssicherheit ............................................................................................................... 16
4.7 Lärm und Luftgüte ................................................................................................................ 18
4.8 Aktive Mobilität ..................................................................................................................... 20
4.9 Kfz-Verkehr .......................................................................................................................... 23
4.10 Öffentlicher Verkehr ............................................................................................................. 26
5 Perspektiven................................................................................................................................... 29
6 Grundsätze und Ziele ..................................................................................................................... 30
7 Schwerpunkte................................................................................................................................. 32
7.1 Radverkehrsoffensive .......................................................................................................... 32
7.2 Qualität des öffentlichen Raumes ........................................................................................ 35
7.3 Qualität des öffentlichen Verkehrs ....................................................................................... 39
7.4 Smarte Mobilität ................................................................................................................... 42
7.5 Strassennetz ........................................................................................................................ 44
7.6 Parkraumstrategie ................................................................................................................ 45
8 Kontinuierliche Initiativen ............................................................................................................... 50
Quellenverzeichnis ................................................................................................................................. 51
Anhang ................................................................................................................................................... 53
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 21 EINLEITUNG
Wiener Neustadt wächst
Wiener Neustadt wächst und will eine attraktive und lebenswerte Stadt sein. Durch den Standort-
wechsel der Fachhochschule mitten ins Stadtzentrum, durch neue kulturelle Einrichtungen wie die
Kasematten sowie die innere Siedlungserweiterung auf dem ehemaligen Stadionareal, aber auch
durch die Ostumfahrung entstehen neue Spielräume für die Stadtentwicklung und die Verkehrspla-
nung. Diese Spielräume sind damit auch eine Chance für eine zukunftsweisende Mobilitätspolitik
der Stadt.
Stadtentwicklungsplan Wiener Neustadt 2030
Die Stadt Wiener Neustadt legt nunmehr einen Stadtentwicklungsplan 2030 vor, mit einer Neuori-
entierung der strategischen Stadtplanung. Dieser neue Stadtentwicklungsplan soll den Anforde-
rungen an ein räumliches Entwicklungskonzept laut § 13 Niederösterreichischem Raumordnungs-
konzept genügen, und darüber hinaus zukunftsweisende Impulse setzen. Das vorliegende Ver-
kehrskonzept ist mit seinen Grundsätzen, Zielen und Schwerpunkten ein Teil des Stadtentwick-
lungsplanes Wiener Neustadt.
Der Stadtentwicklungsplan und das Verkehrskonzept richten sich gleichermaßen an die Bevölke-
rung, die Politik und die Verwaltung. Das Verkehrskonzept ist handlungsorientiert und strategisch –
konzentriert sich auf wichtige Schwerpunkte, die besondere Anstrengungen erfordern und benennt
kontinuierliche Initiativen, die laufend erledigt werden sollen.
Durch die gleichzeitige Erarbeitung des räumlichen Leitbildes, des Verkehrs-, Freiraum- und Grün-
raumkonzeptes, der Strategie zur Vitalisierung strukturschwacher Gebiete und der Klimawan-
delanpassungsstrategie kommt den Schnittstellen und der Nutzung von Synergien besondere Be-
deutung zu.
Einbindung der Bevölkerung
Erfolgreiche Konzepte sind auf einen tragfähigen Konsens angewiesen, der eine intensive Kom-
munikation zwischen den beteiligten AkteurInnen, aber auch mit der Bevölkerung voraussetzt.
Dementsprechend wurde eine politische Lenkungsgruppe sowie ein operativer Arbeitskreis einge-
richtet, um gemeinsam Ziele, Schwerpunkte und Maßnahmen zu entwickeln. Von Anfang an wurde
die Bevölkerung in den Beratungsprozess eingebunden: Vom ersten Bürgerdialog im März 2018,
bei dem Ideen und Vorschläge der Bewohnerinnen und Bewohner gesammelt wurden, können für
das Thema Verkehr & Mobilität folgende Kernaussagen zusammengefasst werden:
» In Wiener Neustadt fehlt ein durchgängiges, sicheres Radwegenetz – ohne Lücken, mit attrak-
tiven Verbindungen zwischen Quell- und Zielorten. Die Attraktivierung der Ungargasse sowie
eine bessere und sichere Verbindung zur Civitas Nova werden häufig genannt.
» Im Zentrum von Wiener Neustadt sollen keine weiteren Garagen errichtet werden. Baulücken
sollen mit Wohnungen bebaut werden.
» Der öffentliche Verkehr in Wiener Neustadt soll durch verbesserte Takte und gute Umsteigebe-
ziehungen gestärkt werden.
» Die Erreichung der Klimaziele ist wichtig, das erfordert konkrete Maßnahmen in Wiener Neu-
stadt.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 3» Die Grazer Straße soll rasch verkehrsberuhigt werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten und
Verbesserungen für den Radverkehr.
» Der Hol- und Bringverkehr bei den Schulen soll gelöst werden. Es braucht bessere Fuß-und
Radwege zu den Schulen.
» Das Parken im Bereich des Bahnhofes von Wiener Neustadt wird als problematisch ange-
sehen. Hier braucht es eine Abstimmung der Projekte und Planungen.
Beim zweiten Stadtdialog am 7. November 2018 wurden die wesentlichen Ergebnisse des Stadt-
entwicklungsplanes und des Verkehrskonzeptes präsentiert und mit der Bevölkerung diskutiert.
Abbildung 1: Stadtdialog, November 2018
Foto: Rosinak & Partner
Darüber hinaus wurden Fragen zur Stadtentwicklung, zur Mobilität und speziell zum Radverkehr in
1
Fokusgruppen konkreter diskutiert, mit weiteren Anregungen für den Endbericht des Stadtentwick-
lungsplanes und des Verkehrskonzepts.
1
Fokusgruppen im Zuge des Stadtentwicklungsplanes in den Jahren 2018 und 2019
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 42 RÜCKBLICK
Das bisher gültige Verkehrskonzept stammt aus den 1990er Jahren und schuf die Grundlage für
die Neuordnung des Busverkehrs – mit neuen Linien, einem 30-Minuten-Takt, Priorisierungsmaß-
nahmen, wie der Busspur auf der Grazer Straße und für eine Erneuerung des Fuhrparks. Ausser-
dem wurde die Parkraumbewirtschaftung eingeführt und das Radroutennetz verdichtet. Die ver-
kehrspolitischen Prinzipien bezogen sich damals vor allem auf den motorisierten Individualverkehr:
Verkehr vermeiden – Verkehr verlagern – Verkehr verbessern.
Insgesamt hat Wiener Neustadt eine Vielzahl an Maßnahmen seit den 1990er Jahren umgesetzt.
Trotz dieser Maßnahmen hat sich das Verkehrsaufkommen, vor allem im Pkw-Verkehr und im Lie-
ferverkehr kontinuierlich erhöht. So fanden etwa kaum Verkehrsverlagerungen im Binnenverkehr
auf den sogenannten Umweltverbund (ÖV, Radfahren, Zu-Fuß-Gehen) statt. Neue, große Ein-
kaufszentren – teilweise am Stadtrand – und die Errichtung von Pkw-Stellplätzen und Garagen im
Zentrum begünstigten eine am Pkw orientierte Mobilität.
Aufgrund des Bevölkerungswachstums in Wiener Neustadt sowie neuer Trends und Herausforde-
rungen in der Mobilität bedarf das alte Verkehrskonzept nunmehr einer Überarbeitung. Auch das
gesellschaftspolitische Umfeld und die Werthaltungen der Bevölkerung haben sich gewandelt:
standen vor 20 Jahren noch Ausbaumaßnahmen für den Straßenverkehr im Vordergrund, ist nun-
mehr eine ganzheitlichere Sichtweise, ein Zusammenwirken aller Verkehrsarten Haltung und Auf-
gabe der Planung.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 53 VERKEHRSPOLITISCHER RAHMEN
3.1 EUROPÄISCHE VERKEHRSPOLITIK
Mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 gilt für Österreich das Gemeinschaftsrecht,
das heißt, Regelungen auf EU-Ebene haben Einfluss auch auf die Mobilität. Mit dem EU-Weißbuch
2
2011 hat sich die Kommission ambitionierte Ziele gesetzt, die auch auf lokaler Ebene umgesetzt
werden müssen. So sollen 60 % weniger verkehrsbedingte Emissionen bis 2050 erreicht werden.
Das bedeutet einen höheren Wegeanteil im öffentlichen Verkehr und bei aktiven Mobilitätsformen
wie dem Radfahren und dem Zu-Fuß-Gehen sowie der Einsatz emissionsärmerer Pkw und Liefer-
fahrzeuge. Erreicht werden soll dies vor allem durch eine Senkung des Anteils an Fahrzeugen mit
konventionellen Verbrennungsmotoren im Stadtverkehr um 50 % bis 2030 und einem vollkomme-
nen Verzicht auf derartige Fahrzeuge bis 2050.
Weiters relevant für Städte und Gemeinden sind die Senkung der Zahl der Unfalltoten im Straßen-
verkehr bis 2050 („Vision Zero“) und eine künftig umfassende Anwendung des Verursacherprinzips
bei der Kostentragung durch die NutzerInnen.
3.2 VERKEHRSPOLITIK IN ÖSTERREICH
1) Infrastruktur
Auf nationaler Ebene liegt seit 2012 ein Gesamtverkehrsplan vor, der Ziele und Leitlinien der öster-
reichischen Verkehrspolitik bis 2025 formuliert. Ein neuer österreichischer Mobilitätsmasterplan
2030 wurde im Regierungsprogramm 2020 – 2024 angekündigt. Für Wiener Neustadt ist vor allem
der viergleisige Ausbau der Südachsen zwischen Wiener Neustadt und Wien relevant. Mit einem
Schlüsselprojekt, dem Ausbau der Pottendorfer Linie, wurde bereits begonnen: Bis 2023 soll die
Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt durchgehend zweigleisig sein und
eine Verdichtung des Nahverkehrs auf der Südbahn ermöglichen. Damit kann eine Fahrzeit zwi-
schen den Knoten Wien und Wiener Neustadt von 30 Minuten ermöglicht werden – als Basis für
den integrierten Taktfahrplan.
2) Finanzierung
Im Schienenverkehr finanziert der Bund über 80 % des gemeinwirtschaftlichen Schienenangebotes
in Österreich – die ÖBB übernehmen im intermodalen Verkehr 50 % der Kosten für die Errichtung
von Park & Ride-Anlagen. Die restlichen 50 % der Kosten teilen sich das Land Niederösterreich
und die Gemeinden mit einem Schlüssel von 35 zu 15.
3) ÖV-Standards
Eine neue wesentliche Voraussetzung für den öffentlichen Verkehr sind die im Jahr 2014 gemein-
sam vom Bund und den Bundesländern festgelegten Standards im öffentlichen Verkehr. Je nach
Anzahl der EinwohnerInnen in einem so genannten Siedlungskern und dem Fahrziel in ein regiona-
les oder überregionales Zentrum bzw. zu einem ÖV-Knoten wird eine Mindestzahl von Kurspaaren
als Grundangebot vorgesehen. Erstmals wird in Österreich ein direkter Zusammenhang von Sied-
lungsdichte und Mobilitätsangebot hergestellt – mit einheitlichen Bedienungsstandards für alle
Bundesländer.
2
Generaldirektion für Mobilität und Verkehr, 2011
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 6Abbildung 2: Infrastrukturprojekte des Bundes – Niederösterreich, Rahmenplanprojekte 2018-2023
Quelle: BMK
3.3 NIEDERÖSTERREICHISCHE VERKEHRSPOLITIK
Das Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030+ (2015) enthält einen längerfristigen Handlungsrah-
men mit folgenden Schwerpunkten:
» Im öffentlichen Verkehr werden Angebots- und Nachfragestandards entwickelt, um für Nieder-
österreich attraktive, effiziente und finanzierbare Angebote zu schaffen.
» Die Verkehrssicherheit soll durch eine konsequente Verkehrssicherheitsarbeit mit differenzier-
ten Initiativen weiter erhöht werden.
» Das Verkehrssystem und die Siedlungsentwicklung sind abzustimmen.
» Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel, das im Alltagsverkehr immer wichtiger wird. Schnelle und
komfortable Radverbindungen sollen geschaffen werden.
» Ein Großteil der Straßen in Niederösterreich kommt in die Jahre und bedarf einer aufwändigen
Erhaltung. Die Straßenerhaltung ist daher zu sichern.
» Die Organisation im Verkehrssystem soll optimiert werden.
» Die E-Mobilität soll forciert werden.
Für Wiener Neustadt relevant sind insbesondere die Attraktivierung der Puchberger Bahn sowie
3
die Ostumfahrung Wiener Neustadt . Für die Verbesserung der Angebotsqualitäten im öffentlichen
Verkehr, für die Landesstraßen und die Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes sind das Land
und die Gemeinden zuständig. Aus Sicht des Landes leiten sich daraus für die nächsten Jahre
folgende Schwerpunkte ab:
» Taktverdichtungen auf den Bahnstrecken in den Stadtregionen,
» Modernisierung von Bahnhöfen als intermodale Schnittstellen,
» Park & Ride-Offensive,
3
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2017): Mobilitätspaket Niederösterreich 2018–2022
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 7» bedarfsorientierte Verkehrsangebote, die den öffentlichen Linienverkehr (Bahn & Bus) ergän-
zen,
» gemeindeübergreifende Radwegenetze auf Basis der Radlgrundnetze,
» Unterstützung von E-Mobilitätsprojekten und (E-)Carsharing.
Insgesamt zielen diese Schwerpunkte darauf ab, multimodales Verhalten bei den täglichen Wegen
der Bevölkerung in Niederösterreich zu unterstützen.
Das Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030+ enthält auch eine inhaltliche und finanzielle Mitwir-
kung des Landes bei Verkehrskonzepten der Städte, wie dies auch im Rahmen des vorliegenden
Verkehrskonzeptes für Wiener Neustadt der Fall ist.
3.4 KLIMASCHUTZ UND KLIMAWANDELANPASSUNG
Verkehrs- und Klimapolitik werden künftig verstärkt zu verschränken sein: Wiener Neustadt ist Kli-
ma- und Energiemodellregion und hat im Rahmen des Stadtentwicklungsplanes auch eine Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel erarbeitet. Aus diesen Konzepten leiten sich für das Maßnah-
menprogramm folgende Prioritäten ab:
» Ausbau des Hauptradroutennetzes und von Radabstellanlagen,
» Weiterentwicklung der Parkraumbewirtschaftung,
» neue Straßenraumtypologie – durchgrünt und mit einem stadtverträglichen Geschwindigkeits-
regime,
» Begegnungszonen, insbesondere innerhalb des Rings,
» Geringere Versiegelung von Verkehrsflächen.
Bei größeren Siedlungsentwicklungen sind Mobilitätskonzepte notwendig, die eine zukunftswei-
sende Mobilität und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung sicherstellen.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 84 AUSGANGSLAGE UND BEFUNDE
4.1 BEVÖLKERUNG
Wiener Neustadt ist die zweitgrößte Stadt Niederösterreichs. Seit dem Verkehrskonzept 1991 ist
4
die Bevölkerung von 35.000 auf über 45.000 EinwohnerInnen angewachsen . Laut ÖROK-
5
Prognose soll die Bevölkerung auf 50.000 bis zum Jahr 2030 zunehmen, was angesichts der At-
traktivität der Stadt und dem stetigen Zuzug von neuen BewohnerInnen noch übertroffen werden
könnte.
Die demografische Entwicklung bis 2030 ist von einer Zunahme älterer Menschen (65 Jahre und
6
älter) von derzeit 17 % auf mehr als 20 % geprägt, gleichzeitig bleibt der Anteil der jungen Bevöl-
kerung unter 20 Jahren konstant bei etwa 20 %. Die Bevölkerungsverteilung zeigt Schwerpunkte in
den Zählsprengeln Josefstadt-Mitte-West, Zehnerviertel-Südwest, Ungarviertel-West und Ungar-
viertel-Ost. Ziel der Stadt ist es, das Wohnen in der Innenstadt künftig attraktiver zu machen und
somit den Anteil der Bevölkerung im Stadtzentrum erhöhen.
4.2 WIRTSCHAFT
Im Jahr 2015 waren etwa 33.400 Personen in Wiener Neustadt beschäftigt – in über 4.000 Arbeits-
7 8
stätten . Von 2011 bis 2015 ist die Zahl der Beschäftigten um 2,9 % gestiegen. Zwei Drittel der
Beschäftigten kommen als PendlerInnen in die Stadt. Zu den größten Arbeitgebern in Wiener Neu-
stadt gehören u. a. Triumph, Diamond Aircraft, das Landeskrankenhaus und zahlreiche weitere
Betriebe in der Civitas Nova, wo Technik, Industrie und Wissenschaftsbetriebe angesiedelt sind.
Die Arbeitsplätze konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Innenstadt und auf das Industriege-
lände im Norden. Handelsbetriebe und große Einkaufszentren sind am Zehnergürtel und in der
Stadionstraße angesiedelt. Das Wachstum findet v.a. in den Sparten Gewerbe und Handwerk,
Information und Consulting sowie Transport und Verkehr statt. Wiener Neustadt wurde als High
Tech Standort bekannt, vor allem in den Bereichen Gesundheitstechnik, Bildung und Flugzeug-
technik. Etwa 20 % der Beschäftigten arbeiten in der Sparte Erziehung und Unterricht, was auf die
9
Bedeutung Wiener Neustadts als Bildungs- und Schulstadt hinweist.
Die größeren Einkaufs- und Handelsschwerpunkte konzentrieren sich neben den neu sanierten
und gestalteten Fußgängerzonen im Zentrum, in den Einkaufzentren Fischapark, Merkur-City und
im EKZ Nord.
Die Einbettung und Erreichbarkeit der Einkaufs- und Handelsstandorte ist sehr heterogen. Wäh-
rend die Geschäfte in der Innenstadt über die Fußgängerzone und verschiedene kostenpflichtige
Tiefgaragen erschlossen sind, stehen in den Einkaufszentren und Fachmärkten an den Rändern
der Stadt über 2.000 kostenfreie Stellplätze an der Oberfläche und in Garagen zur Verfügung.
4
Statistik Austria: Bevölkerung im Jahr 2019
5
ÖROK, 2014
6
Statistik Austria: Bevölkerung im Jahr 2019
7
Statistik Austria, abgestimmte Erwerbsstatistik 2011-2015
8
ebenda
9
Emrich Consulting ZT GmbH, 2014
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 9Abbildung 3: Pendlerbeziehungen für Wiener Neustadt, Ein-, Aus- und Binnenerwerbspendler 2017, gerundet
Quelle: Statistik Austria
Somit pendeln täglich etwa 20.500 Erwerbstätige nach Wr. Neustadt ein, und ca. 11.100 Erwerbs-
tätige aus – nach Wien und ins Burgenland, ins Umland bzw. in andere Bundesländer.
Abbildung 4: Handelsstandorte Fußgängerzone Wiener Neustadt und Stadionstraße
Fotos: VN24, Rosinak & Partner
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 104.3 SCHULEN UND AUSBILDUNG
Wiener Neustadt ist ein wichtiger Schulstandort für die Region, mit mehr als 12.000 SchülerInnen,
ergänzt von der Fachhochschule Wiener Neustadt mit über 30 Studiengängen und 2.700 Studie-
10
renden und der Militärakademie . Die höheren Schulen konzentrieren sich auf den Zentrumsbe-
reich der Stadt oder sind in Bahnhofsnähe angesiedelt. Ein Teil der Fachhochschule wurde im
Herbst 2019 als City Campus vom Industriegebiet im Norden ins Zentrum der Stadt umgesiedelt –
auf das ehemalige Areal des Karmeliterklosters. Seither haben mehr als 1.400 Studierende und
MitarbeiterInnen einen Standort in der Stadt und verleihen der Innenstadt einen neuen Impuls.
Etwa 3.000 bis 3.500 Wege werden von den Studierenden und MitarbeiterInnen des neuen FH-
Standortes in Wiener Neustadt zurückgelegt.
Abbildung 5: City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt
Foto: FH Wiener Neustadt
4.4 MOBILITÄT
Mobilität beschreibt die durch die täglichen Aktivitäten ausgelösten Wege und mit welchem Ver-
kehrsmittel sie zurückgelegt werden. Für eine verkehrspolitische Strategie ist die Kenntnis der Mo-
bilität wesentlich, nur so können Maßnahmen begründet werden. In Wiener Neustadt werden seit
vielen Jahren in regelmäßigen Abständen die BewohnerInnen über ihre Mobilität bzw. ihr Ver-
10
Wiener Neustadt, 2019
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 11kehrsverhalten befragt. Der Modal Split, also die Verteilung der Wege auf die einzelnen Verkehrs-
11
mittel ist dabei die wesentlichste Kennzahl. Die Mobilitätserhebung 2018 ergibt folgendes:
» Viele Wege mit dem Pkw
Der Großteil der Wege der Wiener NeustädterInnen wird mit dem Auto zurückgelegt: 59 % der
Wege sind Pkw-Wege, davon 10 % von MitfahrerInnen. Während der Anteil der Pkw-Wege in an-
deren Städten zumindest stagniert oder – wie in Wien – sinkt, stieg in Wiener Neustadt der Pkw-
Wegeanteil in den letzten 30 Jahren kontinuierlich an. Der Anteil der Fuß- und Radwege ist im
Vergleich zu anderen Städten eher gering und stabil, mit einem Rückgang von Wegen zu Fuß zu
Gunsten von Wegen mit dem Fahrrad. Der öffentliche Verkehr stagniert. Die ÖV-Wege werden
vorwiegend mit der Bahn zurückgelegt – vor allem für Wege von und nach Wien.
Im Vergleich mit anderen Städten fällt auf, dass bei den Wegezwecken der Wiener NeustädterIn-
nen die Einkaufs- und Erledigungswege mit 30 % dominieren, gefolgt vom Berufspendlerverkehr
mit 23 % und vom Freizeitverkehr mit 14 %.
Die Wiener NeustädterInnen sind an einem Werktag durchschnittlich 83 Minuten unterwegs, pro
Tag werden im Durchschnitt 50 Kilometer zurückgelegt.
Die hauptsächliche Nutzung des Autos als tägliches Verkehrsmittel spiegelt sich auch im Motorisie-
12
rungsgrad wieder. Von 1.000 EinwohnerInnen besitzen 568 einen Pkw , dieser Anteil liegt im Mit-
tel anderer Städte in Niederösterreich.
Abbildung 6: Verkehrsmittelwahl der Wiener NeustädterInnen
Quelle: ZIS-P, 2014; Herry Consult, 2019
9 12
13 13 14
11
11 10
12 12
Wegeanteile in %
42
43 49
46 46
13
13
12 10 14
25
20 17 18 15
1990 1996 2003 2013 2018
zu Fuß Fahrrad MIV-Lenker MIV-Mitfahrer ÖV
11
Herry Consult, Mobilitätserhebung Wiener Neustadt 2018
12
Statistik Austria, Kfz-Bestand und Motorisierungsgrade am 1.1.2019
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 12Abbildung 7: Wegezwecke der Wiener NeustädterInnen
Quelle: Herry Consult, 2019
Abbildung 8: Verkehrsmittelwahl (Modal Split): Niederösterreich gesamt, Industrieviertel und Wiener Neustadt
Quelle: Herry Consult 2019
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 13» Das Potenzial für aktive Mobilität
Das Potenzial für eine aktive Mobilität, also für das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren, ist in Wiener
Neustadt hoch, aber noch nicht ausgeschöpft. Die Stadt ist topografisch flach, und drei Viertel des
Stadtgebietes sind innerhalb von zehn Minuten mit dem Fahrrad erreichbar.
Deutlich zeigt sich, dass ein großer Teil der Auto-Fahrten, etwa ein Drittel, unter 3 km lang ist, die
Hälfte der Auto-Fahrten der Wiener NeustädterInnen sind unter 5 km lang. Dies sind Entfernungen,
die im Radverkehr sehr gut bewältigbar sind. Mehr als 15 % der Pkw-Wege sind überhaupt kürzer
als einen Kilometer, das entspricht einem Fußweg von etwa 5 bis 10 Minuten.
Abbildung 9: Kurze Wege werden mit dem Auto zurückgelegt
Quelle: ZIS-P, 2014; Kartengrundlage: basemap
» Mobilität im Vergleich
Für eine verkehrspolitische Strategie sind Vergleiche mit anderen Städten hilfreich, um Potenziale
zu erkennen. Zusammenfassend lässt sich über die Mobilität in Wiener Neustadt sagen, dass
» der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (Pkw-LenkerInnen und MitfahrerInnen) mit 59 %
vergleichsweise hoch ist; er ist geringfügig höher als in St. Pölten (56 %) und deutlich höher als
beispielsweise in Bregenz (42 %).
» Der Anteil Fußverkehrs ist vergleichsweise gering, gleichzeitig steigt der Radverkehrsanteil
kontinuierlich; Wiener Neustadt hätte allerdings aufgrund seiner Topografie und des beste-
henden dichten Radwegenetzes ein Potenzial von bis zu 20 % Radverkehrsanteil (St. Pölten
11 %, Bregenz 20 %, Innsbruck 23 %).
» Mehr als die Hälfte der Pkw-Wege ist kürzer als 3 km.
Im Übrigen werden Wege der Wien-PendlerInnen Großteils mit der Bahn zurückgelegt, der Anteil
im städtischen Busverkehr ist gering.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 144.5 STRASSENRÄUME
Der Hautplatz mit seinen Lauben, die Fußgängerzone in der Altstadt und der neue Marienmarkt mit
der offenen Platzgestaltung und der Mariensäule sind attraktive öffentliche Aufenthaltsräume. Den-
noch gibt es in der Innenstadt ungenutzte Geschäftslokale und unattraktive öffentliche Straßen-
räume: Das Ende der Fußgängerzone markiert in der Regel auch das Ende von Geschäftsnutzun-
gen im Erdgeschoß.
Abbildung 10: Hauptplatz mit Marienmarkt, Mariensäule und Lauben
Foto: Stadt Wiener Neustadt
Abbildung 11: Ungenutze Potenziale in der Lederergasse und Brodtischgasse
Fotos: Rosinak & Partner
Außerhalb des Zentrums gibt es damit nur wenige Straßen und Plätze, die für FußgängerInnen,
RadfahrerInnen und für Verweilende als Aufenthaltsräume oder als gestaltete Freiräume städtische
Qualität aufweisen. Markante städtebauliche Plätze und Orte in hoher Gestaltungsqualität finden
sich abseits des Hauptplatzes zum Beispiel in den idyllischen Gässchen in der Josefstadt. In den
peripheren Stadtteilen und auch in der Innenstadt haben Gehsteige und Radwege oftmals nur das
Mindestmaß, die Radwege und Radrouten weisen Lücken an wichtigen Stellen auf und bedürfen
teilweise einer Sanierung. Oftmals befinden sich Radwege auf Mischflächen gemeinsam mit Fuß-
gängerInnen, was für AlltagsradfahrerInnen wenig attraktiv ist.
Auffallend sind die vielen Grünflächen in den Straßenräumen, die sich zwischen den Richtungs-
fahrbahnen oder als Abstandsstreifen zwischen Gehsteig und Fahrbahn befinden. Allerdings ist die
Bepflanzung und die Gestaltung dieser Straßenräume eher gleichförmig – gemeinsam mit der Do-
minanz des Kfz-Verkehrs ergibt sich ein mancherorts unattraktives Umfeld zum Zu-Fuß-Gehen
oder Verweilen.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 15Abbildung 12: Verbesserungsbedarf im Straßenraum, Beispiel Pottendorfer Straße
Foto: Rosinak & Partner
4.6 VERKEHRSSICHERHEIT
In den Jahren 2016 bis 2018 gab es in Wiener Neustadt durchschnittlich etwa 240 Unfälle mit Per-
13
sonenschaden pro Jahr , seit 2012 konnte ein Rückgang von etwa 11 % verzeichnet werden. Et-
wa 2 bis 3 Personen pro Jahr verunfallen tödlich, cirka 30 Personen werden in Jahr schwer verletzt
und 280 Personen leicht verletzt.
14
In den Jahren 2016 bis 2018 gab es durchschnittlich 100 Unfälle mit Personenschaden in soge-
15
nannten Unfallhäufungsstellen auf Gemeinde- und Landesstraßen. Die Unfälle im Ortsgebiet
verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet von Wiener Neustadt. Eine Analyse der Unfallhäu-
fungsstellen durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit zeigt besondere Konzentrationen auf die
Hauptachsen des Kfz-Verkehrs, insbesondere entlang der Landestraße B17 Grazer Straße – be-
dingt durch das hohe Verkehrsaufkommen und den Verkehrsfluss im Stadtzentrum, sowie der B53
Neudörfler Straße und entlang des Babenberger- und Ferdinand-Porsche-Ringes. Die Hauptunfall-
ursachen sind neben zu hohen Kfz-Geschwindigkeiten Unachtsamkeit und Vorrangverletzungen.
Die Unfallhäufungsstellen werden von Seiten des Landes Niederösterreich und der Stadt Wiener
Neustadt kontinuierlich überprüft und saniert.
13
Kuratorium für Verkehrssicherheit, UPS Wiener Neustadt 2015-2019
14
Kuratorium für Verkehrssicherheit: Übersicht UHS Wiener Neustadt, Gemeinde- und Landesstraßen, 2016-2018
15
Unfallhäufungsstellen nach RVS 02-02.2. Ein Knoten oder eine Strecke bis zu einer Länge von 250 Meter ist eine Unfall-
häufungsstelle, wenn mindestens drei gleichartige Unfälle mit Personenschaden in drei Jahren passiert sind und der Rela-
tivkoeffizient bei 0,8 oder darüber liegt oder wenn sich mindestens fünf gleichartige Unfälle (einschließlich Unfälle mit Sach-
schaden) in einem Jahr ereignet haben. Der Relativkoeffizient berücksichtigt – einfach gesagt – auch die Verkehrsstärke auf
dem Straßenabschnitt.
Zu den Unfallarten (relevant für das Kriterium „Gleichartige Unfälle“) gehören zum Beispiel Fußgängerunfälle, Frontalkollisi-
onen oder rechtwinkelige Kollisionen etc.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 16Abbildung 13: Unfallhäufungsstellen in Wiener Neustadt für die Jahre 2016-2018 (Quelle: Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit, 2019
Eine Besonderheit im Wiener Neustadter Gemeindestraßennetz ist das Fehlen der Rechts-vor-
links-Regel in den Wohngebieten. Ein Großteil des untergeordneten Straßennetzes ist Tempo 30,
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 17allerdings sind aufgrund der fehlenden durchgängigen Rechts-vor-links-Regel zahlreiche Verkehrs-
schilder notwendig.
4.7 LÄRM UND LUFTGÜTE
4.7.1 Verkehrslärm
Verkehr ist der Lärmverursacher Nummer eins. Die Belastung durch Verkehrslärm führt zu Schlaf-
störungen und kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge haben. Seit vielen Jahren gibt es so-
16
genannte strategische Lärmkarten , die unter anderem für die Raumordnung und Stadtentwick-
lung herangezogen werden.
In Wiener Neustadt werden – wie in vergleichbaren Städten auch – die empfohlenen Grenzwerte
für Wohnnutzungen entlang der Hauptverkehrsstraßen und entlang der Bahn deutlich überschritten
– sie einzuhalten würde ganz erhebliche Verkehrsreduktionen erfordern. In Wohngebieten ist die
Verkehrslärmbelastung aufgrund von niedrigeren Verkehrsmengen und Tempo-Beschränkungen
geringer.
Abbildung 14: Lärmbelastung entlang von Autobahnen. Schnellstraßen, Landesstraßen B 2017, Wiener Neustadt,
Quelle: BMFLUW/lärminfo.at
Autobahnen und Schnellstraßen,
Landesstraßen B: 24 Stunden
Durchschnitt in 4 m Höhe, Über
Tag, Abend und Nacht gemittelt.
Für den Abend und die Nacht sind
Zuschläge enthalten. Berichtsjahr
2012.
16
Siehe auch www.laerminfo.at
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 18Abbildung 15: Lärmbelastung entlang von Eisenbahnen 2017, Wiener Neustadt
Quelle: BMFLUW/lärminfo.at
Schienenverkehr: 24 Stunden
Durchschnitt in 4 m Höhe, Über
Tag, Abend und Nacht gemittelt. Für
den Abend und die Nacht sind
Zuschläge enthalten. Berichtsjahr
2017.
4.7.2 Luftschadstoffe
Trotz des Rückgangs einzelner Luftschadstoffe in Österreich (Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid,
17,18
Schwermetalle wie Blei) in den letzten Jahrzehnten wirkt sich die Luftschadstoffbelastung in
Städten durch Stickoxide und Feinstaub nach wie vor schädlich auf die Gesundheit der Menschen
und auch auf Ökosysteme und die Vegetation aus. Insbesondere der fossil betriebene motorisierte
Verkehr ist zu einem großen Teil für die Schadstoffemissionen verantwortlich.
In Wiener Neustadt befindet sich nahe der Neuklosterwiese eine Messstelle für die Erfassung von
Luftschadstoffen. Die Belastung durch Stickstoffdioxid lag in den letzten Jahren unter dem Jahres-
mittel-Grenzwert, die Konzentrationen sind rückläufig. Auch der Jahresmittelwert bei Feinstaub von
19
40 μg/m³ wurde seit 2011 nicht überschritten. Bei Feinstaub gab es im Jahr 2019 drei Überschrei-
tungen des Tagesmittelwertes, erlaubt sind 25 Tage. Bei der Zahl der Überschreitungen der Ta-
gesmittelwerte ist in den letzten Jahren in Niederösterreich generell ein fallender Trend zu be-
obachten, so auch in Wiener Neustadt.
17
Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/luftschadstoffe/, 2020
18
Begründet wird dieser Rückgang mit dem Verbot von verbleitem Benzin in den 1990ern sowie durch Optimierungen in der
Industrie, im Bereich der Haushalte (Kleinverbraucher) durch Ersatz veralteter Heizungsanlagen, insbesondere Holzöfen.
19
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Luftgüte-Jahresberichte 2015-2019
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 194.8 AKTIVE MOBILITÄT
Als „aktive Mobilität“ bezeichnet man den Rad- und Fußverkehr.
4.8.1 Radverkehr
Der Radverkehrsanteil in Wiener Neustadt liegt bei 14 %, mit einer beachtlichen Steigerung von
2013 bis 2018. Das Radwegenetz ist dicht, fast alle relevanten Hauptverkehrsachsen sind mit
Radverkehrsanlagen ausgestattet. Die Topografie ist für das Radfahren sehr gut geeignet. Im Ver-
20
gleich zu anderen Städten in Österreich liegt der Radverkehrsanteil im Mittelfeld und hat ange-
sichts vieler kurzer Pkw-Wege noch großes Potenzial.
Beim Radwegenetz sind kaum Hierarchien erkennbar, einzelne Infrastruktur-Anlagen sind schmal,
damit zum Überholen kaum geeignet und subjektiv unsicher. Zudem weist das Netz größere Lü-
cken auf, wie beispielsweise bei der Grazer Straße, der Fischauer Gasse oder der Kollonitschgas-
se. Auch die Rad-Verbindungen ins nahe Umland von Wiener Neustadt (z.B. Weikersdorf) fehlen
zum Teil oder sind wenig attraktiv befahrbar. Dazu wurden Freizeiteinrichtungen wie das Hallenbad
vom Zentrum in den Norden der Stadt verlagert – die Radinfrastruktur wurde noch nicht angepasst.
Es fehlt außerdem an begleitenden Förderungen, an einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit
und insgesamt an Ressourcen für den Radverkehr.
Im Rahmen von Fokusgruppen wurden die Wiener NeustädterInnen im Herbst 2018 zum Radver-
kehr in der Stadt befragt (siehe Abbildung 18). Die BürgerInnen kritisieren das lückenhafte Netz,
vor allem die schlechte Erreichbarkeit der Arena Nova. Die bestehenden Fahrbahnoberflächen der
Radwege sollen saniert werden, breitere Radwege werden als notwendig erachtet. Am Bahnhof
sollen die Abstellanlagen diebstahlsicher ausgestattet werden, etwa durch eine verstärkte Polizei-
präsenz und Kameraüberwachung, oder durch die Einrichtung von Fahrradboxen mit elektronisch
gesichertem Zutritt. Auch den Radabstellanlagen in mehrgeschossigen Wohnsiedlungen sollte
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, damit Fahrräder leichter zugänglich sind und öfter ver-
wendet werden. Bei neuen Gebäuden soll konsequent auf den Bau nutzerfreundlicher und sicherer
Radabstellanlagen geachtet werden. Bestehende mehrgeschossige Wohnanlagen könnten – aus
Sicht der TeilnehmerInnen der Fokusgruppen – auch nachträglich etwa in Form eines Pilotprojekts
mit guten Radabstellanlagen ausgerüstet werden.
Einige der von der Bevölkerung genannten Schwachstellen wurden seit 2018 bereits saniert bzw.
wurden Ergänzungen im Radwegenetz eingeleitet.
20
St. Pölten 11 % (2012), Bregenz 19 % (2008), Korneuburg 16 % (2015)
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 20Abbildung 16: Beispiele für die heterogene Radverkehrsinfrastruktur Zehnergasse und Brunner Straße
Fotos: Rosinak & Partner
Abbildung 17: Beispiel für eine Schwachstelle im Fußverkehr, Unterführung Maria Theresien-Ring
Fotos: Rosinak & Partner
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 21Abbildung 18: Problemstellen aus Sicht der im Rahmen der Fokusgruppen befragten BürgerInnen
Quelle: Rosinak & Partner, Basemap
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 224.8.2 Fußverkehr
Der Fußverkehr hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Im Zentrum sind abseits der Fuß-
gängerzone überwiegend schmale Gehsteige vorhanden, auch in den Randbereichen der Stadt.
Trotz der Lage der Einkaufzentren nahe von Siedlungsgebieten ist die fußläufige Erschließung vor
allem qualitativ mangelhaft. Lange Wartezeiten an den Kreuzungen am Ring (Bahngasse, Kollo-
nitschgasse und Pöckgasse/Herrengasse), an Kreuzungen, die mit Druckknopfampeln ausgestattet
sind, machen etwa am Zehnergürtel die Einkaufswege zu Fuß beschwerlich. Siedlungstypologien
wie Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser erzeugen zudem keine einladenden Plätze oder
öffentliche Flächen.
Im Zentrum Wiener Neustadts selbst ist die Situation für FußgängerInnen sehr gut. Die Fußgän-
gerzonen mit ihrer neuen Gestaltung und der Hauptplatz laden zum Verweilen und zum Flanieren
ein. Die Nutzungsmischung – mit Handel, Gastronomie, Markt, Sitzgelegenheiten ohne Konsum-
zwang und Spielflächen – zieht Menschen unterschiedlichen Alters an und belebt die Innenstadt.
Die Sanierung und der Ausbau von Kulturstätten im Rahmen der Landesausstellung Niederöster-
reich 2019 lösten zudem Impulse im öffentlichen Raum aus.
4.9 KFZ-VERKEHR
Verkehrssituation
Die Stadt Wiener Neustadt ist mit dem Pkw und im Lieferverkehr sehr gut auf der Autobahn und
der Mattersburger Schnellstraße erreichbar. Die mit Abstand am stärksten befahrene Straße in
Wiener Neustadt ist die Südautobahn A2 mit über 80.000 Kfz am Tag, gefolgt von der B 17 Grazer
Straße mit über 26.000 Kfz im Stadtzentrum. Die radialen Straßen weisen unterschiedliche Ver-
kehrsmengen auf: die Neudörfler Straße befahren etwa 19.000 Kfz pro Tag, den Abschnitt Ungar-
gasse 10.000, die Pottendorfer Straße 15.000, die Fischauer Gasse 18.000, die Puchberger Stra-
ße 23.000 und die Neunkichner Straße 16.000 Kfz pro Werktag. Der Zehnergürtel weist etwa
22.000 Kfz pro Werktag auf, die Stadionstraße/Nestroystraße 10.000 bis 12.000 Kfz/Tag.
Generell ist das Fahren mit dem Pkw in Wiener Neustadt attraktiv, in den Spitzenstunden ist auf
der Ungargasse, in einzelnen Abschnitten der Grazer Straße und die Wiener Straße (Abschnitt
Nordspange bis Stadiongasse), die Stadiongasse – Schelmergasse – An der Hohen Brü-
cke/Nestroystraße allerdings zähflüssiger Verkehr zu beobachten.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 23Abbildung 19: Verkehrsmengen in Wiener Neustadt, Kfz pro 24 Stunden, Werktag
Quelle: ZIS-P, 2014, Karte: basemap
B17 geplante Ostumfahrung
Die geplante Ostumfahrung schließt an den Knoten bei der Pottendorfer Straße (B60) an, umfährt
die Warme Fischa und mündet bei der Neudörfler Straße (B53) im Südosten in die Schnellstraße
S4. Für die B17 Ostumfahrung ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Gange, die Beschwerden
wurden vom Bundesverwaltungsgericht im Februar 2021 in 2. Instanz abgewiesen. Der Be-
schwerdeführer wendete sich danach an den VfGH, derzeit (Mai 2021) liegt noch keine Entschei-
dung vor.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 24Bedingt durch das generelle Verkehrswachstum bleibt der Kfz-Verkehr auf der Grazer Straße laut
21
Verkehrsmodell bis 2030 trotz Umfahrung weitgehend wie im Bestand 2017. So kann zwar die
neue Ostumfahrung auf der Grazer Straße und auch auf der Stadionstraße/Nestroystraße den Kfz-
Verkehr reduzieren, durch den Anstieg des Verkehrs infolge des Bevölkerungswachstums in Wie-
ner Neustadt und in der Region wird diese Entlastung – ohne begleitende verkehrsorganisatorische
und verkehrstechnische Maßnahmen in Wiener Neustadt – jedoch großteils wieder kompensiert
(siehe Abbildung 20). Die im Verkehrsmodell berechneten durchschnittlichen täglichen Verkehrs-
mengen für 2030 enthalten allerdings keine verkehrlichen Maßnahmen innerhalb der Stadt. Mit
einer Verkehrsberuhigung der Grazer Straße sollten jedenfalls dauerhafte Reduktionen der Kfz-
Verkehrsmengen möglich sein – erst dann würde die Ostumfahrung ihre gesamte potenzielle Ent-
lastungswirkung entfalten. Auch Veränderungen der Verkehrsmittelwahl durch Maßnahmen für den
Umweltverbund werden im Verkehrsmodell nicht abgebildet.
Abbildung 20: Verkehrliche Wirkungen der Ostumfahrung auf relevanten Straßenabschnitten, Kfz / 24h, Werktag
Quelle: ZIS-P, 2014, eigene Darstellung
30.300
27.900
2013
26.100
2030 ohne Ostumfahrung
2030 mit Ostumfahrung 1)
1)
ohne Begleitmaßnahmen
11.600 Kfz/Tag
15.300
14.400
12.300
10.100
10.000
9.200
7.300
6.100
Nestroystraße Stadionstraße Grazer Straße Lichtenwörth
Hauptplatz
Kfz-Verkehr in den Wohngebieten
In fast allen Wohngebieten Wiener Neustadts bestehen Tempo-30-Zonen. Die tatsächlich gefahre-
nen Geschwindigkeiten sind aber oftmals auch in Wohnvierteln und im Schulumfeld höher als er-
22
laubt . In Wiener Neustadt gibt es zudem keine generelle geschwindigkeitsmindernde Regelung
an Kreuzungen durch die Rechts-vor-links-Regel. Zahlreiche Straßenräume sind so ausgestaltet,
dass geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen durch Verkehrstafeln angezeigt werden; gestalteri-
sche und verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Straßenrückbauten und Fahrbahnverschwenkun-
gen, wurden in mehreren Stadtteilen umgesetzt.
21
ZIS-P, 2014
22
Zudem liegt laut Messungen des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt die V85, das ist jene Geschwindigkeit, die von
85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird, deutlich über der verordneten Geschwindigkeit von 30km/h (Quelle: Stadt
Wiener Neustadt). Beispielhaft sei hier die Mießlgasse oder die Tulpengasse genannt.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 254.10 ÖFFENTLICHER VERKEHR
4.10.1 Angebot im Schienenpersonenverkehr
Durch die Lage an der Südbahn ist Wiener Neustadt an das hochrangige Schienennetz ange-
schlossen. Der Bahnhof liegt mitten in der Stadt und ist Ausgangspunkt der Eisenbahnstrecken
nach Puchberg am Schneeberg, nach Gutenstein und Mattersburg sowie der Pottendorfer Linie
nach Wien und liegt auch an der Aspangbahn – mit einem attraktiven Nah- und Fernverkehrsange-
23
bot. Der Bahnhof wird täglich von über 30.000 Fahrgästen frequentiert, auch von UmsteigerInnen
und PendlerInnen aus den Umlandgemeinden.
Mit dem Ausbau der Westbahn und dem neuen Wiener Hauptbahnhof wurde 2015 ein wichtiger
Schritt für den integrierten Taktfahrplan in der Ostregion gesetzt. Die Zugangebote wurden besser
verknüpft und aufeinander abgestimmt. An Werktagen gibt es zwischen 4:00 Uhr Früh und 23:40
Uhr bis zu sieben direkte Zugverbindungen (S-Bahn, R, REX, Railjet) pro Stunde in Richtung Wien,
einem der wichtigsten Arbeitsplatzzentren für Wiener Neustädter PendlerInnen. Die für Einpendle-
rInnen wichtige Verbindung Neunkirchen – Wiener Neustadt wird bis zu viermal stündlich bedient.
Der Bahnhof Wiener Neustadt hat als Taktknoten optimale Umsteigebeziehungen von S-Bahn und
Regionalzug auf den Fernverkehr, zur vollen und halben Stunde.
Mit dem Umbau des Bahnhofes Wiener Neustadt im Jahr 2005 ist auch die Erreichbarkeit des
Zehnerviertels durch eine Fußgängerunterführung – insbesondere für Fahrgäste, die die Park &
Ride-Anlage benützen – verbessert.
Weitere Eisenbahnhaltestellen in Wiener Neustadt sind Wiener Neustadt Nord, Wiener Neustadt
Anemonensee, Wiener Neustadt Civitas Nova (1 x stündlich an Werktagen Richtung Hauptbahn-
hof). Die Haltestellen Wiener Neustadt Nord und Civitas Nova sind für das Industrie- und Gewer-
begebiet relevant, weisen aber aufgrund des Zugangebotes und der vergleichsweise weiten Fuß-
wege nur geringe Ein- und Aussteigerzahlen auf.
Durch den zweigleisigen Ausbau der Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wiener Neu-
stadt können künftig die Kapazitäten im Südkorridor, der derzeit stark ausgelastet ist, erweitert
werden. Bis 2023 wird das Teilstück auf der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Wien
ausgebaut, der Abschnitt von Wiener Neustadt nach Wampersdorf ist bereits fertiggestellt.
4.10.2 Angebot im Busverkehr
Seit Juli 2020 gibt es in Wiener Neustadt ein neues Busliniensystem für die Stadt und die Umland-
gemeinden. Das Busliniennetz in Wiener Neustadt umfasst elf städtische Buslinien, die sich zum
Stadtzentrum orientieren und von den Wiener Neustädter Stadtwerken betrieben werden. Die Li-
nien verlaufen radial – mit einem von den meisten Linien befahrenen Ring im Zentrum. Die Busli-
nien verkehren innerstädtisch im 30-Minuten-Takt und in die Umlandgemeinden im Stundentakt.
Die Betriebszeit reicht von ca. 5.00 Uhr bis 20:00 Uhr. Außerhalb dieser Betriebszeit und an Sonn-
und Feiertagen ergänzt der City Shuttle, ein Anrufsammeltaxi, das ÖV-Angebot, und zwar bis 2:00
Uhr früh.
23
ÖBB Infrastruktur AG, 2017
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 26Abbildung 21: Städtisches Busliniennetz 2020
Quelle: WNSKS
Ausgelöst durch das neue Stadtbuskonzept 2020 wurde auch das Busnetz im Regionalverkehr
durch den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) angepasst. Die Anbindung der Umlandgemeinden
von Wiener Neustadt erfolgt durch Regionalbusse des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR) sowie
– in einem Radius von mehr als 8 km – auch der Wiener Neustädter Verkehrsbetriebe zum Beispiel
Lichtenwörth, Wöllersdorf, Bad Fischau, Winzendorf oder Katzelsdorf. Die Regionalbusse fahren
den Hauptbahnhof von Wiener Neustadt an.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 27Abbildung 22: Netzplan öffentlicher Verkehr in der Region Wiener Neustadt
(Quelle: VOR, Stand 31.8.2020)
Etwa 12% der Wege der Wiener NeustädterInnen werden mit dem öffentlichen Verkehr zurückge-
legt. Eine besondere Herausforderung ist die Verspätungsanfälligkeit der städtischen Busse und
die Umwegfahrten durch die Führung rund um das Zentrum entlang des Rings. Für Fahrgäste sind
vor allem Verspätungen problematisch, die die Anschlusssicherheit am Bahnhof gefährden.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 285 PERSPEKTIVEN
Die Mobilität befindet sich im Wandel. Insbesondere in Städten ist in Europa ein Trend zum Rad-
fahren und zum öffentlichen Verkehr festzustellen, gleichzeitig schreitet die technologische Ent-
wicklung rasch voran:
» Immer mehr Menschen – insbesondere Jüngere – sind multimodal unterwegs: Verkehrsmittel
werden situativ genutzt, die Wahl des Pkw als einziges Hauptverkehrsmittel geht zurück. Der
generelle Trend geht in Richtung Nutzung von Mobilitätsservices, die durch neue Technologien
immer einfacher werden. Dazu kommt, dass viele jüngere Menschen sich einen eigenen Pkw
nicht mehr leisten können oder wollen.
» Auch das Fahrrad wird als wichtiger Baustein der Mobilitätskette von der Bevölkerung immer
mehr genutzt und spielt als schnelles, gesundes Verkehrsmittel eine wichtige Rolle.
» Angesichts der Vorgaben aus dem Klimaschutz und nationaler Gesetze und EU-Richtlinien bei
Lärm und Luftschadstoffen sind künftig verbindliche Aktionspläne erforderlich, die auch das er-
hebliche Energieeinsparungspotenzial im Verkehr nutzen. Die Anpassung an den Klimawandel
wird als kontinuierliche und längerfristige Aufgabe besondere Anstrengungen und Ressourcen
erfordern, etwa um Straßen „klimafitt“ zu machen.
» Trends bei der Straßenraumgestaltung, die neue Prioritäten im Straßenverkehr schaffen, sind
mittlerweile auch im Gesetz verankert, z.B. durch die Schaffung von Begegnungszonen. Damit
wird es möglich, den Straßenraum ausgewogen zu verteilen und der Aufenthaltsfunktion höhe-
re Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders wichtig wird dies, da sich der Handel durch Effek-
te von außen (Online-Einkauf, Konzentration an der Peripherie) weiter aus den Städten zu-
rückzieht.
Auch wenn einige dieser Trends in Wiener Neustadt zur Zeit noch nicht angekommen sind, wurden
durch die Umgestaltung des Hauptplatzes, die Sanierung der Fußgängerzonen, ein neues Fuß-
gängerleitsystem, die Neuorientierung bei den Kulturstätten und durch den Standort der Fachhoch-
schule im Zentrum zukunftsweisende Impulse für die Stadtentwicklung gesetzt. Die Realisierung
der Ostumfahrung ermöglicht es der Stadt, die Verkehrsentlastung des Zentrums entsprechend
dieser Trends voranzutreiben.
Schließlich kann erwartet werden, dass sich durch die Corona-Pandemie 2020 auch Veränderun-
gen bei der täglichen Mobilität verankern werden – etwa durch eine starke Zunahme im Radver-
kehr.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 296 GRUNDSÄTZE UND ZIELE
Im Sinne einer strategischen Orientierung – einer Konzentration der Kräfte, der Würdigung imma-
nenter Unsicherheiten, aber auch einer Nutzung von Handlungsfenstern – werden Grundsätze &
Ziele mit daraus abgeleiteten (Handlungs-) Schwerpunkten formuliert.
Abbildung 23: Grundsätze und Ziele
Grundsätze Ziele
Abstimmung von Stadtentwicklung und Mehr Wege im Umweltverbund
Verkehrsplanung (ÖV, Fuß, Rad)
Förderung innovativer
Neue Qualitäten im öffentlichen Raum
Mobilitätslösungen und -angebote
Aktive Beteiligung von Bevölkerung und Laufende Optimierung des ÖV-
Wirtschaft auf dem Weg zu einer nach- Angebots
haltigen Mobilität
Klimawandel und
Förderung des Rad- und Fußverkehrs
Resilienz beachten
Grundsätze sind dauerhafte Haltungen und Prinzipien, die Handlungen der Verkehrspolitik und
Verkehrsplanung prägen – wie etwa die Einbeziehung der Bevölkerung in Fragen der Mobilität und
des Verkehrs.
Ziele geben die Richtung erwünschter Veränderungen an und dienen – wenn sie quantifiziert wer-
den – der laufenden Kontrolle, ob die getroffenen Maßnahmen die beabsichtigten Wirkungen ent-
falten. Die Wegewahl an einem Werktag, der Modal Split ist eine derartige Kontrollgröße.
Auf der Handlungsebene werden aus den Zielen abgeleitete Schwerpunkte und kontinuierliche
Initiativen definiert. Schwerpunkte werden in Zukunft besondere Ressourcen und geeignete Vor-
gangsweisen erfordern. Beispielsweise ist die Neuformulierung öffentlicher Räume und Plätze eine
interdisziplinäre Aufgabe, ebenso wie es Mobilitätslösungen für neue Stadtteile oder Anreize zur
Multimodalität sind. Zu den kontinuierlichen Initiativen gehört etwa eine laufende Verbesserung der
Verkehrssicherheit.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 30Abbildung 24: Mehr Wege im Umweltverbund
Quelle: eigene Darstellung
Wege der Wiener NeustädterInnen an
einem Werktag in Prozent
≤50
59
≥50
41
2018 Ziel 2030+
Umweltverbund: zu Fuß, Fahrrad, ÖV Pkw
Neben den qualitativen Grundsätzen und Zielen sind messbare Kenngrößen in der Mobilitätspolitik
unerlässlich. Eine der wesentlichen Kenngrößen ist der Modal Split, also die Verkehrsmittelwahl
der Wiener Neustädter Bevölkerung. Angesichts der verkehrspolitischen Zielsetzungen und der
weiteren Stadtentwicklung soll der Radverkehrsanteil an den Wegen der Wiener NeustädterInnen
von derzeit 14 % bis 2030+ deutlich erhöht werden. Die Stadtstruktur, die Topografie und die ins-
gesamt guten Voraussetzungen sollten Radverkehrsanteile bis zu 20 % und Anteile im öffentlichen
Verkehr von über 15 % ermöglichen. Eine besondere Aufgabe ist, den Fußverkehr entgegen den
bisherigen Trends auf seinem derzeitigen Niveau zu halten. Insgesamt soll jedenfalls der Anteil des
Umweltverbundes (also öffentlicher Verkehr, Radverkehr und Zu-Fuß-Gehen) mittelfristig auf min-
destens 50 % erhöht werden.
Verkehrskonzept Wiener Neustadt I S. 31Sie können auch lesen