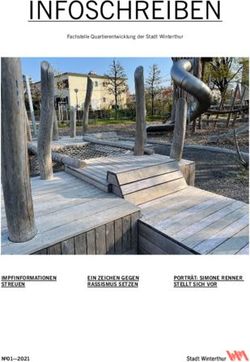Wird die Malaria wieder eine Gefahr für Europa?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
3. Aktuelle und potenzielle Gefahren für die Gesundheit
3.2.2 Wird die Malaria wieder eine Gefahr für Europa?
Helge Kampen
Wird die Malaria wieder eine Gefahr für Europa? Anopheles-Arten, die die früheren Überträger von
Malariaerregern repräsentieren, sind nach wie vor weit verbreitet in Europa. Ihr Vorkommen wird im We-
sentlichen durch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Verfügbarkeit von Blutwirten und geeig-
neten Brutplätzen bestimmt. Mit der Klimaerwärmung, die die Entwicklung der Malariaparasiten in den
Mücken beschleunigen könnte, steigt die Furcht, dass es zu neuen Fällen autochthoner Malaria oder so-
gar zu Malariaepidemien kommen könnte, wenn sich einheimische potenzielle Vektoren während der Blut-
aufnahme an Parasiten-tragenden Tropenreisenden infizieren würden. In nördlicheren Regionen Europas
wird außerdem befürchtet, dass effizientere Überträger aus dem Süden einwandern könnten. Unter den
aktuellen Bedingungen der medizinischen Versorgung und des Gesundheitssystems ist jedoch die Wahr-
scheinlichkeit einer Neuetablierung endemischer Malaria in Europa als vernachlässigbar einzuschät-
zen. Im Gegensatz dazu muss mit steigenden Temperaturen und angesichts des weiter zunehmenden Mas-
sentourismus in endemische Länder mit einem Anstieg individueller autochthoner Malariafälle gerechnet
werden, da Infektionsquellen für einheimische Anopheles-Mücken stetig nach Europa gebracht werden.
Will malaria become a threat to Europe again? Anopheles mosquito species representing former malaria
vectors are still widely distributed across much of Europe, their occurrence being mainly determined by tem-
perature, humidity and availability of blood hosts and suitable breeding sites. As the climate becomes warmer
and might accelerate the development of malaria parasites in the mosquitoes, fear is rising that the indigenous
potential vectors may produce new cases of autochthonous malaria or even malaria epidemics after feeding on
the blood of travellers infected with the parasites. In more northern regions of Europe there is additional con-
cern that more efficient malaria vectors will invade from the south. However, given the present medical care and
public health system, the probability of endemic malaria becoming re-established in Europe is considered neg-
ligible. In contrast, an increase in numbers of individual autochthonous malaria cases must be assumed under
a scenario of rising temperatures considering the ever-growing mass tourism to and from endemic countries
resulting in the permanent introduction into Europe of infection sources for indigenous Anopheles mosquitoes.
Malaria in Europa früher und heute ren. Von den heute fünf bekannten humanpathogenen
Obwohl die Malaria heute i.W. in den Tropen und Plasmodien-Arten kamen drei in Europa vor. Plasmo-
Subtropen vorkommt, ist sie keineswegs eine reine dium vivax, ein Erreger der Malaria tertiana, war am
Tropenkrankheit. Zweifellos sind die Bedingungen für weitesten verbreitet, weniger häufig trat der Erreger der
eine endemische Übertragung in tropischen Regionen Malaria quartana, P. malariae, auf. Am seltensten war
besonders günstig, da das feuchtwarme Klima oft hohe P. falciparum, der Verursacher der, falls unbehandelt,
Populationsdichten von potenziellen Überträgern her- oft tödlich verlaufenden Malaria tropica.
vorbringt und die relativ stabilen hohen Temperaturen Auch wenn der komplette Malariazyklus erst
eine schnelle Entwicklung der Malariaerreger in den Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeklärt wurde, so er-
Mücken erlaubt. Dazu kommen gewöhnlich allgemein kannte man bereits früh den Zusammenhang zwischen
schlechte sozioökonomische Verhältnisse und eine Feuchtgebieten und Krankheitsfällen (Lancisi 1717)
mangelhafte medizinisch-hygienische Infrastruktur. (Abb. 3.2.2-1), sah allerdings lange in der schlechten
Mückenkontrollprogramme werden aus verschiedenen Luft (»mala aria«), die aus den Sümpfen kam, die Ursa-
Gründen nicht konsequent und flächendeckend durch- che (s. Corradetti 1987). Primär um für die unter den
geführt, und eine medikamentöse Behandlung der sich langsam verbessernden sozioökonomischen und
Malariapatienten ist oft nicht gegeben, so dass sie als hygienischen Bedingungen wachsende Bevölkerung
Infektionsquellen für weitere Mücken dienen. Die Ge- Acker- und Weideland zu gewinnen, begann man im 18.
schichte der Malaria in Europa zeigt, dass nicht nur das Jahrhundert mit der großflächigen Trockenlegung von
Klima, sondern auch letztgenannte Faktoren die Mala- Feuchtgebieten, wie Sümpfen, Moorgebieten, Burg-
riaepidemiologie entscheidend beeinflussen können. gräben etc. Ebenso stand eine enorme Intensivierung
Die Malaria war noch bis ins 19. Jahrhundert der Viehwirtschaft mit einer deutlichen Vermehrung
in Europa weit verbreitet. Sogar Skandinavien und der Rinderpopulationen bevor. In den folgenden Jahr-
Großbritannien waren betroffen (Bruce-chwatt & De zehnten ging die Malariainzidenz im gesamten Europa
Zulueta 1980). In Deutschland waren Endemiegebiete kontinuierlich zurück, da erstens weniger Brutgewässer
insbesondere in der nördlichen Tiefebene (Marschen) für die Anopheles-Mücken zur Verfügung standen und
zu finden, wo viele Mückenbrutgebiete vorhanden wa- zweitens die Mücken vermehrt durch das Vieh vom
3.2.2 H. Kampen
Menschen abgelenkt wurden (Schuberg 1927, Maier rierter Malariainfektionen, die auf eingeschleppte
2004). Erst die Kriegsereignisse des zweiten Welt- infizierte Anopheles-Mücken zurückzuführen waren
krieges unterbrachen diese Entwicklung und begüns- (»Airport-Malaria« oder »Baggage-Malaria«; Isaäc-
tigten die Wiederausbreitung der Malaria in Europa. son 1989), wurden nach der Erklärung der WHO von
Truppenbewegungen und Flüchtlingsströme sorgten 1974 tatsächlich lange keine autochthonen Malariafälle
für einen Zustrom infizierter Personen vor allem aus mehr in Europa registriert. Der enorm angestiegene in-
dem Südosten Europas nach Mitteleuropa. Gleichzeitig ternationale Reiseverkehr zwischen Europa und aktu-
wurden den Anopheles-Mücken zahlreiche Brutmög- ellen Malaria-Endemiegebieten, z.B. in Afrika, führte
lichkeiten durch Bombentrichter und andere kriegs- allerdings zu einer Zunahme an importierter Malaria in
bedingte Landschaftsveränderungen geboten. Auch Europa insgesamt. In Deutschland blieb die Anzahl der
die Verminderung des Viehbestandes dürfte eine Rolle jährlich registrierten Fälle von Reisemalaria seit 2005
gespielt haben, weil primär zoophile Mücken, die sonst relativ konstant und schwankte um etwa 600 pro Jahr
nur am Tier saugen, jetzt auch am Menschen ihr Blut- (RKI 2013). Patienten mit den entsprechenden Ent-
mahl nahmen (Eichenlaub 1979). Die Entwicklung wicklungsstadien der Malariaerreger (Gametozyten)
von synthetischen Chemotherapeutika mit effizienten im Blut können als Infektionsquelle für einheimische
Wirkstoffen (z.B. Mepacrin und Chloroquin) zur The- vektorkompetente Anopheles-Mücken dienen.
rapie der Infektion und von Insektiziden (insbesondere Tatsächlich kam es zu solchen Übertragungen
DDT) zur Vektorkontrolle, die noch zu Kriegszeiten durch einheimische Anopheles-Mücken in den letzten
stattfand, leitete die Eliminierung der Malaria in Euro ca. 20 Jahren verschiedentlich in Europa. So erkrank-
pa ein. Nach dem zweiten Weltkrieg führten umfang- ten in Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland
reiche und langfristige Vektorkontrollprogramme in einzelne Personen an Malaria, für die alternative Ri-
den südeuropäischen Ländern zur Unterbrechung der sikofaktoren (Reiseanamnese, Flughafen in der Nähe
Infektionskette, so dass in den 1950/60er Jahren in den des Wohnortes, Bluttransfusionen oder gemeinsame
meisten europäischen Ländern die Malaria verschwun- Benutzung von Spritzen) ausgeschlossen werden konn-
den war. In Deutschland traten die zunächst letzten ten (Kampen 2005). In Deutschland wurden im gleichen
autochthonen Malariafälle 1953 im Berliner Raum in Zeitraum mindestens drei solcher Fälle registriert, die
Form einer kleinen Epidemie auf. Aus der Kriegsge- mit P. falciparum assoziiert waren: Im warmen Som-
fangenschaft zurückgekehrte Soldaten trugen offenbar mer 1997 traten in einem Duisburger Krankenhaus,
Malariaerreger im Blut, mit denen sich einheimische in dem ein Malariapatient stationär behandelt worden
vektorkompetente Anopheles-Mücken infizieren konn- war, zwei autochthone Infektionen auf, deren Übertra-
ten (Eichenlaub 1979). Nach dem letzten offiziellen gung auf einheimische Anopheles plumbeus-Mücken
autochthonen Malariafall, der noch Anfang der 1970er zurückgeführt wurde (Krüger et al. 2001). In Berlin
Jahre im griechischen Teil Makedoniens diagnostiziert wurde 2007 ein Fall dokumentiert (Zoller et al. 2009).
worden war, erklärte die WHO 1974 Europa malaria- Kleinere Malaria-Epidemien gab es 1995 in Bulgarien
frei (Bruce-chwatt & De Zulueta 1980). nach der Einreise von Saisonarbeitern aus Endemiege-
Mit Ausnahme einiger besonderer lokal akqui- bieten (Nikolaeva 1996) und seit 2010 jährlich in La-
Abb. 3.2.2-1: Künstlich ange-
legtes Regenrückhaltebecken bei
Frohngau (Eifel), das in der Ver-
gangenheit mehrmals zur som-
merlichen Massenentwicklung
von Mücken führte.
3. Aktuelle und potenzielle Gefahren für die Gesundheit
konien (Griechenland), die ebenfalls auf Gastarbeiterriaerreger. Viele Arten sind für Plasmodien aus gene-
zurückgeführt werden (Danis et al. 2013) tisch-physiologischen Gründen prinzipiell nicht emp-
Malariafreiheit galt niemals für die Türkei, die fänglich, bei anderen verhindern Verhaltensweisen, wie
geografisch zwar nur zu einem kleinen Teil zu Euro- z.B. die Wirtspräferenz, eine Vektorfunktion.
pa gehört, doch komplett zur »WHO-Region Europa« Eine Auflistung zum Vorkommen und zur Verbrei-
gerechnet wird. Auch in der Türkei wurden nach dem tung europäischer Malariaüberträger zu geben, ist aus
Zweiten Weltkrieg Vektorkontrollprogramme ins Le- mehreren Gründen eine heikle Aufgabe. Zunächst ge-
hören einige der europäischen Anopheles-Arten zu so
ben gerufen, die bis in die 1950er Jahre zur Eradikation
der Malaria im europäischen Landesteil und bis zu dengenannten Artenkomplexen, deren Arten (Zwillingsar-
1970er Jahren zu einem starken Rückgang der Malaria ten) morphologisch nicht oder nur an feinsten Merkma-
inzidenz in den südwestlichen asiatischen Teilen des len in bestimmten Entwicklungsstadien unterschieden
Landes führten. Inkonsequenzen bei der Durchführung werden können (Kampen 2005). Die Existenz von Zwil-
der Kontrollprogramme oder gar deren Einstellung, lingsarten wurde in den 1920er Jahren erkannt, so dass
gekoppelt mit einer Verschlechterung der sozioökono- erst in den darauf folgenden Jahren der A. maculipen-
mischen und hygienischen Verhältnisse, ließen bis in nis- und der A. claviger-Komplex in seine Zwillings-
die 1990er Jahre eine erneute drastische Ausbreitung arten differenziert werden konnten. Beide Komplexe
der Malaria in Südostanatolien zu. Erst die Aufnahme stellen einen maßgeblichen Anteil an den europäischen
Anopheles-Arten. Im A. maculipennis-Komplex ist bis
von integrierten Kontrollstrategien konnte die Malaria
nach und nach wieder zurückdrängen, so dass im Jahr heute strittig, wie viele Arten zum paläarktischen Teil
2006 nur noch knapp 1.000 Fälle zu verzeichnen wa- des Komplexes gehören, da einige »Arten« von vielen
ren, die ausschließlich auf P. vivax zurückgingen (Al-
Autoren lediglich als geografische Varianten anderer
ten et al. 2007). Arten des Komplexes betrachtet werden. Bezüglich der
Auch einige Nachfolgestaaten der ehemaligen Sow- Zwillingsarten des A. claviger-Komplexes bezieht die
jetunion gehören zur »WHO-Region Europa«, so v.a. Fachliteratur häufig nicht explizit Stellung, von wel-
Tadschikistan, Aserbaidschan und Armenien, in denen cher Zwillingsart die Rede ist, so dass letztendlich nicht
eine ähnliche Situation gegeben war/ist wie im südöst-
klar ist, ob die Autoren überhaupt eine Differenzierung
lichen Teil der Türkei. War die Malaria zu Zeiten dervorgenommen haben.
UdSSR noch weitgehend unter Kontrolle gebracht wor- Die Kompetenz eines Blut saugenden Arthropoden
den, so sorgten die politischen Instabilitäten nach Auf-
zur Übertragung eines Pathogens ist das Resultat von
lösung der Staatengemeinschaft und die vielfach damitAnpassung und Selektion und hat sich im Laufe der
verbundene Vernachlässigung der öffentlichen Gesund- gemeinsamen Evolution von Überträger und Parasit
heitsfürsorge zu einer allgemeinen Wiederausbreitung herausgebildet. So sind Anopheles-Arten, die vektor-
der Malaria. Auch hier nahmen im Laufe der 1990er Jah-
kompetent für die früher in Europa weit verbreiteten
re die Fälle von P. vivax-, aber auch P. falciparum-Infek-
Plasmodienstämme waren, häufig nicht geeignet als
tionen wieder drastisch zu (WHO 2004). Von insgesamt Überträger tropischer Erregerstämme (Shute 1940, De
acht östlichen Ländern der »WHO-Region Europa«, in Zulueta et al. 1975, Ramsdale & Coluzzi 1975, Dash-
denen die Malaria im Jahr 2000 noch weit verbreitet war,
kova 1977). Da die einheimischen Erregerstämme mit
konnten mittlerweile fünf die Krankheit eliminieren. Lo-
der europäischen Malaria weitgehend ausgerottet wur-
kale Übertragung wurde 2012 nur noch in der Türkei, den, ist das heutige Risiko einer Übertragung von Plas-
Tadschikistan und Aserbaidschan verzeichnet (WHO modien in Europa selbst durch effiziente frühere Vek-
2013). Diese und weitere nicht malariafreie vorderasia-
toren schwer einzuschätzen. Dass sie zumindest durch
A. plumbeus prinzipiell möglich ist, legen Versuche von
tische Länder sind infektionsepidemiologisch für das ge-
ografische Europa allerdings von besonderer Bedeutung.
Marchant et al. (1998) und Eling et al. (2003) nahe.
Aufgrund der relativen Nähe und der hohen westwärts Ausgerechnet für diese Stechmücken-Spezies werden
gerichteten Migrationsrate ursprünglich dort beheimate-
in den letzten Jahren starke Belästigungen in den Som-
ter Personen besteht ein hohes Risiko der Einbringungmermonaten gemeldet. Ursprünglich ein Baumhöh-
von Gametozytenträgern nach West- und Mitteleuropa. lenbrüter, der aufgrund der eingeschränkten Brutmög-
lichkeiten nur sporadisch vorkam, nutzt A. plumbeus
Verbreitung von neuerdings mehr und mehr aufgelassene Güllegruben
Malariavektoren in Europa und ähnliche menschengemachte Wasserspeicher mit
Die Vektoren der humanen Malaria sind weibliche hoher organischer Belastung zur Massenvermehrung
Stechmücken (Fam. Culicidae) der Gattung Anopheles. (Schaffner et al. 2012).
Doch nicht alle Anopheles-Arten übertragen die Mala- Generell ist festzustellen, dass die Anopheles-For-
3.2.2 H. Kampen
schung, insbesondere die freilandökologische, in vielen Hier sind jedoch alte wie neue Artnachweise gleicher-
Ländern Europas seit dem Verschwinden der Malaria maßen berücksichtigt, so dass nicht in jedem Fall auf
extrem vernachlässigt wurde, so dass aktuelle Daten die aktuelle Verbreitung der Mücken zurückgeschlossen
zum Vorkommen und zur Verbreitung potenzieller Vek- werden darf. Den wenigen stichprobenartigen neueren
toren nur fragmentarisch existieren. Studien zufolge muss man immerhin davon ausgehen,
Neuere Zusammenstellungen (z.B. Becker et al. dass die früheren Malariavektoren auch heute noch in
2010) listen für Europa 19 Anopheles-Arten auf, wo- Europa präsent sind, wenngleich sich in manchen Re-
bei sie die fraglichen Taxa des A. maculipennis-Kom- gionen die Artenzusammensetzungen und Dominanz-
plexes als distinkte Arten betrachten (Tab. 3.2.3-1). verhältnisse infolge von Klima- und Umweltverände-
Die wichtigsten, weil am weitesten verbreiteten und rungen verschoben haben mögen (Takken et al. 2002).
effizientesten, früheren Vektoren gehören in den A.
maculipennis-Komplex: A. sacharovi, A. labranchiae Klimaabhängige Entwicklung
und A. atroparvus. Weniger effizient waren A. messeae und Verbreitung der Vektoren
und A. maculipennis s.s. aus demselben Artenkomplex, und Malariaerreger
A. claviger s.s. aus dem A. claviger-Komplex und A. Wenngleich die effizientesten Malariavektoren Euro-
superpictus. Alle weiteren, prinzipiell zur Erreger pas aufgrund ihrer Thermophilie (z.B. A. sacharovi und
übertragung befähigten Anopheles-Arten spielten in der A. labranchiae) und ihrer Toleranz gegenüber hohen
Malariaepidemiologie Europas untergeordnete Rollen. Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit (A. super-
Keine Informationen existieren naturgemäß über die pictus) auf den Mittelmeerraum beschränkt waren, so
erst kürzlich entdeckte Spezies A. daciae, die zuvor traten die Malaria und als Überträger geeignete Ano-
aufgrund ihrer hohen morphologischen und genetischen pheles-Mücken auch in nördlicheren Regionen Euro-
Ähnlichkeit als A. messeae misidentifiziert worden war pas auf, die durch ein gemäßigtes Klima gekennzeich-
(Nicolescu et al. 2004) und auch in Deutschland weit net waren.
verbreitet zu sein scheint (Kronefeld et al. 2014). Die Entwicklung der Anopheles-Mücken ist artspe-
Kartografische Übersichten über das Vorkommen zifisch an die regionalen Klimabedingungen angepasst.
der meisten europäischen Anopheles-Arten sind bei Während südliche Arten häufig ganzjährig aktiv sind,
Ramsdale & Snow (2000) zu finden, die die relevante überwintern nördlichere Arten i.d.R. als adulte Weib-
Fachliteratur der letzten Jahrzehnte ausgewertet haben. chen an geschützten, dunklen und relativ temperatur-
Tab. 3.2.3-1: Anopheles-Arten in Europa und ihre mögliche Rolle als Überträger von Malariaerregern
(+++: höchst effizient, ++: durchschnittlich, +: mäßig, (+): nur ausnahmsweise, ?: fraglich, ‒: kein Überträger).
Spezies Geografische Verbreitung1 Vektorkompetenz2
A. atroparvus3 Mittel- u. Südeuropa +++
A. beklemishevi3 Sandinavien u. nördl. Russland (+)
A. daciae3 ? (vermutl. ganze Paläarktis) ?
A. labranchiae3 Italien, Korsika, Balkan +++
A. maculipennis s.s.3 Mittel- u. Südeuropa ++
A. melanoon3 Italien, Südfrankreich, iberische Halbinsel (+)
A. messeae3 gesamtes Europa ++
A. saccharovi3 vorw. Balkan u. Griechenland +++
A. subalpinus3,5 Südeuropa (+)
A. claviger s.s.4 Mittel- u. Südeuropa ++
A. petragnani4 Italien, Südfrankreich, iberische Halbinsel ‒
A. algeriensis vorw. Südeuropa ++
A. cinereus iberische Halbinsel (+)
A. hyrcanus Südeuropa +
A. marteri Südeuropa (+)
A. multicolor Südspanien ?
A. plumbeus Mittel- u. Südeuropa ++
A. sergentii Pantelleria6 ++
A. superpictus Südosteuropa ++
1
nach Ramsdale & Snow (2000);
2
nach Becker et al. (2010) und Jetten & Takken (1994);
3
A. maculipennis-Komplex;
4
A. claviger-Komplex;
5
Artstatus fraglich;
6
Insel südlich von Sizilien (einziger Nachweis in Europa).
3. Aktuelle und potenzielle Gefahren für die Gesundheit
konstanten Plätzen, z.B. in Höhlen, Speichern, Ställen, pheles-Arten und so z.B. zu einer Ausbreitung effizi-
Kellern oder auf Dachböden. Sie können meist sogar enter Malariavektoren nach Norden führen.
Frost ertragen, wenn er stabil bleibt. Häufige Tempe-
raturschwankungen erhöhen dagegen die Mortalität. Risikoanalysen
Nichtsdestoweniger können Anopheles-Weibchen in Zur zukünftigen Verbreitung von Malariavektoren und
milden Winterphasen durchaus auch innerhalb von Ge- zum Risiko einer erneuten Ausbreitung der Malaria in
bäuden intermittierend aktiv werden und zur Auffüllung den europäischen Ländern liegen nur wenige Model-
ihrer Fettreserven ein Blutmahl zu sich nehmen. Waren lierungen vor. Kuhn et al. (2002) stellten aktuelle Ri-
solche Mücken Träger von P. vivax, so kam es früher sikoverbreitungskarten für die früheren europäischen
auf diese Weise sogar in nördlicher gelegenen Regio Malariavektoren auf, mit denen sie nachwiesen, dass
nen Europas gelegentlich zu Malariafällen im Winter deren gegenwärtige Verbreitung mit hoher Zuverlässig-
(Wintermalaria) und häufig zu Infektionen im Frühjahr, keit mit Umwelt- und Klimadaten korreliert. Da man
wenn die Mücken allgemein wieder aktiv wurden (P. bei einer hohen Verbreitungswahrscheinlichkeit von
vivax hibernans) (z.B. Huldén et al. 2005). einer hohen Mückenabundanz ausgehen kann, emp-
Ansonsten besteht zwischen der Dauer der Mü- fiehlt sich ihr Modell zur Aufstellung von Risikover-
ckenentwicklung, ausreichende Luftfeuchtigkeit vor- breitungskarten für zukünftige klimatische Szenarien.
ausgesetzt, und der Temperatur bis zu einem gewissen Für Großbritannien stellen Lindsay & Thomas (2001)
Maximalwert eine positive lineare Beziehung. Die Lar- fest, dass jetzt wie früher viele Regionen warm genug
valentwicklung beginnt bei den meisten europäischen für eine Übertragung von P. vivax sind und dass sich
Anopheles-Arten bei etwa 10 °C und erreicht bei 25–30 diese Gebiete in der Zukunft vermutlich vergrößern
°C das Optimum (Jetten & Takken 1994). Bei 20 °C werden und Malariaausbrüche möglich sind. Kuhn et
dauert die Larvalperiode ca. zwei Wochen, die Puppen- al. (2003) kommen allerdings für Großbritannien zu
phase 2–5 Tage und die Imaginalphase, je nach Luft- dem Schluss, dass bei einer Temperaturerhöhung von
feuchtigkeit, zwei bis sechs Wochen. bis zu 2,5 °C bis 2050 und einem gleich bleibenden
Auch der gonotrophe Zyklus, der aus Wirtsuche, Gesundheitssystem, das importierte Malariafälle in-
Blutaufnahme und Blutverdauung besteht, ist tempe- nerhalb einer Woche eliminiert, die Wahrscheinlichkeit
raturabhängig. So benötigen z.B. die Weibchen von A. des Auftretens von lokalen Malariafällen oder gar ei-
maculipennis s.s. für die Blutverdauung, die mit der ner erneuten Etablierung der Malaria vernachlässigbar
Oogenese einhergeht, zwischen mehr als 10 Tagen bei gering sei. Eine weitere Studie, die das Risiko von
15 °C bis zu ca. 2 Tagen bei 27 °C. Niedrige Luftfeuch- Malaria tertiana-Ausbrüchen in Niedersachsen unter
tigkeiten haben bei gleicher Temperatur allerdings Bedingungen einer Klimaerwärmung untersucht, geht
einen hemmenden Effekt. Höhere Temperaturen be- auf Basis von IPCC-Szenarien für 2020 von einer po-
dingen durch die Erhöhung der Oogenese-Geschwin- tenziellen Übertragungsdauer von maximal vier Mona-
digkeit und der Blutaufnahme-Frequenz des einzelnen ten im Jahr aus (Schröder et al. 2007). Im Kontrast zu
Mückenweibchens so indirekt eine Zunahme der Po- solchen Berechnungen gibt es jedoch auch Meinungen,
pulationsgrößen und der allgemeinen Stechaktivität der die Klima-basierte Modelle prinzipiell für ungeeignet
Mücken. halten, die Ausbreitung und zukünftigen Prävalenzen
Die Entwicklung der Malariaerreger in der Ano- durch Moskitos übertragener Krankheiten vorauszusa-
pheles-Mücke ist ebenfalls signifikant temperaturab- gen, da menschliche Aktivitäten und deren ökologische
hängig: P. falciparum benötigt eine Minimaltemperatur Auswirkungen ungleich gewichtiger sind als das Klima
von 18–20 °C, P. vivax von ca. 15 °C und P. malariae (z.B. Reiter 2001).
von ca. 16,5 °C (Molineaux 1988). Die Entwicklung
bis zum infektiösen Sporozoitenstadium (Sporogonie) Schlussbetrachtung
dauert bei P. vivax bei 25 °C neun Tage, bei P. malariae Da das Vorkommen und die Verbreitung von Anophe-
15–20 Tage. Bei P. falciparum beträgt sie 23 Tage bei les-Mücken i.W. von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
20 °C, aber nur noch neun Tage bei 30 °C. Verfügbarkeit von Blutwirten und Brutgewässern ab-
Sowohl Vektor als auch Erreger entwickeln sich hängen und die Entwicklungsgeschwindigkeiten von
also innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen umso Mücken und Plasmodien temperaturabhängig sind, ist
schneller, je wärmer es ist. In einem endemischen Ma- eine klimabedingte Temperaturerhöhung prinzipiell
lariagebiet nimmt das Risiko einer Plasmodien-Trans- günstig für die Malaria zu bewerten. Eine Zunahme
mission daher eindeutig mit steigenden Temperaturen sporadisch auftretender Einzelfälle der Malaria ist da-
zu. Darüber hinaus könnten Klimaveränderungen zu her bei einer fortschreitenden Klimaerwärmung in Mit-
Verschiebungen in der räumlichen Verteilung der Ano teleuropa nicht auszuschließen, zumal dann mit einer
3.2.2 H. Kampen
Einwanderung effizienterer Malariavektoren aus dem und angrenzenden Regionen: Artidentifizierung und
südeuropäischen Raum gerechnet werden muss. Epi- Bedeutung für die Übertragung der Malaria und an-
demien oder gar eine Reetablierung der Malaria sind derer Infektionskrankheiten. Habilitationsschrift, Med.
allerdings bei dem gegebenen Standard der Gesund- Fakultät der Universität Bonn. 73 S.
KRONEFELD M., WERNER D. & H. KAMPEN (2014):
heitsfürsorge auf lange Sicht höchst unwahrscheinlich.
PCR identification and distribution of Anopheles daciae
Nichtsdestoweniger sollte in Ländern wie Deutschland (Diptera, Culicidae) in Germany. Parasitol. Res. 113,
auch in Hinsicht auf andere durch Stechmücken über- 2079-2086.
tragbare Krankheiten, insbesondere viral bedingte, KRÜGER A., RECH A., SU X. & E. TANNICH (2001):
die so lange vernachlässigte Stechmückenforschung Two cases of autochthonous Plasmodium falciparum
wieder intensiviert werden, damit zukünftig bessere malaria in Germany with evidence for local transmis-
Risikoabschätzungen möglich sind und präventiv statt sion by indigenous Anopheles plumbeus. Trop. Med.
reaktiv gehandelt werden kann. Int. Health 5, 263-274.
KUHN K.G., CAMPBELL-LANDRUM D. H. & C. R.
DAVIES (2002): A continental risk map for malaria
Literatur
mosquito (Diptera: Culicidae) vectors in Europe. J.
ALTEN B., KAMPEN H. & D. FONTENILLE (2007):
Med. Entomol. 39, 621-630.
Malaria in Southern Europe: Resurgence from the Past?
KUHN K. G., CAMPBELL-LANDRUM D. H., ARM-
In: TAKKEN W. & B. G. J. KNOLS (eds.), Emerging
STRONG B. & C. R. DAVIES (2003): Malaria in
Pests and Vector-borne Diseases in Europe. Wagenin-
Britain: present, past, and future. Proc. Natl. Acad. Sci.
gen Academic Publ., Wageningen, Holland. 35-57.
USA 100, 9997-10001.
BECKER N., PETRIĆ D., ZGOMBA M., BOASE C.,
LANCISI G. M. (1717): De noxiis paludum effluviis, eo-
MADON M., DAHL C., LANE J. & A. KAISER (2010):
rumque remediis. J.M. Salvioni, Roma, 384 S.
Mosquitoes and their Control, 2nd Ed. Springer-Verlag,
LINDSAY S. W. & C. J. THOMAS (2001): Global warm-
Berlin, 577 pp.
ing and risk of vivax malaria in Great Britain. Global
BRUCE-CHWATT L. J. & J. DE ZULUETA (1980): The
Change & Human Health 2, 80-84.
Rise and Fall of Malaria in Europe. Oxford University
MAIER W. A. (2004): Das Verschwinden des Sumpf-
Press, Oxford, UK. 239 pp.
fiebers in Europa: Zufall oder Notwendigkeit? Denisia
CORRADETTI A. (1987): In the Roman Campagna from
13, 515-527.
G.M. Lancisi to G.B. Grassi: Two centuries of ideas, hy-
MARCHANT P, ELING W., VAN GEMERT G. J.,
potheses and misunderstandings about malaria fevers.
LEAKE C. J. & C. F. CURTIS (1998): Could British
Parassitologia 29, 123-126.
mosquitoes transmit falciparum malaria? Parasitology
DANIS K., LENGLET A., TSERONI M., BAKA A.,
Today 14, 344-345.
TSIODRAS S. & S. BONOVAS (2013): Malaria in
MOLINEAUX L. (1988): The epidemiology of human
Greece: historical and current reflections on a re-emerg-
malaria as an explanation of its distribution, including
ing vector borne disease. Travel Med. Infect. Dis. 11,
some implications for its control. In: WERNSDORFER
8-14.
W.H. & I. MCGREGOR (Hrsg.), Malaria – Principles
DASHKOVA N. G. (1977): New data on susceptibility
and Practice of Malariology, Vol. 2, Churchill Living-
of Anopheles mosquitoes of the U.S.S.R. fauna to im-
stone, Edinburgh, SS. 913-998.
ported strains of the causative agents of human malaria.
NICOLESCU G., LINTON Y.-M., VLADIMIRESCU A.,
Meditcinskaya Parasitilogia 46: 652-657.
T. M. HOWARD & R. E. HARBACH (2004): Mos-
DE ZULUETA J., RAMSDALE C. D. & M. COLUZZI
quitoes of the Anopheles maculipennis group (Diptera:
(1975): Receptivity to malaria in Europe. Bull. Wrld
Culicidae) in Romania, with the discovery and formal
Health Org. 52, 109-111.
recognition of a new species based on molecular and
EICHENLAUB D. (1979): Malaria in Deutschland.
morphological evidence. Bull. Ent. Res. 94, 525-535.
Bundesgesundheitsbl. 22, 8-13.
NIKOLAEVA N. (1996): Resurgence of malaria in the for-
ELING W., VAN GEMERT G. J., AKINPELU O., J. CUR-
mer Soviet Union (FSU). SOVE Newsl. 27, 10-11.
TIS & C. F. CURTIS (2003): Production of Plamodium
RAMSDALE C. D. & M. COLUZZI (1975): Studies on
falciparum sporozoites by Anopheles plumbeus. Eur.
the infectivity of tropical African strains of Plasmodium
Mosq. Bull. 15, 12-13.
falciparum to some southern European vectors of ma-
HULDÉN L., HULDÉN L. & K. HELIÖVAARA (2005):
laria. Parassitologia 17, 39-48.
Endemic malaria: an ‚indoor‘ disease in northern Eu-
RAMSDALE C. & K. SNOW (2000): Distribution of the
rope. Historical data analysed. Malaria J. 4, 19.
genus Anopheles in Europe. Eur. Mosq. Bull. 7, 1-26.
ISAÄCSON M. (1989): Airport malaria: a review. Bull.
REITER P. (2001): Climate change and mosquito-borne
Wrld Health Organ. 67, 737-643.
diseases. Environ. Health Perspect. 109 (Suppl. 1), 141-
JETTEN T. H. & W. TAKKEN (1994): Anophelism with-
161.
out Malaria in Europe – A Review of the Ecology and
RKI (2013): Infektionsepidemiologisches Jahrbuch
Distribution of the Genus Anopheles in Europe. Wa-
meldepflichtiger Krankheiten für 2012. Robert-Koch-
geningen Agric. Univ. Papers 94-5. 69 pp.
Institut, Berlin, 208 S.
KAMPEN H. (2005): Anopheles-Zwillingsarten in Europa
3. Aktuelle und potenzielle Gefahren für die Gesundheit
SCHAFFNER F., THIÉRY I., KAUFMANN C., ZETTOR dynamics of larval populations of Anopheles messeae
A., LENGELER C., MATHIS A. & C. BOURGOUIN and A. atroparvus in the delta of the rivers Rhine and
(2012): Anopheles plumbeus (Diptera: Culicidae) in Meuse, The Netherlands. Ambio 31, 212-218.
Europe: a mere nuisance mosquito or potential malaria WHO (2004): The Vector-borne Human Infections of Eu-
vector? Malar J 11, 393. rope – Their Distribution and Burden on Public Health.
SCHRÖDER W., SCHMIDT G., BAST H., PESCH R. & WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Den-
E. KIEL (2007): Pilot-study on GIS-based modelling mark. 144 pp.
of a climate warming induced tertian malaria outbreak WHO (2013): World Malaria Report 2013. Geneva, 255
in Lower Saxony (Germany). Environ. Monit. Assess. pp.
133, 483-493. ZOLLER T., NAUCKE T. J., MAY J., HOFFMEISTER
SCHUBERG A. (1927): Das gegenwärtige und früh- B., FLICK H., WILLIAMS C. J. FRANK C., BERG-
ere Vorkommen der Malaria und die Verbreitung der MANN F., SUTTORP N. & F. P. MOCKENHAUPT
Anophelesmücken im Gebiete des Deutschen Reiches. (2009): Malaria transmission in non-endemic areas:
Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt 59, 1-424. case report, review of the literature and implications for
SHUTE P. G. (1940): Failure to infect English specimens public health management. Malaria J. 8, 71.
of Anopheles maculipennis, var. atroparvus, with certain
Kontakt:
strains of Plasmodium falciparum, of tropical origin. J. PD Dr. Helge Kampen
Trop. Med. Hyg. 43, 175-178. Friedrich-Loeffler-Institut
TAKKEN W., GEENE R., ADAM W., JETTEN T. H. & Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Insel Riems
J. A. VAN DER VELDEN (2002): Distribution and helge.kampen@fli.bund.de
Kampen, H. (2014): Wird die Malaria wieder eine Gefahr für Europa? In: Lozán, J. L., Grassl, H., Karbe, L. & G.
Jendritzky (Hrsg.). Warnsignal Klima: Gefahren für Pflanzen, Tiere und Menschen. 2. Auflage. Elektron. Veröffent.
(Kap. 3.2.2) - www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de.
Sie können auch lesen