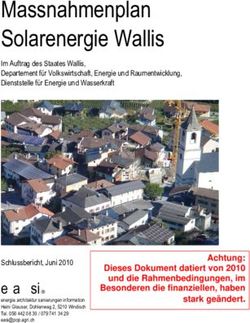Zehn historische Weisheiten aus der regionalen und lokalen Geschichte von Rödermark - Zusammengestellt von Norbert Cobabus
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
0
Zehn historische Weisheiten aus der
regionalen und lokalen Geschichte
von Rödermark
Zusammengestellt von
Norbert Cobabus
Rödermark 20121
Inhalt
Vorbemerkung 2
Ober-Roden, Nieder-Roden, Rödermark und die Rodau 3
Sühnekreuze 6
Feldkreuze 8
Russe oder Russensteine 10
Dalles 12
Bulau 14
Fränkischer Rundling 16
Haufendorf 18
Begräbnisstätten, Kirchhöfe, Friedhöfe 20
Die Rodau von der Quelle bis zur Mündung 222
Vorbemerkung
In dieser kleinen Textsammlung sind von mir zu verschiedenen
Gesichtspunkten aus der Geschichte Südhessens und damit auch der
Region in und um Rödermark herum Fakten und Hintergründe zusammen
gestellt worden, die häufig zu Missverständnissen führen.
Wie ich aufgrund meiner nun fast zehnjährigen Anwesenheit in Rödermark
weiß, werden viele für unsere Regional- und Ortsgeschichte bedeutsame
Fakten immer noch falsch gedeutet. Das hat verschiedene Ursachen. Zum
einen kann sich nicht jeder mit den Einzelheiten dieser historischen
Gegebenheiten selbst vertieft beschäftigen. Zum anderen haben aber auch
manche falschen Deutungen von Ortsansässigen und Heimatforschern, die
bei Ortsführungen erzählt werden, in Broschüren abgedruckt werden, auf
Beschilderungen im Ort und in der Landschaft stehen und die sich heute
zum Teil auch im Internet wieder finden, dazu geführt, dass diese
Sachverhalte immer noch in diesen unrichtigen Versionen weiter verbreitet
werden. Und schließlich kommt hinzu, dass manche historischen
Gegebenheiten einer ausgesprochen sorgfältigen lokalen und regionalen
Untersuchung anhand früherer Quellen bedürfen, um die Ursprünge der
heutigen Deutungen und Namen zu erkennen. Denn Tatsache ist, dass
nicht selten heute gleich lautende Wörter oder sich heute äußerlich ähnlich
darstellende Sachverhalte einen völlig unterschiedlichen Ursprung haben.
Ich habe daher in dieser kleinen Textsammlung mit Bezug auf Rödermark
und seine nähere Umgebung einige jener historischen Gegebenheiten
aufgegriffen, die – wie ich festgestellt habe – bis heute noch von einem
erheblichen Teil jener Personen, die darüber gelegentlich sprechen oder
schreiben, falsch gedeutet werden.
Mögen daher diese relativ kurzen Erläuterungen zu diesen Sachverhalten
dazu beitragen, manche Irrtümer und falsche Annahmen zu beseitigen
und sie auf die tatsächlichen historischen wie gegenwärtigen
Gegebenheiten zurück zu führen.
Norbert Cobabus
im November 20123
Ober-Roden, Nieder-Roden, Rödermark
und die Rodau
Wer das Wort „Roden“ im Zusammenhang mit einem Flur- oder
Ortsnamen hört, denkt im Allgemeinen an die Rodung eines Waldes, also
das Fällen der Bäume, um freies Gelände für die Landwirtschaft bzw. die
Entstehung einer Siedlung zu erhalten. In der Tat ist es auch überwiegend
so, dass der Wortteil „roden“ oder „rott“ oder „rat“ bzw. „rath“ und einige
diesbezügliche Begriffe mehr darin ihren Ursprung haben. Sehr viele
Menschen, die die Namen Ober-Roden und Nieder-Roden hören und selbst
sehr viele Bürger und Bürgerinnen aus Rödermark und dem Rodgau
vermuten daher auch nach wie vor, dass diese beiden Ortsnamen sich von
einer Waldrodung ableiten und übertragen das daher auch auf den Namen
Rödermark; was dann inzwischen auch im Internet entsprechend
behauptet wird. Diese Annahme ist jedoch bezogen auf diese drei
Bezeichnungen schlichtweg falsch – und auch bei manchen anderen
Namen mit diesen Endungen sollte man vorsichtig sein und den
historischen Sachverhalt erst genau prüfen, bevor man daraus seine
Schlüsse zieht.
Der erste Ursprung des Wortbestandteils „Roden“ bzw. „Röder“ geht auf
das Jahr 786 n.Chr. zurück und ist in einer Urkunde des Klosters Lorsch
enthalten. Dort wird nämlich ein Nonnenkloster in dieser Region erwähnt:
„… hoc est monasterium quod es constructum in honore sancte Marie vel
ceterorum sanctorum in pago Moynecgowe, in fine vel marcha Raodora in
loco nuncupato Niwenhof, super fluvium Rodaha …“ [dieses Kloster ist
errichtet zu Ehren der heiligen Maria und der übrigen Heiligen im Maingau,
im Gebiet der Mark (Gemarkung) Raodora beim Niwenhof oberhalb des
Flusses Rodaha …]. In neun weiteren Urkunden des Klosters Lorsch
taucht dann in den folgenden Jahrzehnten der Name Rodaha bzw. Rotaha
in leicht abgewandelter Schreibweise immer wieder auf; später zum Teil
auch Rothaha geschrieben.
Bereits in einer Urkunde des Klosters aus dem Jahr 791 werden die beiden
Orte „rotahen superior und inferior“, also das obere und das untere
bzw. niedere Rotaha erwähnt. Hinter diesen beiden Namen verbergen sich
die damaligen Siedlungen Ober-Roden und Nieder-Roden. Noch in einer
Landkarte aus dem Jahr 1797 steht die Bezeichnung „Ober Roth.“ für
Ober-Roden bzw. die Bezeichnung „Nieder Roth.“ für Nieder-Roden; also
„Roth.“ als Abkürzung von Rothaha. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
wurde dann in den amtlichen Akten aus Unkenntnis des Ursprungs dieses
Wortbestandteils aus Rothaha der Wortteil „Roden“, so wie man das
bezogen auf viele andere Orte, die auf einer ursprünglich Waldrodung
entstanden, hier in Analogie dazu nun fälschlicherweise vermutete. Ober-4 Roden und Nieder-Roden entstanden aber auf Sandhügeln (Dünenreste) in einem nahezu unbewaldeten Sumpfgebiet. Und das heutige Wort „Rödermark“, zu der als frühere „Röder Mark“ zwischen 1232 und 1818 – aktenmäßig belegt – neun bzw. zeitweilig auch zehn Markgemeinden gehörten, leitet sich ebenfalls mit seinem Wortbestandteil „Röder“ aus dem Wort Rodaha bzw. Rotaha oder auch Rothaha ab. Die Urkunden des Klosters Lorsch belegen dies: – Im Jahr 786 im Zusammenhang mit dem dabei erwähnten Kloster super fluvium Rodaha heißt es: marcha Raodora (marcha = Mark bzw. Gemarkung; dazu der Markwald der von mehreren Orten gemeinsam genutzt wird; also später die Röder Mark) – Im Jahr 790 Besitz der Adelhard: villa Rotaha – Im Jahr 791 Besitz des Erlulf: Rotahen superior et inferior (also später Ober-Roden und Unter- bzw. Nieder-Roden) – Im Jahr 792 Besitz des Salcho: Rotaha – Im Jahr 796 Besitz des Eckehard und des Sieghart in der: Rotaher marca (also später die Röder Mark) – Im Jahr 798 Adelgard hatte Besitztum in der: Rotaher marca (also später die Röder Mark) – Im Jahr 800 Hofreiten und Land von Liuuecho und Reginher in der: Rotha marca (also später die Röder Mark) – Im Jahr 805 Besitz von Ranuolt in: Rotahe – Im Jahr 813 Besitz von Ranuolt in: Rotahe – Im Jahr 815 6 Hofreiten, 20 Huben, 1 Wald und 38 Leibeigene in: Rodaha. Ab 1232 beginnend wurde aus diesen früheren Bezeichnungen dann bald der Name „Röder Mark“ gebildet. Er wird daher heute sinnvoller Weise auch für die aus Ober-Roden und Urberach im Jahr 1977 gebildete Großgemeinde – nun Rödermark geschrieben – verwendet, da neben dem Ausgangsort Ober-Roden auch Urberach zur Markgenossenschaft Röder Mark gehörte. Und außerdem lag das Nonnenkloster „super fluvium rodaha“ ganz offensichtlich auf dem Kirchhügel in Ober-Roden, auf dem sich heute die katholische Kirche St. Nazarius befindet, benannt nach dem im Kloster Lorsch ab 765 aufbewahrten Gebeinen des Heiligen Nazarius. Was bedeutet nun Rodaha bzw. Rotaha oder Rothaha? Dieses altdeutsche Wort besteht aus zwei Wortbestandteilen, nämlich „rod“ bzw. „rot“ oder später auch „roth“ und „aha“. Der Wortbestandteil „rod“ steht für die Farbe rot. Der Wortbestandteil „aha“ steht für Fließgewässer, also für einen Bach oder einen Fluss. Im Lateinischen, also bei den alten Römern lautet das Wort „aqua“ (Wasser, Bach, Fluss); und beides stammt aus der indoeuropäischen Sprachfamilie, die sich von Indien über das westliche Asien nach Europa verbreitete und dort
5 vermutlich „aga“ lautete, ehe es in Südeuropa sodann zu „aqua“ und in Mitteleuropa zu „aha“ umgewandelt wurde. Später gingen aus dem Wort „aha“ in Mitteleuropa zwei weitere neue Begriffe hervor: In Süddeutschland und vor allem in Österreich das Wort „Ache“ für Bach oder Fluss und bei uns das Wort „Au“ für einen kleinen Fluss oder einen Bach. Und so formte sich dann aus „rodaha“ und somit „rod“ und „aha“ das Wort „Rodau“ (roter Bach) für den westlich von Urberach entspringenden Wasserlauf. Denn dieser Bach war durch das abgehende Raseneisenerz von den seitlichen Hängen besonders nach Regenfällen früher oft deutlich rötlich gefärbt. Somit lassen sich also Ober-Roden, Nieder-Roden, Rödermark und die Rodau auf einen gemeinsamen Ursprung, nämlich auf rodaha, zurückführen.
6
Sühnekreuze
Bei den Sühnekreuzen handelt es sich um aufgestellte einfache Stein-
kreuze aus der vorreformatorischen Zeit von etwa 1000 n.Chr. bis um
1500 n.Chr. bzw. bis an die Anfänge des 16. Jahrhundert hinein. Da sich
dieser Brauch in den katholischen Regionen Deutschlands vollzog, ist er
von einigen Ausnahmen auch in anderen Regionen Mitteleuropas (später
Deutschland) einmal abgesehen (etwa in Sachsen und Thüringen) vor
allem auf das heutige Südhessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg
und Bayern (hier vor allem Unterfranken) bezogen.
Der älteste Ursprung für die Aufstellung von Sühnekreuzen leitet sich aus
den altgermanischen Blutfehden ab, die bis weit in das Mittelalter hinein
zum Teil noch überlebt hatten. Wenn es zwischen verschiedenen Sippen
oder Großfamilien zu einem Totschlag oder Mord kam, entspann sich
früher (wie vielfach in anderen Ländern noch fast bis in die Gegenwart
hinein) eine Fehde zwischen diesen Sippen, wo eine Rache und damit im
Zusammenhang oft ein weiterer Totschlag oder Mord sodann auf den
nächsten, oft über Generationen hinweg, folgte.
Nachdem sich nun das Christentum ab dem 7. Jahrhundert beginnend in
Mitteleuropa zu etablieren begann und dann auch mit der Zeit mit den
weltlichen Mächten (zunächst dem König bzw. Kaiser, später auch
anderen adligen Herrschern) arrangierte, wurde versucht, in einer
gemeinsam christlich geprägten Gerichtsbarkeit diese bis dahin noch
fortdauernden Blutfehden einzudämmen. So kam es dann aufgrund der
Gerichtsbarkeit nach einem Totschlag oder Mord zu einem sog.
Sühnevertrag zwischen den gegnerischen Sippen bzw. Großfamilien, um
damit die ansonsten fortdauernden Racheakte zu beenden. Und im
Rahmen dieses Vertrags wurde an dem Ort des letzten Totschlags oder
Mordes ein Sühnekreuz aufgestellt, in wenigen Fällen auch mit Zeichen
versehen, die auf den Ermordeten oder den Mörder hindeuteten, wie etwa
ein Beil oder ein Messer. Diese Vermittlung zwischen den zuvor
verfeindeten Parteien war vor allem auch deshalb damit verbunden, am
Tatort ein Sühnekreuz aufzustellen (formal veranlasst durch den Mörder),
um ihm zu ermöglichen, dadurch seine Sünde einzugestehen zu sühnen
und somit später vor Gott bestehen zu können und nicht in die Hölle zu
müssen. Unter diesen Bedingungen war dann zumeist die Bereitschaft auf
beiden Seiten gegeben, die vorherige Blutfehde zu beenden.
Als später die Blutfehden nachließen bzw. ganz aufhörten (wohl nach zwei
bis zweieinhalb Jahrhunderten) wurde zunächst die Aufstellung des
Kreuzes noch im Zusammenhang mit neuen Morden weiter
wahrgenommen, wobei durch das seitens des Mörders aufgestellte Kreuz
(zum Teil drängte man ihn auch dazu), er vor Gott durch sein Sühnen7 bestehen konnte und somit einer späteren Höllenqual entgehen konnte. Anfang des 16. Jh. lief dann dieses Brauchtum endgültig aus, und neue Sühnekreuze wurden nun nicht mehr aufgestellt. Nicht zuletzt hing dies auch damit zusammen, dass ab dieser Zeit eine neue kaiserliche Gerichtsordnung erarbeitet wurde, nämlich die Constitutio Criminalis Carolina, die unter Karl V. im Jahre 1532 in Kraft trat. In überlieferten Urkunden aus dem Mittelalter wird insgesamt nur sehr wenig über die einzelnen konkreten Fälle zu den Sühneverträgen bzw. zu den Sühnekreuzen berichtet. Die deshalb heute mit den Sühnekreuzen verbundenen Anekdoten, bei denen es zumeist auch um wie auch immer ausgebübte Morde geht, haben daher mit den Sühnekreuzen gar nichts oder nur in den seltensten Fällen etwas zu tun. Abgesehen von Fehlern bei den Überlieferungen dieser Anekdoten oder Legenden stehen sie zumeist in Verbindung mit einigen der später aufgestellten Feldkreuze, die heute zum Teil noch oft mit den sehr viel älteren Sühnekreuzen verwechselt werden. Die meisten Sühnekreuze blieben an dem Ort stehen, wo der Mord stattfand. Allerdings sind im Rahmen der Erweiterung des Ackerlandes, von Baumaßnahmen innerhalb der einzelnen Gemeinden bzw. beim Straßenbau einige Sühnekreuze auch verschwunden, während andere versetzt wurden. So wurde mindestens ein Sühnekreuz in Urberach eindeutig versetzt und in einer Mauernische neben dem Häfnerplatz neu aufgestellt. Bei Straßenbaumaßnahmen zwischen Dietzenbach und Götzenhain und auch mindestens bei zwei anderen Straßenbaumaßnahmen im Kreis Offenbach wurden die Sühnekreuze etwas seitlich versetzt. Über den Ursprung und die Geschichte dieser Sühnekreuze gibt es nur ein geringes Schrifttum. So gehört dazu ein im Jahr 1929 verfasstes seriöses historisches Buch von Eugen Mogk mit dem Titel „Der Ursprung der mittelalterlichen Sühnekreuze“. Ansonsten handelt es sich bei dem Schrifttum zu diesem Thema vorwiegend um heimatkundliche Publikationen, die zwar die Standorte der Sühnekreuze in den einzelnen Regionen korrekt beschreiben, aber dazu vielfach Anekdoten und Legenden vermitteln, die nicht nur bezogen auf diese Sühnekreuze, sondern auch die späteren teilweise als Sühnekreuze bezeichneten Feldkreuze oft jeder historischen Grundlage entbehren. Ähnlich ist es diesbezüglich inzwischen auch im Internet bestellt.
8
Feldkreuze
Feldkreuze werden zum Teil mit den Sühnekreuzen verwechselt. Diese
Verwechslung bzw. Durchmischung findet sich oft in der
heimatgeschichtlichen Literatur, aber auch zum Teil in der Beschilderung
von Feldkreuzen bzw. Sühnekreuzen. Tatsächlich haben die Sühnekreuze,
wie diese zu Beginn des Hochmittelalters entstanden, mit den Feldkreuzen
nichts zu tun. Denn die Feldkreuze kamen erst im Laufe des 17.
Jahrhunderts auf, also zu einer Zeit, zu der die Aufstellung letzter
Sühnekreuze schon mehr als neun Jahrzehnte zurück lag.
Im Unterschied zu den ziemlich einfachen aus Stein gefertigten und
zumeist auch relativ kleinen Sühnekreuzen sind die Feldkreuze sehr viel
größer und in sehr vielfältiger Form gefertigt worden. Es gibt sie in Holz,
in Stein, in Eisen (zumeist Gusseisen) oft mit Verzierungen versehen oder
auch deren Kombination, als Heiligenstöcke sowie in Form von
Weihhäuschen mit verschiedenen Bildmotiven – letzteres vor allem in
Süddeutschland und besonders in Österreich, wo sie auch als Materl
bezeichnet werden. Zudem sind viele Feldkreuze auch mit sehr
unterschiedlichen Motiven, Verzierungen und zum Teil Beschriftungen
versehen. Sie sind also insgesamt gesehen sehr viel aufwändiger gestaltet
als die stets einfachen Sühnekreuze, von denen auch nur sehr wenige eine
einfache Eingravierung wie etwa ein Beil oder ein Messer besitzen. Die
Ikonografie [symbolisch verfestigte Darstellung] der Feldkreuze stellt vor
allem den gekreuzigten Christus in den Mittelpunk, zum Teil aber in
Verbindung mit anderen Personen, zumeist Maria, oder seltener auch
andere Bildmotive wie in den Bildnischen der Bildstöcke oder der Materl.
Besonders die Bilder der Materl wurden entsprechend vielseitig
ausgestaltet.
Die meisten Feldkreuze entstanden im 17. und 18. Jahrhundert, mit
abnehmender Tendenz im 19. Jahrhundert und noch mehr im 20.
Jahrhundert. Aber selbst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
wurden noch an einzelnen Orten neue Feldkreuze errichtet. Neu meint
dabei wirklich neue Kreuze und nicht die Renovierung alter Feldkreuze
oder die Wiederaufstellung zeitweise von ihrem Platz entfernter
Feldkreuze, was bis in die letzten Jahre häufiger geschehen ist.
Im Unterschied zu den Sühnekreuzen, dessen Anlass zur Aufstellung sich
im Laufe ihrer Geschichte nur etwas gewandelt hat, sind die Gründe und
Motive für die Aufstellung von Feldkreuzen sehr viel vielfältiger. Dennoch
gab und gibt es dabei von den Anfängen ihrer Aufstellung bis heute
bestimmte Motiv-Schwerpunkte bzw. auch immer einmal wieder kehrende
ähnliche Gründe zu ihrer Aufstellung.9 Viele Feldkreuze entstanden im Zusammenhang mit den Ereignissen und Folgen des Dreißigjährigen Kriegs. Dabei ging es darum zu bitten, dass sich solche Kriege nicht wiederholen, dass die verheerenden Folgen durch Seuchen wie die Pest und die Hungersnöte aufgrund zerstörter Felder und Ernten sowie der abgebrannten Häuser in Zukunft ausblieben und dass bestimmte damit gehäuft auftretende Krankheiten nicht wiederkehren mögen. Man führte dies alles auf die begangenen Sünden der Menschen zurück. Hungersnöte, Krankheiten und Missernten waren aber auch lange Zeit danach, vor allem während des gesamten 18. Jahrhunderts, das wie auch die beiden Jahrhunderte davor oft strenge Winter kannte, die Hauptursache zur Errichtung von Feldkreuzen. Im 19. Jahrhundert und bis in das 20. Jahrhundert hinein wurden die Feldkreuze, die nun auch vermehrt von einzelnen Familien gestiftet wurden, zur Erlösung von schwerer Krankheit aufgestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Feldkreuze aber auch von Gruppen aufgestellt, die aus ihrer früheren Heimat vertrieben worden waren, und die nun dafür dankten, in der anfänglichen Fremde eine neue Heimat gefunden zu haben bzw. die damit in Verbindung auch an ihre alte Heimat erinnern wollten. Daneben gab es aber auch teilweise, ab der zweiten Hälfte dem 16. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein, Feldkreuze und andere Erinnerungsstätten in Verbindung mit einzelnen Morden, die an Pfarrern oder an sonstigen ehrbaren Bürgern in der freien Flur begangen worden waren. Hier wurden dann oft auch an den Orten der Morde Tafeln aufgestellt, die das Ereignis schildern. In seltenen Fällen wurden diese Kreuze auch als Sühne-Akt durch die gefassten Mörder veranlasst. Viel häufiger wurden sie aber durch die Kirchengemeinde bzw. von den Angehörigen der Ermordeten errichtet, und zwar zumeist an der Stelle oder nahe der Stelle, wo der Mord geschehen war. Diese zum Teil auch als Sühnekreuze bezeichneten Feldkreuze haben aber mit den früheren Sühnekreuzen nichts gemeinsam. Im Zusammenhang mit diesen Feldkreuzen begannen sich dann vor allem ab dem späten 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts jene Anekdoten und Legenden auszubilden, die dann fälschlicherweise auch auf die früheren Sühnekreuze übertragen wurden.
10
Russe oder Russensteine
Russe (Dialektform) oder Russensteine werden im sog. Volksmund und oft
auch auf Schildern von Heimat- und Geschichtsvereinen sowie bei
Führungen falsch erklärt. Weder sind die Russe schwarz, noch sind sie von
schlechter Qualität und daher brüchig, weshalb sie angeblich als „Russe“
bezeichnet worden wären – hätte man seinerzeit im deutschen Kaiserreich
die Steine nach einer negativ bewerteten Personengruppe benannt, wären
das die Juden gewesen, nicht aber die Russen, zu denen der deutsche
Kaiser nämlich lange Zeit ein ausgewogenes Verhältnis hatte.
Worum geht es somit bei den Russe oder Russensteinen tatsächlich?
Russe sind aus Lehm und Sand gefertigte Steine, die im offenen Feldbrand
in den sog. Russenhütten hergestellt wurden, ähnlich wie früher teilweise
auch einfache Ziegelsteine ebenfalls im offenen Feldbrand hergestellt
wurden. Je nach der Zusammensetzung des Lehms und des Sandes sind
die fertig gebrannten Russe oder Russensteine, die von der äußeren Form
her den Ziegelsteinen gleichen, hellbraun bis mittelbraun. In manchen
Fällen, in denen bei stärkerem Wind das Feuer auch die Steine erfasste,
wurden diese auch teilweise geschwärzt, also verrußt - was aber mit
Russen nichts zu tun hat.
Bei den Russenhütten handelte es sich um zwischen 8 bis 10 Meter tief
ausgehobene Gruben, mit einer Breite von zumeist 25 bis 30 Metern und
einer Länge von zumeist 50 bis 80 Metern. Hier wurden die
vorgetrockneten Steine so aufgestapelt, dass insgesamt gesehen ein
relativ gleichmäßiger Brand erfolgen konnte. Die Russe oder Russensteine
sind daher genauso stabil wie Ziegelsteine. In wenigen Fällen, wenn der
Lehm einmal etwas Anteile von Ton enthielt, wurden einzelne Russe auch
rötlich gefärbt; denn gebrannter unglasierter, also nicht mit Engobe
überzogener, Ton ist rot. Daher finden sich an manchen Bauten auch
einzelne rötlich gefärbte Steine unter den ansonsten hell- bis
mittelbraunen Russensteinen.
Die Herstellung der Russe erfolgte während des Kaiserreichs bald nach
1871 beginnend und bis etwa zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Die
Bezeichnung Russe sowie Russenhütte leitet sich davon ab, dass die
Russenhütten zunächst tatsächlich von Russen betrieben wurden. Das
deutsche Kaiserreich warb nämlich schon bald nach seiner Gründung sog.
Gastarbeiter unter den Polen, den Russen und Ukrainern an. Während die
Polen zumeist in die Bergbaureviere, vor allem ins Ruhrgebiet, zogen und
dort unter Tage tätig waren, handelte es sich bei den Ukrainern und den
Russen vor allem um Landarbeiter, die eher in den östlichen Landesteilen
wie Sachsen, Thüringen, Hessen und Bayern tätig waren. Unter den
Russen befanden sich nun auch mehrfach Personen, die den Feldbrand11 von Steinen für den Hausbau aus Lehm und Sand beherrschten. Und da die Fertigung solcher Steine wesentlich billiger war, als die Fertigung von Ziegelsteinen, wurden deshalb unter der Anleitung dieser Russen vielfach außerhalb bestimmter Ortschaften, wo auch Sand und Lehm zu Genüge vorhanden war, entsprechende Feldbrandhütten gebaut und dort diese Steine für den Bau solider Scheunen aber auch vieler Häuser gebrannt. Später konnten auch Deutsche diese Produktion durchführen, aber der Name Russenhütten blieb ebenso erhalten wie der Name Russe für die dort gefertigten Steine. In unserer Region gab es mehrere Russenhütten, von denen heute zumindest zwei noch gut mit ihrer jeweiligen Grube erkennbar sind, eine östlich von Dietzenbach und eine östlich von Jügesheim. Vor allem in Offenbach-Bieber, Mühlheim, Steinheim, Hainburg, Rodgau und Ober- Roden sind noch heute viele aus Russe gebaute Scheunen und Häuser erhalten geblieben. Manche sind verputzt worden, manche aber auch unverputzt, so dass in den letzteren Fällen die hellbraunen bis mittelbraunen Steine gut zu erkennen sind, zwischen denen sich zumeist auch nur wenige dunkel gefärbte, also verrußte, Steine befinden. Entlang der Rodgaubahn, die 1896 ihren Betrieb aufnahm, sind einige aus diesen Steinen gebaute Häuser jedoch teilweise dunkler gefärbt. Das aber rührt von dem Rauch der Dampflokomotiven her, die dort bis in die 1960er Jahre hinein täglich vorbeifuhren. Auch in Ober-Roden sind noch einzelne aus Russe oder Russensteinen gebaute Scheunen gut zu erkennen, etwa neben der Kulturhalle und in der Grabenstraße. Und in der Heitkämperstraße steht in der Nähe der Pfarr- gasse noch ein aus Russe gebautes stattliches Wohnhaus.
12
Dalles
Das Wort „Dalles“ hat verschiedene Ursprünge, die man aufgrund von
schriftlichen Quellen im jeweiligen lokalen und regionalen Zusammen-
hang genau ermitteln muss. Es hat daher bis heute mehrere unter-
schiedliche Bedeutungen.
Hier geht es um einen noch heute vor allem in kleinen Orten teilweise
vorhandenen Platz, der im Volksmund und damit im Dialekt als „Dalles“
überliefert ist.
In der südhessischen, mainfränkischen und auch noch nordbadischen
Region leitet sich das Wort „Dalles“ zumeist aus dem Jiddischen ab, vor
allem dann, wenn in den entsprechenden früheren kleinen Dörfern Juden
gelebt hatten. Diese Juden hatten nach Rückkehr aus Osteuropa nämlich
das Jiddische als ihre Sprache mitgebracht, das mit zahlreichen Wörtern
auch in die deutsche Umgangssprache Eingang gefunden hat. So steht
Dalles hier vor allem für Dorfplatz, wozu es aber erst durch einen allmäh-
lichen Bedeutungswandel kam.
Der ursprüngliche Begriff aus der jiddischen Sprache, aus dem später das
Wort Dalles für den Dorfplatz hervorging, lautet „dallut“. Dieses hebrä-
ische Wort bedeutet Armut. Gerade jene Juden, die sich in den Dörfern
mit Erlaubnis der jeweiligen Landesherren ab etwa dem Beginn des 16.
Jahrhunderts oder auch noch später nieder lassen durften, waren arme
Tagelöhner, da ihnen nur wenige Berufe zur Ausübung gewährt wurden.
Diese armen jüdischen Einwohner in den Dörfern pflegten sich am Sonn-
tagvormittag zu der Zeit, zu der die Christen in der Kirche dem Gottes-
dienst beiwohnten, auf dem Dorfplatz zum Plausch zu versammeln – so
wie dies in den 1960er und 1970er Jahren an den Sonntagen die „Gast-
arbeiter“ auf den Bahnhofsvorplätzen taten.
Da es sich bei diesen jüdischen Tagelöhnern, Bettlern und Hausierern ins-
gesamt gesehen früher um die ärmste Bevölkerungsschicht in den Dörfern
handelte, kamen hier also die Armen zusammen und stellten im übertra-
genen Sinne die Armut, also die dallut, zur Schau. Der Dorfplatz wurde an
diesen Sonntagen also zum Platz der Armut oder der Armen. Und im
Rahmen einer nachfolgenden dialektischen Verschiebung unter den Ein-
heimischen und den zugewanderten Juden wurde daraus dann das Wort
„Dalles“, das sich dann bald für diesen Dorfplatz als Standardbegriff ein-
bürgerte.
In Urberach befindet sich der Dalles, also der Dorfplatz, vor der heutigen
Kirche. Nicht selten wird von manchen daher auch der Dalles als Kirch-
platz bezeichnet, was aber falsch ist. Denn der Dalles, also der Dorfplatz,
wo sich früher die Juden versammelten, musste sich nicht unbedingt vor
der Kirche befinden und war dann auch nicht mit dem Kirchplatz identisch.13 In Hergershausen zum Beispiel, wo früher bis zu 60 Juden lebten, gab es auch einen solchen Dorfplatz, der zugleich auch der Versammlungsplatz der Juden war und daher dann ebenfalls die Bezeichnung „Dalles“ erhielt. Dieser Dorfplatz, den es heute noch gibt und der auch weiterhin als Dalles bezeichnet wird, liegt aber nicht bei der Dorfkirche, sondern an einer an- deren Stelle mitten im alten Ortskern. Denn die Hergershausener Kirche liegt am Dorfrand. Das Wort „Dalles“ gibt es auch im sog. Rotwelsch, also der früheren Gau- nersprache. Es heißt dort „Geldverlegenheit“ oder „in Geldnöten stecken“ und leitet sich ebenfalls von dem jiddischen-hebräischen Wort „dallut“ für Armut ab. Es gibt neben diesen beiden Wortableitungen aus dem hebräischen und jiddischen Wort für Armut aber auch noch andere Wortableitungen des Begriffs „Dalles“. Mit einem Dorfplatz haben alle diese Bedeutungen des Wortes „Dalles“ aber nichts zu tun. So gab es und gibt es als inzwischen veralteten Begriff im Französischen auch das Wort „Dalles“. Es wird daher gelegentlich auch noch heute im Saarland oder in Rheinland-Pfalz bzw. in den grenznahen Regionen entlang des Rheins zu Frankreich verwendet. Das aus dem Französischen stam- mende Wort „Dalles“ bedeutet im Deutschen Fliese oder Platte oder auch in Verbindung mit einem Abflussrohr eine davor oder darüber befindliche Platte. Da aber die Dorfplätze früher aus reinem Sand oder Lehm bestanden, nicht gefliest bzw. mit Platten belegt waren und es noch keine Kanalisation gab, ist diese Wortableitung auf jeden Fall für den Dorfplatz nicht zutreffend.
14
Bulau
Nördlich von Urberach befindet sich eine heute stark bewaldete Anhöhe,
die den Namen „Bulau“ trägt; und diese Bezeichnung wurde später auch
auf die kleine an ihrer südlichen Seite liegende Wohnsiedlung mit ca. 100
Einwohnern übertragen, die zum Ortsteil Urberach gehört.
Es gibt in unserer Region zwischen Mainz, Taunus dem nördlichen Wetter-
aukreis, dem Beginn der Main-Kinzig-Tals und dem Odenwald noch einige
landschaftliche Bezeichnungen, die auf „Bulau“ oder „Bule“ lauten.
Keineswegs alle diese bis heute für diese Landschaftsbereiche
überlieferten Bezeichnungen auf Bulau haben aber denselben Ursprung.
Tatsächlich gibt es nämlich mindestens zwei unterschiedliche Herleitungen
des Wortes Bulau.
Ob zum Beispiel das heutige Wort „Bulau“ nördlich von Urberach bzw. das
Wort „Bule“ südlich von Rüsselsheim denselben Ursprung haben, ist
fraglich und muss bezüglich des Landschaftsteils südlich von Rüsselsheim
anhand historischer Akten näher geprüft werden.
Das Wort „Bulau“ bei Urberach leitet sich aber auf jeden Fall aus dem
altdeutschen Wort „Bule“ ab, zu dem dann später im Mittelalter auch die
Dialektform „Buhil“ zusätzlich ausprägt wurde. Bule bedeutet Anhöhe oder
Hügel. In der Tat besteht nördlich von Urberach eine deutlich erkennbare
Anhöhe, die den Namen Bulau trägt. Aus dem Ursprungswort „Bule“
wurde, wie durch schriftliche Quellen belegt ist, das spätere Wort „Bulau“
abgeleitet.
Aus dem Wort „Bule“ für Anhöhe oder Hügel und vor allem aus seiner
späteren Dialektform Buhil sind aber auch noch weitere heute
gebräuchliche Wörter für Anhöhe oder Hügel hervorgegangen, die
vorwiegend in Süddeutschland bzw. in Österreich gebräuchlich sind:
Bühel, Bühl oder im Allgäu auch das Wort „Bichel“.
Und in Rödermark gibt es in Urberach bezeichnenderweise die
Straßenbezeichnung „Am Eichenbühl“. Diese Straße liegt auf einer
Anhöhe, die früher offensichtlich mit Eichen bestanden war.
Im Internet wird, abgeleitet aus einer anderen Landschaftsbezeichnung
östlich von Hanau, die Behauptung aufgestellt, dass das Wort „Bulau“ für
Wald stehen würde. Diese Deutung ist jedoch falsch. Denn die Anhöhe bei
Urberach war früher keineswegs stark bewaldet. Vielmehr wurde im
Mittelalter der Wald, wie dies auch noch alte Karten zeigen, weitgehend
abgeholzt und entweder als Brennholz für die verschiedensten Handwerke
und den Haushalt als auch zur Herstellung von Teilen des Hausbaus,
insbesondere von Fachwerkhäusern, und für die verschiedensten
landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte und auch einige Haushaltsgeräte
verwendet.15 Anders sieht die historische Situation bei jenem Waldgebiet östlich von Hanau aus, das ebenfalls heute noch als Bulau bezeichnet wird. Das Wort „Bulau“ für dieses sumpfige Waldgelände östlich von Hanau, das zum Teil fälschlich als Wald gedeutet wird (auch im Internet), hat einen anderen historischen Ursprung als die Bulau bei Ubrerach. Am östlichen Rand dieses Waldsumpfgeländes verlief früher nämlich der Limes, und diese römische Grenze hatte stets einen Pfahlgraben. Pfahl wurde früher in Mitteleuropa als Pal geschrieben und ausgesprochen; wir kennen dies auch noch in dem Wort „Palisade“: Pfahlzaun oder Schanzzaun. Daraus leiteten sich dann später auch noch einige heute gebräuchliche Flurbezeichnungen oder Ortsnamen ab wie Pfalau, Pfolau, Polau oder auch Pohlheim, die alle direkt neben oder in der Nähe des früheren römischen Limes liegen. Aufgrund der Lautverschiebung bei Vokalen und der Aussprache von Konsonanten wurde aus P in mitteleuropäischem Raum oft auch ein B. Aus Polau wurde so Bolau und im Rahmen einer weiteren Verschiebung in der Aussprache wohl als Dialektform dann Bulau für das bei Hanau liegende Waldgebiet westlich des früheren Limes mit seinem Pfahlgraben. Also die Deutung als Wald ist auch hier falsch. Das für verschiedene Landschaften noch heute gebräuchliche Wort „Bulau“ zeigt somit, wie sorgfältig man jeden einzelnen Fall einer heutigen Namensbezeichnung, die auf frühere Bezeichnungen und Bedeutungen zurückgeht, in dem jeweiligen lokalen und regionalen Bezugsrahmen ermitteln muss, um zu keinen Fehlschlüssen zu kommen. Deshalb ist auch keineswegs sicher, ob das Wort „Bule“ südlich von Rüsselsheim, wo es keine größeren Anhöhen und Hügel gibt, etwas mit dem altdeutschen Wort „Bule“ für Anhöhe oder Hügel zu tun hat.
16
Fränkischer Rundling
Um zu verstehen, was ein fränkischer Rundling ist, muss man ein wenig
über die verschiedenen früheren Siedlungsformen in Mitteleuropa
Bescheid wissen, die sich wiederum von jenen Siedlungsformen in
anderen Regionen auf der Erde teilweise deutlich unterscheiden.
Siedlungsformen entstanden jeweils im Zusammenhang mit der
Sesshaftwerdung von Menschengruppen, die das vorherige Nomadentum
aufgaben und sich nun zunächst der Landwirtschaft und bald auch dem
Gartenanbau zuwandten. Je nach der Landschaftsstruktur, den
verfügbaren Materialien zum Bau von Unterkünften und den klimatischen
Bedingungen fielen die Siedlungsformen daher sehr unterschiedlich aus;
dies auch in Mitteleuropa. Allein bezogen auf das heutige Deutschland
kennen wir über zehn verschiedene Besiedlungsformen, die noch heute
vielfach in den Orten oder Siedlungszonen erkennbar sind, von den
Bauernhöfen auf den Warften (künstliche Hügel) der norddeutschen
Halligen angefangen bis hin zu den Bergdörfern, die sich an Hängen und
auf Bergterrassen am Fels entlang ziehen.
Auch der Rundling stellt eine Besiedlungsform dar, die es in mindestens
drei unterschiedlichen Varianten gibt: Eine vor allem in Schleswig-Holstein
als Fischersiedlungen an der Ostsee (zum Beispiel der Holm bei
Schleswig), eine weitere vor allem im östlichen Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und teilweise in Mecklenburg als wendischer Rundling und eine
dritte Form vor allem im mainfränkischen Raum als fränkischer Rundling.
Ihre Entstehungszeiten weichen daher ebenfalls zum Teil deutlich
voneinander ab. Das gemeinsame Merkmal aller dieser Rundlinge ist ihre
Abgrenzung nach der außen liegenden Umgebung durch die Rückwand
ihrer Häuser. Ansonsten sind sie aber recht unterschiedlich gestaltet und
auch aus unterschiedlichen Gründen entstanden. Hier soll nur der
fränkische Rundling etwas genauer beschrieben werden.
In Ober-Roden haben wir es bezogen auf den alten Ortskern mit einem
fränkischen Rundling zu tun, der in seiner Form sich offenbar ab dem
Hochmittelalter auszuprägen begann und im Laufe des 18. Jahrhunderts
seine endgültige heute noch weitgehend erhaltene Form annahm. Der
Ursprung eines fränkischen Rundlings ist zumeist ein bedeutsamer christ-
licher Bau, etwa eine bedeutsame Kirche oder auch ein Kloster. Um diesen
Bau mit dem dazu gehörenden Gelände herum gruppierten sich dann die
ersten Häuser, wobei eine kleine Gasse zwischen dem zentralen
kirchlichen Bau und der neuen Häuserreihe frei blieb. Mit der
Vergrößerung der Einwohnerzahl dieser Siedlungen wurde um diese
Häuserreihe herum, wiederum mit einer dazwischen liegenden Gasse eine
neue Häuserreihe angelegt. Und das konnte sich dann je nach
zunehmender Einwohnerzahl noch ein oder zwei weitere Male wiederholen.17 Der fränkische Rundling im alten Ortskern von Ober-Roden, der bis heute weitgehend erhalten geblieben ist, besteht aus drei um das klösterliche und später kirchliche Zentrum auf dem früheren Kirchhügel herum gebauten Häuserreihen. Dabei bildete die jeweilige nach außen gerichtete Rückseite der Häuser, zum Teil mit einigen dazwischen liegenden Mauerstücken, die Ortbegrenzung nach außen. Hier waren früher nur in den Obergeschossen kleine Fensterluken angebracht, ansonsten wirkten diese Außenseiten der Häuser wie eine Mauer. Um diese jeweils äußerste Häuserreihe herum lief ein mit Wasser gefüllter Graben, auf dessen Außenseite eine festgefügte dornige Hecke aufgepflanzt worden war. Der Name „Grabenstraße“ und die dort entlang ziehende Häuser- und Mauerreihe bis weit hinein in die Rilkestraße deuten diese frühere Situation noch heute deutlich an. Normalerweise lief durch den fränkischen Rundling nur eine Durchgangsstraße, in Ober-Roden die heutige Dieburger Straße und als Fortsetzung nach Norden die heutige Frankfurter Straße. An der Außengrenze des Ortes wurden in Steinsäulen eingelassene Falltore errichtet, die sich direkt an die Häuseraußengrenze anschlossen. Diese Falltore wurden abends herunter gelassen und morgens wieder hochgezogen. Auch im alten Ortskern von Ober-Roden gab es wegen seiner drei alten umlaufenden Straßenzüge daher früher Falltore im Norden und Süden, die von innen nach außen im Rahmen der Erweiterung des Ortes zwei Mal versetzt wurden. Diese Umwehrung des Ortes diente dazu, nachts Wolfsrudel und Wildschweine vom Ort fernzuhalten. Denn im Ort gab es natürlich viele Hühner, Schafe und Ziegen, die leicht Beute dieser bis spät in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein hier noch existierenden Wölfe werden konnten, wobei die Wildschweine noch bis heute in den umgebenden Wäldern zu Hause sind. Einen Marktplatz oder einen Kirchplatz besaßen die fränkischen Rundlinge früher zumeist nicht. Das galt so auch für Ober-Roden. Hier wurde erst nach dem Abriss einiger Häuser östlich der Kirche im Jahr 1929 anschließend ein Markplatz geschaffen. Normalerweise sind die um das Ortszentrum, also zumeist eine Kirche oder die Reste eines früheren Klosters, herumziehenden Straßen ganz geschlossen. Für Ober-Roden gilt das im südöstlichen Bereich aber nicht. Das hat einen besonderen Grund. Denn aus alten Schriftstücken und Urkunden geht hervor, dass im südöstlichen Bereich des alten Ortskerns wohl schon um 780 ein größerer landwirtschaftlicher Hof bestand, der in späteren Jahrhunderten zu einem Verwaltungsgebäude erweitert wurde und somit hier den Weiterbau der Gassen nach Südwesten und Westen zu einem geschlossenen Kreis verhinderte. Noch heute kann die Struktur des fränkischen Rundlings in Ober-Roden gut nachvollzogen werden; besonders auf der westlichen Seite mit der Rathausstraße, der Pfarrgasse, der Obergasse und der Grabenstraße.
18
Haufendorf
Die Siedlungsform des Haufendorfes ist in Mitteleuropa, und somit im
heutigen Deutschland relativ weit verbreitet. Ihren Ursprung nahm diese
Besiedelungsart überall dort, wo im Zusammenhang mit der Rodung von
Wäldern oder schon vorhandener genügend großer Freiflächen zur Betrei-
bung von Landwirtschaft die früheren Hütten und Bauernhäuser direkt bei
den Feldern und den später dazu auch angelegten Gärten erbaut wurden.
Die Bebauung in diesen Regionen erfolgte nicht nach einem festen Plan.
Vielmehr baute jeder Bauer – früher zumeist im Abhängigkeit eines
Klosters oder als Leibeigener eines Adligen – seine Hütte (denn früher
waren die Häuser kaum größer) dort, wo dies bezogen auf das
umgebende landwirtschaftliche Gebiet, das er zu bewirtschaften hatte,
ihm am sinnvollsten zu sein schein. Auf diese Weise entstand dann
allmählich ein Flickenteppich von Hütten oder auch etwas größeren
Häusern mit Scheunen und Stallungen, von denen Trampelpfade zu den
Feldern führten bzw. auch zwischen den einzelnen Hütten und Häusern
verliefen.
Erst sehr allmählich, als die Bebauungsdichte in einem entsprechenden
Gebiet zunahm, wurden die Trampelpfade zwischen den Häusern zu
kleinen meist engen Gassen ausgebaut. Irgendwo am Rande dieser
Siedlungen war zunächst auch eine christliche Kapelle, oft nur aus Holz,
erbaut worden, die nun durch eine kleine Dorfkirche ersetzt wurde. Je
nach der noch frei verfügbaren Fläche zwischen den Hütten, Häusern,
Scheunen und Stallungen wurde sie auf einem dafür verfügbaren Platz mit
einem entsprechenden umgebenden Gelände für die Gräber erbaut.
Manchmal lag die Kirche daher mehr am Ortsrand – wie etwa heute noch
in Her-gershausen – und manchmal rückte sie deutlicher in den
Siedlungsbereich hinein – wie zum Beispiel in Urberach.
Haufendörfer haben aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte daher oft eine
sehr uneinheitliche Struktur, die vor allem von den umgebenden
landschaftlichen Gegebenheiten wie Bachläufe, Teiche, Sumpfgebiete oder
leichte Hänge, Terrassen oder Hügel bestimmt wurden. Hingegen spielte
ein fester Plan – wie etwa bei den Rundlingen oder Straßendörfern bzw.
den Hufendörfern – dabei keine Rolle. Aus diesem Grunde schlängelten
sich die später angelegten Gassen daher oft auch ziemlich krumm und
verwinkelt zwischen den einzelnen Häusern, Scheunen und Stallungen
hindurch, und sind einmal etwas enger und einmal etwas weiter. Zudem
gab es in den Haufendörfern auch viele kleine Sackgassen, die vor einem
Haus endeten; in Südhessen zumeist als „Eck“ bezeichnet – so auch in
Urberach.
Dorfplätze für den Markt wurden daher fast immer auch erst später
geschaffen. Manchmal waren diese Dorfplätze mit den Kirchplätzen19 identisch, manchmal aber auch nicht. Und einige dieser Orte haben bis heute bezogen auf den alten Siedlungskern keinen Kirchplatz und einige dieser alten Haufendörfer bis heute auch keinen Dorfplatz. Bezogen auf die alte Ortskernstruktur dieser ursprünglichen Haufendörfer lässt sich daher auch nicht von einer sog. Hauptstraße sprechen, wie sie etwa für den alten Ortskern von Ober-Roden mit der nordsüdlichen Durch- gangsstraße auszumachen ist. Auch Urberach hat daher früher keine Hauptstraße gehabt, wie die alte Besiedelungsstruktur deutlich zu erkennen gibt. In Urberach hat sich aber bezogen auf den alten Ortskern die Situation schon im 19. Jahrhundert deutlich verändert. Denn zwischen 1839 und 1843 wurde mitten durch den Ort eine große breite gerade Straße erbaut, die Offenthal mit Eppertshausen auf einem kurzen Wege verbinden sollte. Diese als Chaussee bezeichnete Straße zerstörte damals nachhaltig die alte Ortsstruktur von Urberach als Haufendorf mit seinen verschlungen Gässchen, nachdem schon 1823 die alte mit einem Kirchhof umgebene Kirche von ihrem früheren Standort neben der Borngasse weiter östlich neu errichtet worden war. Nur noch zum Teil lässt sich daher die alte Dorfstruktur in Urberach erahnen, weil mit dem Bau dieser Chaussee – heute im westlichen Teil Konrad-Adenauer-Straße und im östlichen Teil Traminer Straße – auch die umgebenden Gassen zum Teil deutlich verändert wurden. Urberach hat damit bezogen auf seinen alten Ortskern ein Schicksal erlebt, wie es auch einigen anderen alten Orten ergangen ist. Nicht nur wurden in diesen Orten später ein Teil der alten Häuser abgerissen und durch mehr oder weniger zum alten Baustil unpassende moderne Häuser ersetzt. Sondern hier wurde auch ein Teil der früheren Straßenzüge im alten Ortskern deutlich verändert. Haufendörfer besaßen im Unterschied zu den Rundlingen nach außen hin keine feste Ummauerung. Sie waren über verschiedene Feldwege nach außen hin zugänglich und offen angelegt. Allerdings zäunten viele Bauern ihre nahe bei den Häusern liegenden Gärten ein, und zwar entweder durch dichte Hecken und später in Ergänzung dazu auch durch Zäune. Das war auch in Urberach der Fall und konnte hier noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein beobachtet werden. Erst mit der Erschließung neuer großer Siedlungsgebiete in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wichen diese Hecken und Zäune dann einer neuen Vorgartenkultur.
20
Begräbnisstätten, Kirchhöfe, Friedhöfe
Im Zusammenhang mit der Besiedelung in Mitteleuropa ab dem 6. und 7.
Jahrhundert n.Chr. entwickelten sich bald auch bestimmte Formen einer
christlichen Begräbniskultur, und zwar als einzeln liegende
Begräbnisstätten, als Kirchhöfe und als Friedhöfe. Alle drei Formen
kommen auch in Südhessen vor und lassen sich somit auch bezogen auf
die frühere bis heutige Geschichte von Rödermark nachweisen.
Die ältesten Besiedlungsformen in Mitteleuropa und somit auch in Süd-
hessen, die schon unter christlichem Einfluss aufgrund der
Missionierungen durch vor allem irische Mönche und entsprechende
Klostergründungen ab dem 7. Jahrhundert entstanden, bestanden oft nur
aus einzelnen Hütten, kleinen Häusern und Höfen bzw. zum Teil auch aus
etwas größeren klösterlichen und königlichen Hofstellen. Bei diesen ersten
Formen einfacher Siedlungen wurde fast immer am Siedlungsrand zumeist
eine einfache Kapelle aus Holz erbaut. Und auch die klösterlichen oder
königlichen Hofstellen, auf denen ein Gutsverwalter mit seiner Familie und
einigen Knechten und Mägden saß, hatten sich am Rande ihrer
Grundstücke kleine Kapellen erbaut; anfangs fast immer nur aus Holz, wie
auch die frühen Kirchen.
Die Begräbnisstätten der Bauern bzw. der Gutsverwalter und ihrer
Knechte und Mägde lagen zumeist ganz in der Nähe dieser Kapellen auf
einem kleinen dafür ausersehenen Stück Land. Das war anfangs ganz
offensichtlich auch so in Ober-Roden der Fall, bevor dort das
Frauenkloster wohl bald nach Gründung des Klosters Lorsch 764 errichtet
wurde. Und es galt dies offensichtlich auch noch für die ersten
Jahrhunderte so in Urberach, das vermutlich kurz nach 800 als dauerhafte
zunächst sehr kleine Siedlung entstand. Und schließlich traf dies auch auf
den ebenfalls kurz nach 800 gegründeten vermutlichen Königshof in
Messenhausen zu.
Bei den bis heute noch existierenden Gutshöfen, die von den dort oft
später wohnenden Adligen auch zu kleinen Landschlössern ausgebaut
wurden, hat sich diese Situation bis heute oft kaum verändert. Allerdings
wur-den die Kapellen im Laufe der Zeit aus Stein erbaut und auch
prächtiger ausgestattet, und die Begräbnisstätten für die Adligen wurden
nun auf dem Besitztum zu einer meist prachtvollen Begräbnisstätte oder
Gruft ausgebaut. Allerdings lassen sich inzwischen die Nachkommen vieler
früherer Landadliger heute auch auf normalen Friedhöfen in eigenen von
ihnen angelegten Grabstätten beerdigen.
Zu der Zeit, als dann die Kapellen in den Orten durch etwas größere
Kirchen am Ortsrand oder innerhalb des Ortes ersetzt wurden, änderte
sich die Situation; so auch bezogen auf Ober-Roden und Urberach. Jetzt21 wurden die Begräbnisstätten um diese Kirchen herum angelegt. Man nannte diese Begräbnisanlagen daher Kirchhöfe. In Ober-Roden befand sich der Kirchhof nach Auflösung des Klosters daher auf dem Gelände um die hier nun in mehreren Phasen erweiterte und größer gebaute Kirche herum. In Urberach befand sich ebenfalls um den alten Standort der Kirche herum neben der Borngasse (heute Teil des Rathauses) der Kirchhof. In vielen vor allem kleineren Orten, die bis heute nicht allzu stark gewachsen sind, so zum Beispiel noch in vielen ländlichen Regionen in Bayern, befindet sich nach wie vor um die Dorfkirche herum oder an ein oder zwei Seiten daran angelehnt der Kirchhof. Zwar sind manche dieser Kirchhöfe zum Teil im Laufe der Zeit erweitert worden, aber ihr Standort blieb dabei insgesamt unverändert. Und auf diesen zumeist nicht allzu großen Kirchhöfen, die fast alle mit einer Mauer umgeben sind, befindet sich an einer Seite dann auch noch das sog. Beinhaus. In diesem Beinhaus (Bein = Knochen) werden die Knochen aufbewahrt, die nach Ausräumung einzelner Grabstätten, um diese neu zu belegen, noch in der Erde verblieben waren. Friedhöfe entstanden immer erst später. Dies vor allem dann, wenn entweder die um die Kirchen herum angelegten Kirchhöfe zu klein wurden, um bei anwachsender Einwohnerzahl genug neue Begräbnisstätten zu haben, oder weil der Standort der Kirche irgendwann an einen anderen Ort verlegt wurde, so dass nunmehr auch eine neuer Platz für die Begräbnisstätten gefunden werden musste. Oft verlegte man dann den neuen Friedhof an den Ortsrand oder sogar außerhalb des Ortes. Beides war auch in Ober-Roden und in Urberach der Fall, wobei die leicht angewachsene Anzahl an Bewohnern in Messenhausen nunmehr auch auf diesen Friedhöfen beerdigt wurde. In manchen vor allem kleineren Orten liegen diese Friedhöfe, die zumeist im Verlauf des 18. oder sogar erst des 19. Jahrhunderts entstanden, noch heute am Ortsrand, so etwa in Ober-Roden. Aber sehr viel häufiger hat die Ausdehnung der Siedlungen im Laufe des 20. Jahrhunderts besonders in den Einzugsgebieten einiger Großstädte wie etwa Hamburg, Berlin, Hannover, Frankfurt, Stuttgart oder München auch dazu geführt, dass diese Friedhöfe sich inzwischen im Ortsbereich befinden; so auch in Urberach. Und in zahlreichen größeren Städten sind im Laufe der Zeit bis heute auch neue Gebiete für einen zweiten oder dritten Friedhof erschlossen worden.
22
Die Rodau von der Quelle bis zur Mündung
Über die Rodau wird vor allem viel diskutiert, wenn es darum geht ihre
Quelle zu bestimmen. Zum Teil geht es aber auch um die an der Rodau
liegenden früheren Mühlen. Die Meinungen zu diesen beiden
Gegebenheiten gehen oft weit auseinander.
In Urberach, etwas westlich des Ortsrandes gibt es bei einem
Kinderspielplatz eine gefasste Rodauquelle, auf die auch durch ein Schild
hingewiesen wird. Historisch gesehen und auch bezogen auf die
geologische und landschaftliche Struktur ist diese heutige Quellfassung
aber gar nicht identisch mit der ursprünglichen Rodauquelle. Wie so oft
liegt dem ein romantischer Gedanke zu Grunde, dass nämlich eine Quelle
immer schön in Stein gefasst sein müsse und daraus das Wasser
sprudelnd in ein darunter liegendes Becken hervor strömt. Bezogen auf
die allermeisten Bachläufe und Flüsse ist diese vor gut 250 Jahren
aufgekommene Vorstellung, die dann auch zu vielen sog.
Quellenfassungen geführt hat, schlichtweg falsch. Denn die meisten Bäche
und Flüsse sprudeln weder aus einer Steinfassung, noch aus einer deutlich
erkennbaren Felsfuge, wie man sie ab dieser Zeit in Mitteleuropa vielfach
angelegt hat. Sondern sie entwickeln sich aus einem großräumigen
Quellgebiet, das aus mehreren Gletscherabflüssen, aus verschiedenen
Talhängen oder aus verschiedenen Sumpfgebieten durch an die
Oberfläche dringende kleine Gerinne entsteht, die sich dann zumeist erst
etwas weiter unterhalb – 20 Meter bis über 500 Meter – zu einem
Bachlauf zusammenfügen. Auch auf die Rodau trifft dies in diesem Sinne
zu, die nämlich aus einem Quellgebiet der drei östlichen Hänge von
Offenthal – im Süden, Westen und Norden – weiter unterhalb, heute etwa
in Höhe des RWE-Umschaltwerkes, als Bachlauf hervorgeht. Der unterhalb
des Offenthaler Hangs existierende bis zur neu gefassten Quellfassung
führende Graben deutet das noch an. Durch den Bau des Umschaltwerkes,
der damit im Zusammenhang angelegten Kanalisation und weiterer
Drainagemaßnahmen ist es dann aber ab Anfang bis Mitte der 1960er
Jahre dazu gekommen, dass ganzjährlich nicht immer aus diesen
westlichen Quellbereichen das die Rodau bildende Wasser an die
Oberfläche tritt oder im Graben nach Osten abfließt. Ganzjährig fließt
daher seit dieser Zeit nur noch Wasser aus der südlichen Hangspalte, die
nunmehr als Rodauquelle bezeichnet wird. Tatsächlich speist sich die
Rodau aber auch noch weiterhin aus unterirdischem Sammelwasser, das
in dieser Region dann in das Bachbett der Rodau gelangt.
Die Rodau wird heute häufig mit einer Länge von ca. 27,5 km bis zur Ihrer
Mündung bei Mühlheim in den Main angegeben. Dabei wird von der heute
so bezeichneten Rodauquelle ausgegangen. Rechnet man das westlich23 davon liegende Quellgebiet aber dazu, kommt man auf eine Gesamtlänge von ca. 28,5 km. Das Gefälle der Rodau beträgt unter Einbeziehung dieses Quellgebietes ca. 61 m; ab da, wo die einzelnen Gerinne unterhalb der Hänge zusammenkommen, ca. 58 m, wenn dabei ein mittlerer Mainpegel von 101 m ü. N. an der Mündungsstelle angenommen wird. Dass ist ein Höhenunterschied, der immer wieder viele Menschen erstaunt, weil die Rodau ja durch ein flaches Gebiet, überwiegend das Urstromtal des Mains aus der letzten Eiszeit, fließt. Aber allein schon zwischen Urberach und Ober-Roden besteht ein Gefälle von deutlich mehr als 10 Metern und ähnlich verhält es sich dann beim Eintritt der Rodau in den Ort Mühlheim bis zur Mündung. Wer aber einmal aufmerksam an der Rodau an seinen vielen sichtbaren Abschnitten entlang geht, der wird immer wieder feststellen, dass es dabei in nicht selten relativ kurzen Abständen kleine Gefälle von einigen Zentimetern bis zu teilweise auch sogar 15 cm oder 20 cm gibt. Wenn man das summiert, dann wird deutlich, dass letztlich gut 61 m oder 58 m Höhenunterschied vom ursprünglichen Quellgebiet bzw. der heutigen sog. Quelle bis zur Mündung zusammenkommen. An der Rodau haben in früheren Jahrhunderten zahlreiche Mühlen gelegen, von denen einige Mühlengebäude oder deren Reste noch erhalten sind. Bereits im Spätmittelalter gab es nicht wenige Mühlen an der Rodau. Ab Beginn der Neuzeit sind dann noch einige dazu gekommen. Nachweislich, einschließlich vorhandener schriftlicher Quellen, hat es an der Rodau früher mindestens 21 Mühlen gegeben, von denen aber maximal nur 15 Mühlen zur gleichen Zeit betrieben wurden. Während nämlich einige Mühlen relativ lange betrieben wurden, sind andere Mühlen schon nach wenigen Jahrzehnten, weniger als 100 Jahren oder nach knapp 200 Jahren als Mühlen aufgegeben worden und wurden daher zum Teil auch bald danach abgerissen. In Urberach gab es zwei Mühlen, wobei die Obermühle über den Weißbach als Ableitung von der Rodau mit dieser in Verbindung stand. In Ober-Roden gab es ebenfalls zwei Mühlen, wovon die erste aber bereits im dreißigjährigen Krieg ihren Betrieb wieder einstellte. In Jügesheim gab es nach einem Dokument zu urteilen eine Mühle (Standort unbekannt), in Hainhausen gab es eine Mühle, in Weiskirchen fünf Mühlen, in Hausen zwei Mühlen, in Lämmerspiel eine Mühle und in Mühlheim sieben Mühlen. Spekuliert wird zum Teil noch darüber, ob es in Lämmerspiel eine weitere Mühle gab; und einige Personen vermuten auch jeweils eine Mühle in Dudenhofen und in Nieder-Roden. Erhalten oder teilweise erhalten sind heute noch 6 Mühlen, nämlich zwei Mühlengebäude in Mühlheim, ein Mühlengebäude in Hausen und drei Mühlengebäude in Weißkirchen. Aber nur eine Mühle davon kann heute noch mit dem alten Mahlwerk betrieben werden: Die Brückenmühle in Mühlheim.
Sie können auch lesen