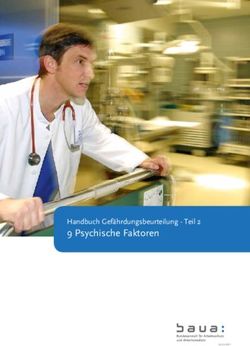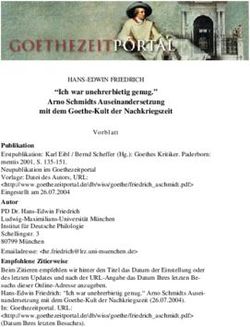Zum Antisemitismus der NPD Eine Analyse der Zeitungen von drei NPD-Landesverb nden 1998-2001 bersicht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Juliane Wetzel/ Christina Herkommer Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin Juni 2002 Zum Antisemitismus der NPD Eine Analyse der Zeitungen von drei NPD-Landesverbänden 1998-2001 Übersicht Vorbemerkung 2 Antisemitismusbegriffe 3 Antisemitische Sinngehalte 3 Verfahren der indirekten Präsentation 6 Resümee 23 Anhang 24
NPD-Antisemitismus 2
Vorbemerkung
Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, ob und ggf. inwiefern in Publikationen
der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) antisemitische Sinngehalte veröf-
fentlicht wurden.
Der hier gewählte Weg, Aufschluß über den Antisemitismus der NPD zu gewinnen, ist ein
Zugang neben anderen. Denkbar ist etwa auch ein personenbezogener Zugang, eine Unter-
suchung also von Äußerungen einzelner Mitglieder der NPD aus den letzten Jahren. Eine
weitere Forschungsstrategie besteht in der Auswertung von Vortrags- oder Schulungsver-
anstaltungen der NPD. Diese und andere Methoden wurden aus äußeren Gründen nicht
gewählt.
Für die Analyse des Antisemitismus wurden drei Publikationen der NPD aus den Jahren
1998 bis 2001 auf Landesebene herangezogen. Dies waren die Zeitungen „Zündstoff,
Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg“, die in Berlin-Brandenburg erscheint, die
„Sachsen Stimme“ aus Sachsen und die „Deutsche Zukunft“ aus Nordrhein-Westfalen.
Diese Publikationen wurden von den jeweiligen Landesverbänden der NPD verantwortet
und sind von daher eindeutig und unabhängig von einzelnen Autoren der NPD zuzurech-
nen.1
Ausgewertet wurden insgesamt 50 in Papierform verfügbare Nummern aus den vier Jahren
1998 bis 2001 und zwei im World Wide Web veröffentlichte Ausgaben. Eine Aufstellung
über die im einzelnen herangezogenen Ausgaben findet sich im Anhang.
Bei der Untersuchung der Publikationen wurde lediglich auf die antisemitischen Äußerun-
gen und Sinngehalte geachtet und auf die Erarbeitung eines umfassenden Profils der je-
weiligen Veröffentlichung verzichtet.
Für die Recherchearbeiten zu dieser Studie sei Jakob Kort gedankt. Die untersuchten Pub-
likationen wurden vom „Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin
e.V.“ (Apabiz), einem der wichtigsten Spezialarchive, gesammelt und archiviert. Wir dan-
ken für die fachliche Beratung und die Nutzungsmöglichkeiten des Apabiz.
1
Aus dem Impressum der jeweiligen Blätter: „Zündstoff ist das Mitteilungsblatt des NPD Landesverbandes
Berlin-Brandenburg“ und wird von der NPD-Landespressestelle in Berlin herausgegeben (10 (2001),
Nr. 2, S. 2); Herausgeber der „Deutsche Zukunft“ ist der NPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen mit
Sitz in Bochum (1998, Nr. 1, S. 6); die „Sachsen Stimme“ wird herausgegeben vom Landesverband
Sachsen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands mit Sitz in Leipzig (4 (1998), Nr. 1/2, S. 12).NPD-Antisemitismus 3
Antisemitismusbegriffe
Für die Bearbeitung der Untersuchungsfrage ist es erforderlich, die verwendeten Antise-
mitismus-Begriffe zu erläutern. Sie bilden den Maßstab, anhand dessen die Texte analy-
siert werden.
Gegenwärtig sind zwei Hauptbegriffe von Antisemitismus im Gebrauch.2 In einem weiten
Sinn ist Antisemitismus die Bezeichnung für vorurteilshafte Haltungen und Bewertungen,
die sich auf Juden als Juden beziehen. Dieser Begriff von Antisemitismus wird in Analogie
etwa zu „Antiamerikanismus“ oder „Antiislamismus“ verwendet und bezeichnet negative
Äußerungen über Juden, die aufgrund von starren und fehlerhaften Verallgemeinerungen
zustande kommen.
In einem engeren Sinn wird der Antisemitismus-Begriff verwendet, um eine antijüdische
Ideologie und Politik zu bezeichnen, die sich selbst ausdrücklich rassistisch begründet.
Diese Verwendung geht zurück auf die antisemitische Bewegung, die im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts entstanden war. Unter den engeren Antisemitismus-Begriff werden die
nationalsozialistischen Verbrechen an den europäischen Juden subsumiert.
Antisemitische Sinngehalte
In den untersuchten Publikationen finden sich viele Belege für beide Typen von antisemiti-
schen Sinngehalten.
Charakteristisch für die untersuchten Blätter ist die Form, in der antisemitische Gehalte
vermittelt werden. Antisemitische Sinngehalte werden ganz überwiegend indirekt präsen-
tiert. Es finden sich wenige explizite antisemitische Bekundungen. Sätze des Typs „Wenn
Deutschland erst judenfrei ist, dann brauchen wir kein Auschwitz mehr“, für den Fried-
helm Busse, der frühere Vorsitzende der verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiter-
partei (FAP) verurteilt wurde, finden sich nicht.3
Ein typisches Beispiel für die indirekt antisemitischen Aussagen ist ein Hinweis auf Do-
nuts bzw. Bagels, die in den USA verbreitet sind und zunehmend auch in Deutschland an-
2
Vgl. zum folgenden: Johannes Heil: "Antijudaismus" und "Antisemitismus". Begriffe als Bedeutungsträger,
in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 6 (1997), S. 92-114; Georg Christoph Berger Waldenegg:
Antisemitismus: Eine gefährliche Vokabel? Zur Diagnose eines Begriffs, in: Jahrbuch für Antisemitis-
musforschung 9 (2000), S. 108-126.NPD-Antisemitismus 4 geboten werden. Die beiden Gebäckbezeichnungen werden in einem Beitrag des NPD- Blattes „Zündstoff. Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg“ fälschlicherweise syn- onym gebraucht. Bei Donuts handelt es sich um ein amerikanisches süßes Feingebäck, die sowohl süß wie auch herzhaft ähnlich wie Brötchen verwendeten Bagels hingegen sind jüdischen Ursprungs.4 Diese Verwechslung allerdings ist hier insofern unerheblich, als es gilt den Tenor des Artikels zu erfassen und dessen antisemitische Konnotation zu hinter- fragen. Die Überschrift „Achtung an der Bäckertheke: Koscher durch die Hintertür“ warnt vor einem Bestandteil der jüdischen Lebenswelt und ist damit eine Warnung vor den Ju- den: „Den meisten ist dieses Erzeugnis aufgrund seines mäßigen Geschmacks hinreichend verdächtig, ein [...] aus den USA eingeschlepptes Massenprodukt zu sein, das ist auch weitgehend richtig, dennoch ist diese Backware nicht [Hervorhebung im Original] nord- amerikanischen Ursprungs. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein osteuropäisches Er- zeugnis, das jüdische Auswanderer nach Amerika brachten. Seine jüdische Vergangenheit spiegelt sich auch in der Herstellung wieder: Der Hefeteig muß einige Stunden ruhen, ge- nau die Zeit in der am Sabbat nicht gearbeitet werden darf. Erst nach Sonnenuntergang wurde der Teig geformt, in kochendes Wasser getaucht und anschließend gebacken (damit es ‚koscher‘ ist).“5 Gemeint ist hier in der Tat der Bagel, der aus Hefeteig entsteht, wobei die hier angegebene Zeit des ‚Gehenlassens‘ Unsinn ist und einmal mehr zeigt, wie mit vermeintlichen Tatsachen (impliziert wird das „Ruhen“ des Teiges von Freitag Abend bis Samstag Abend, also in der während des Schabbat einzuhaltenden Arbeitspause) eine Ver- bindung zu jüdischen Traditionen hergestellt wird. Abgesehen davon, daß auch eine „ko- schere“ Speisezubereitung ganz andere Vorschriften beinhaltet als sie hier intendiert sind, werden negative Inhalte („mäßiger Geschmack hinreichend verdächtig“ und die besondere Betonung, sie seien kein amerikanisches Gebäck, sondern eben jüdischen Ursprungs) ver- breitet, die die Juden bzw. deren Traditionen diskreditieren. Die eigentliche Botschaft bleibt implizit: Über den Umweg einer „Warnung“ vor einem Gebäck, das aus der jüdischen Kultur stammt, wird indirekt vor den Juden als Juden ge- warnt: Man soll sich von ihrer Kultur und ihrer Art des Lebens fernhalten. Die Warnung vor dem Bagel präsentiert die neorassistische These von der Unvereinbarkeit der Kulturen in der harmlosen Form einer kulturhistorischen Bemerkung über ein Gebäckstück. 3 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 12.4.2002, S. 4 4 Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 10 (2001), Nr. 2, S. 8. 5 Ebenda.
NPD-Antisemitismus 5 Die Redakteure der Blätter können auf ein Lesepublikum rechnen, das antisemitisch einge- stellt ist und auch kleinste Andeutungen und Anspielungen versteht. Diese Rezeptionsbe- dingung ermöglicht es, antisemitische Sinngehalte indirekt zu präsentieren. In den Texten selbst finden sich viele vereinzelte Elemente, die für sich allein betrachtet nicht alle eine antisemitische Bedeutung haben. In ihrer Kombination und Häufung jedoch und v.a. durch die Kontextualisierung mit Schlüsselbegriffen eines rassistischen Antisemitismus fügen sie sich zu einem antisemitischen Gesamtbild. Zu der indirekten Präsentation gehören im einzelnen die folgenden Verfahren: 1. Falsche historische Analogien und Vergleiche, die sich auf die Verfolgung und Ver- nichtung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland beziehen. 2. Fundamentaloppositionelle Polemik gegen die Erinnerung an die jüdischen Opfer des NS und Verhöhnung der Opfer. 3. Verwendung von einzelnen Schlüsselwörtern oder Wortverbindungen, die einen ras- sistischen Antisemitismus repräsentieren. 4. Kontextualisierung durch positive Erwähnung von Personen, die durch Publikationen als Leugner der Judenvernichtung bekannt sind.
NPD-Antisemitismus 6 Verfahren der indirekten Präsentation antisemitischer Sinngehalte 1. Falsche historische Analogien und Vergleiche, die sich auf die Verfolgung und Ver- nichtung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland beziehen. An erster Stelle der Themenauswahl steht hier der Themenkomplex des historischen Nati- onalsozialismus (NS) und der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Viele Beiträge sind durch eine polemische Struktur geprägt. Sie behaupten direkt oder suggerieren, die politische Praxis in der Bundesrepublik widerspreche ihrem normativen Anspruch. Die Bundesrepublik sei kein liberaler Rechtsstaat, in dem Meinungsfreiheit herrsche, sondern in Wahrheit eine Diktatur. Die sog. nationale Opposition, also die NPD und ihre Sympathisanten, würden hier unterdrückt und seien ungesetzlichen repressiven Maßnahmen ausgesetzt. Solche Artikel dienen auf der einen Seite der politischen Verteidigung der NPD angesichts der Anträge von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, die NPD für verfassungswid- rig zu erklären. Zugleich versuchen derartige Beiträge die Werte- und Rechtsordnung der Bundesrepublik zu delegitimieren. Die Bundesrepublik wurde vor dem Hintergrund der Erfahrungen eines totalitären Systems, der Führung eines Angriffskrieges und extremer Verbrechen an den Juden gegründet. Zu ihrem Selbstverständnis gehört es, eine politische Ordnung im Ausgang von unverlierbaren Individualrechten zu etablieren, die sich bewußt von jeder rassistischen oder anderen kollektivistischen Ordnung absetzt. Damit ist der An- spruch einer ethisch qualifizierten Gestaltung von Staat und Gesellschaft verbunden. Eben diese höhere Legitimität versuchen die Beiträge zu destruieren, die die politische Ordnung der Bundesrepublik auf eine Ebene mit der NS-Diktatur stellen. Sie bestreiten, daß in der Bundesrepublik eine ethisch anspruchsvollere Grundordnung als im NS herrscht und be- haupten, es handele sich lediglich um eine andere, letztlich nicht wesensunterschiedene Gesellschafts- und Herrschaftsordnung. Den Beiträgen der NPD-Hefte zufolge ist die Ordnung der Bundesrepublik nicht durch ein kategorial anderes Wertfundament und von Grund auf alternative Verfahren der politischen Willensbildung und Herrschaftsausübung charakterisiert, sondern lediglich durch einen Austausch der Herrschenden. Diese personalisierende Perspektive auf Politik und Gesell- schaft eröffnet die Möglichkeit, als Machthaber Juden oder mit Juden sympathisierende Kreise zu bezeichnen.
NPD-Antisemitismus 7 Die Rede ist bspw. von „der jüdisch-amerikanischen Protektoratsregierung in Deutsch- land“6 oder ein diskreditierender Vergleich wird gezogen: „Die deutsche Regierung, samt Opposition, verhalten sich wie Marionetten einer jüdisch-amerikanischen Protektoratsre- gierung über Deutschland!“7 Hier zeigt sich deutlich die inhaltliche Vernetzung zum inter- nationalen Rechtsextremismus, dessen einigendes Moment der Antisemitismus wegen Auschwitz ist (also die Verharmlosung bis hin zur Leugnung des Genozids an den Juden) und der nicht nur die USA, sondern auch Deutschland als „Zionist Occupied Government“ (ZOG) versteht.8 Vergleiche zwischen der Situation der Juden unter der NS-Herrschaft mit aktuellen Re- pressionen gegen Rechtsradikale bestreiten implizit den konstitutiven Zusammenhang zwi- schen dem rassenantisemitischen Programm der NSDAP und den Verbrechen an den Ju- den. Solche falschen Analogien und Selbstdarstellungen des „nationalen Widerstands“ negieren implizit, daß die Juden als rassistisch definiertes Kollektiv verfolgt wurden und nicht als politische Gegner des NS. Dies ist keine aktive Propagierung eines rassenantise- mitischen Standpunkts aber sehr wohl eine implizite Leugnung der historischen Fakten. Von einem antisemitischen Sinngehalt ist auch dann zu sprechen, wenn nicht aktiv Vorur- teile gegen Juden oder rassistische Ideologien vorgetragen werden, sondern im Medium der Beurteilung historischer Ereignisse antisemitische Ideologien und Motive neutralisiert, geleugnet bzw. verteidigt werden. Die Repression gegen Rechtsradikale in der Bundesrepublik wird in den untersuchten Publikationen sprachlich mit der Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten ana- logisiert. Dies geschieht etwa in einem Artikel mit der Überschrift „Fanatische Verfolgung rechter Patrioten“ mit dem Untertitel „Sondergesetze und Sonderbehandlung“.9 Durch die Verwendung der Wörter „Sondergesetze“ bzw. „Sonderbehandlung“ wird suggeriert, die Rechtsradikalen würden heute in der Weise verfolgt wie die Juden im NS. „Sonderbe- handlung“ bedeutete in der nationalsozialistischen Sprache nicht – wie heute im allgemei- nen Sprachgebrauch – eine privilegierte und die betreffende Person bevorzugende Be- 6 Deutsche Zukunft 10 (1998), S. 20. 7 Deutsche Zukunft 10 (1998), S. 18. 8 Vgl. Juliane Wetzel: Die Leugnung des Genozids im internationalen Vergleich, in: Brigitte Bailer-Galanda et al. (Hrsg.), Die Auschwitzleugner, Berlin 1996, S. 52-72; dies.: Antisemitismus. Ideologische Grundlage und Bindeglied des Rechtsextremismus, in: Handbuch deutscher Rechtsextremismus, hrsg. v. Jens Mecklen- burg, Berlin 1996, S. 692-708; dies.: Rechtsextreme Propaganda im Internet. Ideologietransport und Vernet- zung, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Auf dem Weg zum Bürgerkrieg? Rechtsextremismus und Gewalt gegen Fremde in Deutschland, Frankfurt a.M. 2001, S. 134-150. 9 Deutsche Zukunft 6 (1998), S. 23.
NPD-Antisemitismus 8
handlung.10 „Sonderbehandlung“ war das zynische Codewort für Exekutionen. In der Pra-
xis bezog sich die „Sonderbehandlung“ auf Juden, Partisanen, sowjetische Kriegsgefange-
ne, polnische Zwangsarbeiter und andere Gruppen. Die Anwendung auf heutige Rechtsra-
dikale ist zunächst eine unzutreffende, geradezu infame historische Parallele und zweitens
eine indirekte Negierung der rassenideologischen Ursachen der Verfolgung der Juden und
der anderen o.g. Gruppen.
Die Geltung von Menschenrechten in der Bundesrepublik wird dadurch bekräftigt, daß die
NS-Gewaltverbrechen am Maßstab der Menschenrechte gemessen und als Unrecht verur-
teilt werden. Darüber hinaus wird der Opfer der Rassenpolitik in Gedenkveranstaltungen
und an Gedenkorten posthume Achtung entgegengebracht. Schließlich wird im Gedenken
an die Opfer der konstitutive Zusammenhang der rassistischen Unrechtsordnung des NS
und der Opfer betont.
Umgekehrt bedeutet die Erinnerung an die Judenvernichtung immer auch eine nachträgli-
che Delegitimierung des NS und – allgemeiner – aller an ihn anknüpfenden Gesellschafts-
und Staatskonzepte, die von der Unvereinbarkeit oder der Ungleichwertigkeit verschiede-
ner ethnischer, kultureller oder politischer Kollektive ausgehen.
Die Erinnerung an die jüdischen Opfer des NS betrifft also nicht lediglich die vergangene
Geschichte, sie ist auch ein Medium, in dem aktuelle Wertmaßstäbe bekräftigt und Fragen
nach der Legitimität beantwortet werden. Vor diesem Hintergrund einer Verbindung der
Erinnerungskultur mit aktuellen Fragen nach politischer Legitimität sind die vielen Beiträ-
ge in den NPD-Blättern zu verstehen, die sich polemisch und abschätzig auf die Erinne-
rung an die NS-Verbrechen in den letzten 25 Jahren beziehen.
Kritik an der Gedenkkultur oder auch Polemik gegen die Erinnerungskultur ist als solche
nicht antisemitisch. Die polemische Formel vom „Fetisch Holocaust“ kann sowohl in ei-
nem konstruktiv-kritischen Zusammenhang gebraucht werden wie in einem fundamenta-
listisch-oppositionellen.11
Antisemitisch ist die Thematisierung der Gedenkkultur, wenn die Beschreibung und Be-
wertung der Verbrechen in ihrem inneren Zusammenhang mit der rassistischen Ordnung
10
Vgl. Joseph Wulf: Aus dem Lexikon der Mörder. "Sonderbehandlung" und verwandte Worte in national-
sozialistischen Dokumenten, Gütersloh 1963; Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozia-
lismus, Berlin 1998, S. 584-587.
11
Ein Beispiel für den ersten Verwendungskontext: Richard Chaim Schneider: Fetisch Holocaust. Die Ju-
denvernichtung - verdrängt und vermarktet, München 1997. Ein Beispiel für den zweiten Argumentati-
onszusammenhang: Die Besprechung des Buches von Schneider im Vergleich mit der antisemitischen
Schrift von Wolfgang Frenz: Der Verlust der Väterlichkeit oder Das Jahrhundert der Juden in „Deutsche
Zukunft“ 1 (1998), S. 19. Der Autor Schneider wird in dieser Besprechung „Simon R. Chaim Schnei-
der“ genannt.NPD-Antisemitismus 9
eingeschränkt werden oder den Opfern die gebührende Achtung durch respektlosen
Sprachgebrauch entzogen wird.
Eine Reise von Jörg Haider in die USA und die Rolle von Peter Sichrovsky in der FPÖ
bewertet ein Autor als klugen taktischen Zug. Dabei zitiert er einen ungenannten Journa-
listen mit der Bemerkung: „Wenn Haider in den USA akzeptiert wird, dann akzeptieren ihn
auch die Österreicher.“12 Im Anschluß daran heißt es: „In seinem Umgang mit einflußrei-
chen Amerikanern versteht Haider die Juden jetzt besser als früher. Er weiß, daß der Holo-
caust zum Tummelplatz für Menschen wie Edgar Bronfman und dem [sic!] World Jewish
Congress geworden ist, die zwar in Deutschland noch einflußreich sind, deren Bedeutung
aber im Gesamtspektrum des Judentums abnimmt und auch innerhalb der Judenheit Geg-
ner findet, die Angst vor dem Tag haben, wo sich die Holocaust-Legende in schallendem
Gelächter der Welt auflösen wird.‘[sic!]“13 Unabhängig, ob es sich bei dem letzten Zitat
aus „Deutsche Zukunft“ um ein Zitat des unbekannten Journalisten handelt (das schlie-
ßende Anführungszeichen läßt diese Möglichkeit zu) oder nicht – die Formulierung „Holo-
caust-Legende“ gehört zu den Termini, mit denen die historischen Fakten in Zweifel gezo-
gen werden.
In einer Polemik gegen den „jüdische[n] Zugriff auf die deutsche Industrie, Banken und
Versicherungen“ wird die negationistisch/revisionistische These direkt vertreten: „Nach
dem Leuchter-Gutachten wissen eigentlich alle interessierten Chemiker, Physiker und Po-
litiker, selbstverständlich auch die Zionisten, daß sich Cyklon [richtig: Zyklon] B nicht zur
industriellen Tötung von Menschen eignet.“14 Die Behauptung einer generellen Unmög-
lichkeit wird für den historischen Fall konkretisiert: „Diese Leute, allgemein Revisionisten
genannt, kämpfen mit wissenschaftlichen Mitteln gegen die Vergasungsbehauptung, dass
Cyklon [richtig: Zyklon] B zur Menschenvernichtung eingesetzt wurde.“15
Das hier zitierte Gutachten („Leuchter-Report“)16 des vermeintlichen amerikanischen Gas-
kammerspezialisten, Fred A. Leuchter, rekuriert wie andere ähnliche pseudowissenschaft-
liche Gutachten (Germar Rudolf17, Walter Lüftl) darauf, daß nach forensischen Untersu-
12
Deutsche Zukunft 2 (1998), S. 20.
13
Deutsche Zukunft 2 (1998), S. 20.
14
Deutsche Zukunft 10 (1998), S. 17.
15
Deutsche Zukunft 10 (1998), S. 17.
16
Zur Auseinandersetzung damit vgl.: Amoklauf gegen die Wirklichkeit. NS-Verbrechen und „revisionisti-
sche Geschichtsschreibung, hrsg. v. Bundesministerium für Unterricht und Kunst [Öster-
reich]/Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Wien 1991, S. 41-70.
17
Germar Rudolf, Gutachten über die Bildung und Nachweisbarkeit von Cyanidverbindungen in den „Gas-
kammern“ von Auschwitz, 1992 im Eigenverlag; Der sogenannte Lüftl-Report wurde von Walter Lüftl,
- bis 1992 Präsident der österreichischen Bundesingenieurskammer - verfaßt. Lüftl leugnet in dem Be-
richt, der erstmals 1991 in der neonazistischen österreichischen Zeitschrift „Halt“ veröffentlicht wurde,
die Existenz von Gaskammern zur Ermordung von Menschen in den NS-Vernichtungslagern.NPD-Antisemitismus 10
chungen dieser angeblichen Spezialisten, massenhafte Vergasungen von Juden allein aus
technischen Gründen nicht möglich gewesen sein können und somit der Genozid an den
Juden eine Lüge sei. Diese Machwerke werden als Meilensteine in der rechtsextremen
Szene gefeiert und entsprechend als codierte Termini verwendet, deren tatsächlicher Hin-
tergrund im rechtsextremen Spektrum eindeutig synonym für die Leugnung des Holocaust
steht.
Strategien indirekter positiver Rezeption der Holocaust-Leugnung manifestieren sich auch
in der Heroisierung von Personen, die über ihre publizistische Tätigkeit, Vorträge und
Kontakte eindeutig als Negationisten/“Revisionisten“ positioniert sind. In der Postille
„Zündstoff“ wird auf die „NPD-Großveranstaltung in Fürstenwalde“ im April 2000 hinge-
wiesen, auf der dem „Publizisten, Buchautor und österreichischen Nationaldemokraten
Herbert Schweiger“ der „Emil-Maier-Dorn-Preis“ verliehen wird. Emil Maier-Dorn war
Mitbegründer der NPD und wird als Neonaziikone idealisiert, Schweiger gehört zu den
Führungsfiguren des österreichischen Rechtsextremismus, arbeitet immer wieder mit dem
österreichischen Holocaust-Leugner Gerd Honsik zusammen, tritt als Referent bei der
„Gesellschaft für freie Publizistik“ auf, die vom Verfassungsschutz als führende rechtsex-
treme Kulturvereinigung eingestuft wird, und wurde 1990 in Graz als Verfasser der Bro-
schüre „Das Recht auf Wahrheit – Die Hintergründe des Falles Bronfman-Waldheim“ we-
gen NS-Wiederbetätigung (Leugnung des Holocaust) vor Gericht gestellt und zu einer
Haftstrafe verurteilt. Verschiedene seiner Schriften sind in der Bundesrepublik und auch in
Österreich indiziert.18 Laudator für den Preisträger Schweiger war – laut „Zündstoff“ ─ im
übrigen Wolfram Nahrath, der ehemalige „Bundesführer“ der Wiking-Jugend (bis zu ihrem
Verbot 1994) und einstiges Mitglied der ebenfalls verbotenen Freiheitlich Deutschen Ar-
beiterpartei.19
Eine erst in den letzten Jahren in rechtsextremen Kreisen angewendete Form der Diskredi-
tierung der NS-Judenverfolgung ist die Kontextualisierung von Bildern als Fälschung. Dies
wurde im Rahmen der Wehrmachtsausstellung virulent, bezieht sich aber auch auf alliierte
Luftaufnahmen von Konzentrationslagern etc. So bedient sich auch „Zündstoff“ eines sol-
chen Mechanismus, wenn das Blatt unter der Überschrift „Das Bild der brennenden Syn-
agoge ist eine plumpe Fotomontage“ das weit verbreitete Foto der brennenden Hauptsyn-
18
Vgl. Brigitte Bailer-Galanda u.a. (Hrsg.), Wahrheit und „Auschwitzlüge“. Zur Bekämpfung „revisionisti-
scher“ Propaganda, Wien 1995, S. 199, S. 283f.
19
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 7 (2000), S. 7.NPD-Antisemitismus 11
agoge in der Berliner Oranienburger Straße als Fälschung diskreditiert.20 Es ist längst be-
kannt, daß dieses Foto nicht die Folgen der „Reichskristallnacht“ dokumentiert, sondern
eine Aufnahme nach einem Bombenangriff im Februar 1943 darstellt. Während des No-
vemberpogroms hatten SA-Leute im Vorraum Feuer gelegt, aber das Gebäude war nur
geringfügig beschädigt worden. In der Folgezeit wurde das Gotteshaus zu einem Bunker
umfunktioniert und dafür eine Betondecke eingezogen, die erst in den 90er Jahren entfernt
werden konnte. Mit dem Fälschungsvorwurf werden die gewalttätigen Übergriffe auf die
jüdische Bevölkerung und deren Einrichtungen während des 9. Novembers insgesamt in
Frage gestellt.
20
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 1 (1999), S. 8.NPD-Antisemitismus 12
2. Fundamentaloppositionelle Polemik gegen die Erinnerung an die jüdischen Opfer des
NS und Verhöhnung der Opfer
„Holocaust“ ist als Name für ein singuläres Ereignis, eben die systematische Vernichtung
der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten üblich geworden. Die besondere
Qualität dieses Verbrechens wird geleugnet, wenn „Holocaust“ nicht mehr als Name, son-
dern als Gattungsbegriff auch zur Bezeichnung anderer Verbrechen verwendet wird.21
Dies geschieht etwa, wenn das Buch „Der Vertreibungsholocaust“ von Rolf-Josef Eibicht
und Anne Hipp als „hervorragend“ bewertet wird22 oder Eibicht selbst in der „Sachsen
Stimme“ mit diesem Begriff operiert: „Ich klage an! Der Vertreibungsholocaust am deut-
schen Volk - ein Jahrtausendverbrechen! Zur beabsichtigen [sic!] Endlösung der deutschen
Frage in Ost-, Südost- und Mittelosteuropa.“23 Darüber hinaus verwendet Eibicht nicht nur
den Terminus „Holocaust“ im Zusammenhang mit der Vertreibung und verharmlost durch
diesen unlauteren Vergleich den Genozid an den Juden während der NS-Zeit, sondern er
operiert auch mit dem Begriff „Endlösung“, der in der NS-Terminologie singulär für den
Mord an den Juden stand und bis heute einzig in diesem Zusammenhang Verwendung fin-
den kann.
Auch die bagatellisierende Verkürzung des Wortes „Holocaust“ zu „Holo“ bedeutet eine
Negierung der tatsächlichen Bedeutung der NS-Gewaltverbrechen und eine Verhöhnung
der Opfer.24 Die Blätter schließen mit diesem Sprachgebrauch an die antisemitische Praxis
von NPD-Veranstaltungen an.25 In ähnlicher Weise entwertet die Bezeichnung „Bundes-
schamanlage“ für das geplante Holocaust-Mahnmal die Opfer der rassistischen Verfolgung
und Vernichtung.26
In diesem despektierlichen Zusammenhang steht auch die Bezeichnung des geplanten Ho-
locaust-Mahnmals in Berlin als „Reichsopferfeld“.27 Einmal wird damit der nazistische
Sprachgebrauch karikiert, der triviale Einrichtungen wie ein Sport-Stadion („Reichssport-
feld“) in einer bombastischen Terminologie zu Stätten höherer Weihe stilisierte. Die Be-
21
Eine generalisierte Verwendung von „Holocaust“ zur Bezeichnung von Großverbrechen und zur Anpran-
gerung von Mißständen findet sich nicht nur bei der NPD.
22
Deutsche Zukunft 10 (2000), S. 18f.
23
Sachsen Stimme 2 (2000), http://www.npd-sachsen.de/sachsenstimme/20013.htm.
24
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 3 (2000), S. 9.
25
Vgl. Wolfgang Benz: Realitätsverweigerung als antisemitisches Prinzip: Die Leugnung des Völkermord,
in: ders. (Hrsg.): Antisemitismus in Deutschland. Zur Aktualität eines Vorurteils, München 1995, S.
138.
26
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 3 (2000), S. 9.
27
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 2 (1999), S. 11.NPD-Antisemitismus 13
zeichnung des Holocaust-Mahnmals als „Reichsopferfeld“ besagt, daß auch das Holocaust-
Mahnmal eine ähnlich überwertige Bedeutung beanspruche. Als besondere Infamie muß
man die Tatsache werten, daß gegen eine Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus
mit NS-analogen Titulierungen polemisiert wird.
Eine Verhöhnung der jüdischen Opfer und eine fundamentaloppositionelle Persiflage auf
die pädagogische Auseinandersetzung mit dem NS stellt das im folgenden zitierte Gedicht
in Verbindung mit einer fingierten Arbeitsanweisung für Schüler dar.28 Das Gedicht und
die Arbeitsanleitung finden sich auf einer Seite mit der Überschrift „ + + + die sati(e)rische
Seite + + +“.
„Ort des Grauens
Es sprach die Apfel - zur Mandarine,
Entsetzen stand in ihrer Miene :
‚Der Feind steht schon am Vorratsschrank
und zieht das Küchenmesser blank.
Von Gemetzel hört man, und
Gerüchte eil’n von Mund zu Mund.‘
Den Spargel habe man gequält,
brutal von Kopf bis Fuß geschält.
Kartoffeln wurden kleingehäckselt,
Stigmatisierte vorher ausgewechselt.
Die Gurke hieb man roh in Scheiben,
um dann den Porree zu entleiben.
Dann ward auch noch der Tisch gedeckt.
Das hat das Grünzeug aufgeschreckt !
Klammheimlich schlich es sich von dannen,
entfloh dem Tod in heißen Pfannen.
Die Möhre, die im Schrank geblieben,
ward vom Gegner aufgerieben.“
Rechts neben diesen Zeilen findet sich eine fiktive Arbeitsanleitung:
„Aufgabenstellung für Schüler der 9. oder 10. Klasse in Politik - und Sozialkunde
Analysieren Sie das nebenstehende Werk :
Welche Parallelen zur jüngeren deutschen Geschichte tun sich Ihnen auf ?
An welcher Stelle des Werkes stellt sich bei Ihnen erstmals persönliche Betroffenheit ein ?
Warum haben die Opfer erst so spät ihre Lage als Bedrohung wahrgenommen ?
28
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 7 (2000), S. 11. Beide Texte werden hier mit
allen orthographischen Eigenheiten des Originals wiedergegeben.NPD-Antisemitismus 14 Welche Erklärung haben Sie für das tragische Verhalten der Möhre ? Wie kann angesichts der geschehenen Barbarei eine angemessene Erinnerungsarbeit aus- sehen ? Mit welchen Gefühlen werden Sie künftig in eine Küche hineingehen ? Arbeiten Sie heraus, weshalb dieses Massaker nur in einer deutschen Küche vorstellbar ist. Welche Entschädigung für die Überlebenden erscheint Ihnen angemessen ?“ Die Kombination der fingierten „Aufgabenstellung für Schüler“ mit dem Gedicht „Ort des Grauens“ läßt die Vorgänge in einer Küche als Beschreibung der Verfolgung in einer Dik- tatur lesen. Schlüsselwörter und Spezifizierungen aus der „Aufgabenstellung“ stellen eine Verbindung zum NS her („Parallelen zur jüngeren deutsche Geschichte“, „Massaker“, spe- zifisch deutsche Entwicklung), andere Begriffe verweisen auf die intensive Auseinander- setzung mit dem NS („persönliche Betroffenheit“, „Erinnerungsarbeit“). Die Kombination dieser beiden Texte ist nach einer Seite eine Persiflage der historischen Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem NS, wie sie seit den achtziger Jahren prakti- ziert wurden. Nach der anderen Seite ist es eine Verhöhnung der Opfer: Das Gedicht macht sich über einfältiges Gemüse lustig, das seine Zubereitung als Nahrung nicht als Folge sei- ner eigentlichen Zweckbestimmung versteht, sondern als Angriff eines Gegners. Die Opfer der NS-Diktatur, darunter als größte Opfergruppe die Juden, werden in dieser Analogie dehumanisiert: Die Opfer werden als Gemüse betrachtet. In dieser Perspektive war ihre Ermordung kein Gewaltverbrechen, sondern ein selbstverständliches Geschehen, das ihrer Bestimmung entsprach. Das Gedicht und die „Aufgabenstellung“ heben die jüdischen Opfer nicht hervor; als Opfer des NS sind sie aber in die depersonalisierende Interpretation integriert.
NPD-Antisemitismus 15
3. Verwendung von einzelnen Schlüsselwörtern oder Wortverbindungen, die einen ras-
sistischen Antisemitismus repräsentieren
In der Verwendung von bestimmten Signalwörtern dokumentiert sich der generelle wie der
spezifische Antisemitismus.
Der generelle Antisemitismus, die Zuschreibung von negativen Eigenschaften an die Juden
als Kollektiv, wird symbolisiert in Begriffen, die ihnen die entscheidende Macht über Völ-
ker und Staaten zuschreiben. Dies steht in der Tradition antijüdischer Verschwörungstheo-
rien.
„Man beschuldigt nationales Bestreben gern als Ursache von Krieg und Elend. Wer aber
sieht, daß überstaatliche Mächte sich seiner geschickt bedienen, um die Nationen über-
haupt zugrunde zu richten?“ 29
Die Rede ist von „jüdischen Internationalisten“ oder von den „Führer[n] des Weltzionis-
mus“, deren „Haupteintreiber von Schutzgeldern der Schatzmeister des Jüdischen Welt-
kongresses in New York, Singer, und der Präsident Bronfman“ seien.30 Im Zusammenhang
mit der Diskussion über die Entschädigung von früheren NS-Zwangsarbeitern wird pole-
misch gefragt: „Stellt sich hier bei einem normal denkenden Deutschen nicht unwillkürlich
die Frage, ob die BRD-Politiker eigentlich noch die Interessenvertreter des Deutschen
Volkes sind ... oder aber operieren sie als Gehilfen eines weltweit agierenden Konsortiums,
das eine Art ‚Schutzgeld‘ fordert?“31
In einer Reihe weiterer sprachlicher Formeln dokumentiert sich die Vorstellung eines über-
ragenden jüdischen Einflusses auf die Medien, die Wirtschaft und die Politik. Dazu gehö-
ren: „Weltzionismus“32, „Diktatur der Hochfinanz“33, „internationale Hochfinanz“34 oder
„internationales Großkapital“35. Sie repräsentieren die Vorstellung einer Verschwörung der
Juden gegen andere Völker.
29
Deutsche Zukunft 10 (2001), S. 5. Als Quelle dieses Zitats wird Emil Maier-Dorn angegeben. Maier-Dorn
(+) gehörte zu den Mitarbeitern des Deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes, Österreich (DKEG).
Vgl. dazu: Stiftung Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Handbuch des
österreichischen Rechtsextremismus, Wien 1993, S. 127f. In den hier untersuchten Publikationen wird
er auch als Urheber einfältiger Kalauer zitiert (Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg
3 (2000), S. 9.
30
Deutsche Zukunft 1 (1999), S. 5.
31
Deutsche Zukunft 8 (2000), S. 7.
32
„Führer des Weltzionismus“ in: Deutsche Zukunft 1 (1999), S. 5.
33
Deutsche Zukunft 12 (1999), S. 18.
34
Sachsen Stimme 8 (1998), S. 7.
35
Sachsen Stimme 7 (1998), S. 1.NPD-Antisemitismus 16
Zu der Kontextualisierung polemischer Ausführungen zur Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit durch rassenantisemitische Schlüsselbegriffe gehört die Verwendung des
Wortes „Wirtsvolk“.
In einer Polemik gegen Wiedergutmachungszahlungen an Israel wird auf die These von
Michael Wolffsohn Bezug genommen, die deutschen Zahlungen an Israel würden sich
auch ökonomisch „lohnen“. Dem hält der Text die Schlußfrage entgegen: „Eine Gegen-
rechnung wagt keiner aufzumachen, es sei denn, er nimmt den Vorwurf, ein Antisemit zu
sein, gelassen hin. Die Gegenrechnung müßte danach lauten: wie hoch sind die Vermö-
genswerte und Reichtümer, die Juden in aller Welt ihren Wirtsvölkern abgepreßt haben?“36
In den antisemitischen Ideologien des 19. und des 20. Jahrhunderts gehörte das Wort
„Wirtsvolk“ und sein Bedeutungsfeld zu der rassistischen Gegenüberstellung von Juden
und anderen Völkern. Aus der Biologie wurde die Unterscheidung zwischen Wirten und
Parasiten übernommen. Der antisemitischen Interpretation dieses Verhältnisses zufolge
sind „die Juden“ Parasiten, die sich in anderen Völkern, den sog. Wirtsvölkern einnisten
und diese aussaugen. Das Bild vom Juden als Schmarotzer gehörte zum festen Sprach-
gebrauch der NS-Rassenpolitik:
- In Hitlers „Mein Kampf“ heißt es über „den Juden“: „Er ist und bleibt der ewige Parasit,
der Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur
ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung seines Daseins aber gleicht ebenfalls
der von Schmarotzern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit
ab.“37
- Goebbels beschimpfte „die Juden“ in der Zeitung „Das Reich“ mit den Worten: „Die Ju-
den sind eine parasitäre Rasse“.38
Eine bekannte Visualisierung der vermeintlichen Parasiten findet sich in dem von Goeb-
bels in Auftrag gegebenen Propagandafilm „Der Ewige Jude“. Hier wird die Migration von
Juden ausdrücklich mit der Ausbreitung der Wanderratte verglichen. Das Begriffspaar
„Wirtvolk - Parasit“ gehört zum begrifflichen Gerüst der einschlägigen Szene. Ausdrück-
lich wird dies im Film durch den dehumanisierenden Kommentar aus dem Off formuliert:
„Eine verblüffende Parallele zu dieser jüdischen Wanderung durch die ganze Welt bieten
uns die Massenwanderungen eines ebenso ruhelosen Tieres, der Ratte. Die Ratten beglei-
ten als Schmarotzer den Menschen von Anfang an. [...] Wo Ratten auftauchen, tragen sie
36
Deutsche Zukunft 9 (1998), S. 9. Dieses Wort findet sich auch in einem Beitrag über jüdische Zuwanderer
aus Rußland in: Deutsche Stimme 9/10 (1998), S. 2.
37
Adolf Hitler: Mein Kampf (660. Aufl.), München 1941, S. 334.
38
Zitiert nach: Karl-Heinz Brackmann/Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. "Selbstverständliche" Begriffe und
Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus, Straelen 1988, S. 143.NPD-Antisemitismus 17
Vernichtung ins Land [...]. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in gro-
ßen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdi-
schen Zerstörung dar, ... nicht anders als die Juden unter den Menschen. Das Parasitenvolk
der Juden stellt einen großen Teil des internationalen Verbrechertums.“39
Es ist typisch für den andeutenden Stil indirekter Aussagen, daß mit dem Wort „Wirtsvolk“
nur ein Element der traditionellen rassenantisemitischen Unterscheidung expliziert wird.
Bezeichnenderweise fehlt in dem Zitat aus der „Deutschen Zukunft“ das Pendant „Parasit“.
Gleichwohl hat diese Textstelle einen rassenantisemitischen Sinn; das Begriffspaar
„Wirtsvolk - Parasit/Schmarotzer“ hat einen festen Platz im kulturellen Gedächtnis, so daß
es für seine Aktualisierung ausreichend ist, ein Glied dieser Kontrastierung zu benennen,
um das andere beim Rezipienten zu evozieren.
Eine unverblümt nazistische Sprache wird verwendet, wenn die Kennzeichnungspraxis des
NS-Staates wiederholt wird.40 Dies geschieht etwa in „Deutsche Zukunft“ 1998: Unter der
Überschrift „Philosemitismus und Zionismus“ heißt es: „Der Philosemitismus in unserem
Land nimmt immer größere Dimensionen an. Ignaz Israel Bubis wird in Solingen zu einem
Säulenheiligen, nachdem er vor der Volkshochschule einen Vortrag [...] halten konnte.“41
Das NPD-Blatt stellt sich damit in die Tradition der nazistischen Judenverfolgung: 1938
wurde festgelegt, daß die als Juden definierten Personen nur solche Vornamen führen
durften, die in den Richtlinien des Reichsinnenministeriums über die Führung von Vorna-
men enthalten waren.42 Andernfalls mußten Männer ihren Vornamen durch den Namen
„Israel“ und Frauen den ursprünglichen Vornamen durch den Zusatznamen „Sara“ ergän-
zen. Die Verordnung verfolgte die Absicht, Juden allein anhand ihrer Vornamen identifi-
zieren zu können und sie zu stigmatisieren.
39
Stig Hornshöj-Möller: "Der ewige Jude". Quellenkritische Analyse eines antisemitischen Propagandafilms,
Göttingen 1995, S. 84-88. Es handelt sich um Sequenz 14 und 15 des Films.
40
Vgl. zum folgenden: Uwe Dietrich Adam: Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972, S. 170f.; vgl.
auch: Dietz Bering: Kampf um Namen. Bernhard Weiß gegen Joseph Goebbels, Stuttgart 1991, S. 387.
41
Deutsche Zukunft 1998, Nr. 4/5, S. 16.
42
Vgl. „Zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vorna-
men“ vom 17.8.1938; vgl. dazu Adam, Judenpolitik (Anm. 40), S. 170f.NPD-Antisemitismus 18
4. Kontextualisierung durch positive Erwähnung von Personen, die als Leugner der Ju-
denvernichtung bekannt sind
Zur Kontextualisierung der bislang dargestellten indirekten Äußerungen gehört die zu-
stimmende Zitierung oder Benennung von Personen, die für ihre rechtsradikale Position im
allgemeinen oder ihre Leugnung der Judenvernichtung bekannt sind („Revisionis-
ten“/Negationisten). Durch positive Berichte über einschlägige Vortragsveranstaltungen
oder andere lobende Erwähnungen wird indirekt auch die entsprechende politische Position
hervorgehoben. Zustimmend erwähnt werden etwa die folgenden, einschlägig bekannten
Personen:
Die „Sachsen Stimme“ berichtete über eine Vortragsreise des Schweizers Bernhard
Schaub im Mai 2000.43 Unter der Überschrift „Bewährter Schweizer Freund gab in Sachsen
eine Einführung in die germanische Mythologie“ schreibt Wolfgang Schüler, wie er „unse-
ren Schweizer Freund Bernhard Schaub“ zu seinem Vortrag begleitete. „Dem Bild vom
Einheitsmenschen stellte Schaub das organische Menschenbild der germanischen Mytho-
logie entgegen ...“. Abschließend heißt es: „Man weiß nicht, wem man mehr danken soll,
Bernhard Schaub oder den aufmerksamen Zuhörern der drei sächsischen Verbände, vor-
bildhaft für unser Land.“
Bernhard Schaub, geboren 1954, gehört zu den Schweizer Leugnern der Judenvernich-
tung.44 1992 hatte er das Buch „Adler und Rose“ veröffentlicht, in dem er ohne Distanzie-
rungen die These des sog. Leuchter-Reports referierte: „Er [gem.: Fred Leuchter] zeigt sich
darin überzeugt, daß Vergasungen in keinem dieser Lager [NS-Vernichtungslager] stattge-
funden haben können.“45
1994 wurde in Zürich von Schweizer Negationisten die „Arbeitsgemeinschaft zur Entta-
buisierung der Zeitgeschichte (AEZ)“ gegründet.46 Schaub gehörte zu den Mitarbeitern
dieser AEZ. Zwischen April und September 1994 verschickte die AEZ an rd. 6.000 Emp-
fänger ein Rundschreiben mit dem Titel „Zurück ins Mittelalter?“ Zu den vier Autoren
dieses Textes gehörte auch Schaub.47 In diesem Rundschreiben heißt es:
43
http://sachsenstimme.de/3008.htm
44
Vgl. Urs Altermatt/Hanspeter Kriesi: Rechtsextremismus in der Schweiz. Organisationen und Radikalisie-
rung in den 1980er und 1990er Jahren, Zürich 1995, S. 66-75; Peter Niggli/Jürg Frischknecht: Rechte
Seilschaften. Wie die "unheimlichen Patrioten" den Zusammenbruch des Kommunismus meisterten, Zü-
rich 1998, S. 653-701.
45
Zitiert nach: Niggli/Frischknecht, Rechte Seilschaften (Anm. 44), S. 674.
46
Vgl. Altermatt/Kriesi, Rechtsextremismus (Anm. 44), S. 74.
47
Ebenda, S. 75.NPD-Antisemitismus 19
„Während die Judenverfolgungen, unter anderem die völker- und menschenrechtswidrigen
Deportationen vieler Juden in Konzentrationslager und Ghettos, von niemandem bestritten
werden, gab es nach Auffassung der Revisionisten [d.h. der Negationisten oder Auschwitz-
Leugner] weder einen Plan zur physischen Vernichtung der Juden noch Gaskammern (es
sei denn solche zur Tötung von Läusen). Die Zahl der jüdischen Opfer von Krieg und Ver-
folgung in Hitlers Machtbereich beträgt nach revisionistischer Ansicht nur einen Bruchteil
der mythischen sechs Millionen, wobei die meisten dieser Menschen nicht ermordet wur-
den, sondern in Ghettos und Lagern an Epidemien und Entkräftung starben.“48
Wenn die „Sachsen Stimme“ Schaub und seinen Vortrag lobt, bekräftigt sie indirekt auch
diese negationistische These.
Ähnliches gilt für Udo Walendy, einen einschlägig bekannten Leugner der Judenvernich-
tung. Er wurde am 6. Mai 1997 wegen Volksverhetzung in zwei Ausgaben der bis dahin
von ihm herausgegebenen Schriftenreihe „Historische Tatsachen“ zu einer Freiheitsstrafe
von 14 Monaten ohne Bewährung verurteilt.49 Aufgrund eines weiteren Urteils blieb Wa-
lendy bis 31.5.1999 in Haft.50 Nach seiner Entlassung meldete „Zündstoff“: „Udo Walendy
ist frei“.51 In diesem Beitrag wird Walendy „zu den renommiertesten deutschen Revisio-
nisten“ gezählt und als Autor „zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und zeitge-
schichtlicher Analysen“ gerühmt, der als erster „ausgewiesene deutsche Wissenschaftler
der Nachkriegszeit [...] in Haft genommen wurde“.52 Das Lob seiner Person und seiner Po-
sition bzw. verbreiteten Inhalte sind nicht zu trennen. Walendys Buch „Wahrheit für
Deutschland“ wurde bereits 1979 indiziert; es folgten weitere Verfahren und Verurteilun-
gen. Walendy gehört dem Beratungskomitee des einschlägig bekannten „Journal of Histo-
rical Review“ in den USA an, das zu den zentralen Organen der „Revsionisten“ zählt.
Nach seiner Verurteilung hatte Walendy zunächst die Herausgabe seiner Reihe eingestellt,
allerdings fanden einige weitere Ausgaben dann unter dem Copyright der belgischen „revi-
sionistischen“ Organisation „Vrij Historisch Onderzoek“ (VHO) Verbreitung.53 Im „Zünd-
stoff“ wird 1999 unter dem Titel „Politische Justiz in Deutschland“ darauf verwiesen, daß
Walendy insgesamt noch 34 Monate in Haft bleiben müsse: „Fast drei Jahre Haft wegen
48
Rundschreiben „Zurück ins Mittelalter?“, Basel 1994, S. 1, zitiert nach ebenda, S. 75/143.
49
Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 1997, S. 122.
50
Vgl. Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Abt. Verfassungsschutz (Hrsg.): Verfassungs-
schutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen über das Jahr 1999, Düsseldorf 2000, S. 113.
51
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 3 (1999), S. 3.
52
Ebenda.
53
Eigene Recherchen auf den entsprechenden Seiten im Internet wie jene der VHO sowie die Hinweise des
Informationsdienstes gegen Rechtsextremismus im Internet.NPD-Antisemitismus 20
unerwünschter historischer Forschungsergebnisse, davon 14 Monate für etwas, das nicht
geschrieben wurde, dies braucht den Vergleich mit keiner Diktatur, deren Zensurmaßnah-
men und Willkürjustiz zu scheuen. Der diplomierte Politologe Walendy (Jahrgang 1927),
der zeitweilig auch dem NPD-Parteivorstand angehörte, hat mit zahlreichen Veröffentli-
chungen [...] das Dickicht alliierter Greuelpropaganda und Geschichtslügen zerschlagen,
das zu Lasten Deutschlands nach 1945 von den Besatzern und ihren deutschen Wasserträ-
gern aufgebaut wurde, um die gegen unser Volk gerichteten völkerrechtswidrigen Terror-
maßnahmen (Vertreibung, Entrechtung, Ausplünderung, Aufspaltung, Nürnberger Rache-
tribunal etc.) zu rechtfertigen.“54 Walendy wird nach üblicher Vorgehensweise zum Märty-
rer stilisiert, der seine vermeintliche „Wahrheit“ über den Holocaust nicht äußern darf.
Ähnliches gilt für die positive Erwähnung von Günter Deckert und Manfred Roeder.55 Bei-
de sind in der Vergangenheit verschiedentlich mit antisemitischer Hetze hervorgetreten
und wurden wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt.56 Roeder erhielt darüber hin-
aus 1982 eine 13-jährige Haftstrafe wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. 1990
erfolgte seine vorzeitige Entlassung, kurz darauf besucht er die „Revisionisten“-
Veranstaltung „Wahrheit macht frei“ in München. Bis heute muß sich Roeder regelmäßig
immer wieder wegen Volksverhetzung und Verharmlosung von NS-Verbrechen vor Ge-
richt verantworten.57
Zu der Kontextualisierung auf der Makroebene der Heftgestaltung gehört auch die Plazie-
rung von Anzeigen und die positive Rezension von Büchern einschlägig bekannter Auto-
ren.
In „Deutsche Zukunft“ wurde 1998 und 1999 mehrfach für das Buch „Der Verlust der Vä-
terlichkeit oder Das Jahrhundert der Juden“ von Wolfgang R. Frenz geworben.58 In diesem
Text wird ein rassistischer Antisemitismus vertreten. Eine kontinuierliche ganzseitige
Werbung für dieses Buch unterstützt indirekt die dort gemachten Aussagen.
54
Zündstoff, Deutsche Stimme für Berlin und Brandenburg 1(1999), S. 3.
55
Sachsen Stimme 4 (1998), Nr. 3/4, S. 2.
56
Roeder wurde etwa im Februar 1976 wegen Volksverhetzung zu einer Gefängnis- und Geldstrafe verurteilt
(vgl. Angelika Königseder: Zur Chronologie des Rechtsextremismus, in: Wolfgang Benz (Hrsg.):
Rechtsextremismus in Deutschland. Voraussetzungen, Zusammenhänge, Wirkungen, Frankfurt a.M.
1994, S. 246-315, S. 261). Roeder wurde aufgrund der Leugnung der Judenvernichtung bei einer NPD-
Veranstaltung im August 1998 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Deckert wurde u.a. im Juni
1994 wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhaß zu einer Bewährungs- und Geldstrafe
verurteilt worden (vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 1994, S. 132).
57
Vgl. u.a. Handbuch Deutscher Rechtsextremismus, Eintrag Roeder, S. 514f.; Internetseiten des Informati-
onsdienst gegen Rechtsextremismus.
58
U.a. in: Deutsche Zukunft 1998, Nr. 10, 11, 12, Deutsche Zukunft 1 (1999).NPD-Antisemitismus 21
In „Deutsche Zukunft“ Nr. 4/5 wurde das Buch besprochen. Der Rezensent hebt dabei die
antisemitische Logik der Broschüre hervor: Der Autor handele „vom Verrat an den geisti-
gen Trägern unserer Kultur, die mit der Überstülpung einer monotheistischen Wüstenreli-
gion begann und mit der Volksverdammung der Deutschen unserer Tage noch lange nicht
endet. [...] Der Wertekonsenz [sic!] der Deutschen, so beschreibt Frenz, wurde vorsätzlich
durch die Sieger des Zweiten Weltkrieges und durch die meist jüdischen Umerzieher, die
mit den Amerikanern kamen, vernichtet.“59
Das Buch von Frenz will zeigen, inwiefern die Deutschen Opfer eines vermeintlichen jüdi-
schen Angriffs waren und sind: „Während der Genozid für den biologischen Volksmord
steht, kann man den Ethnozid als den Seelenmord an einem Volk definieren. [...] Der ver-
suchte Ethnozid an uns Deutschen ist der Versuch, unsere Geschichte und Kultur auszulö-
schen. Er begann schon sehr früh, eigentlich in grauer Vorzeit, als uns das aus dem Juden-
tum entstandene Christentum übergestülpt wurde und unsere germanische Seele verletz-
te.“60
Frenz behauptet in seinem Buch, die Rassenforschung sei die „Voraussetzung für Ge-
schichtsverständnis und Zukunftsbewältigung“. In diesem Zusammenhang führt er aus:
„Um falschen Auslegungen vorzubeugen, soll festgehalten werden, daß es keine guten und
schlechten Menschenrassen gibt. Jede Rasse hat ihr spezifisches Erscheinungsbild. Bis die
Völker unserer Erde das erkennen, ist es noch ein weiter Weg bis das Hakenkreuz den Da-
vidstern besiegen wird, wobei das Hakenkreuz nicht als nationalsozialistisches Symbol
verstanden werden soll, den es ist ein altes theosophisches Zeichen ... .“61
Schließlich wird von Frenz auch die systematische Vernichtung der Juden geleugnet:
„Den Berichten, wonach es in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches, die eine inne-
re jüdische Lagerverfassung und jüdische Lagerpolizei hatten, reges geistiges Leben mit
Lageruniversität, Bibliotheken, Musik und Theateraufführungen, sportliche Betätigungen
und ein erotisches Nachtleben gab, kommt eine größere Wahrheit zu, als den Berichten
über Massengreuel, die das Andenken der in den Lagern verstorbenen Internierten ebenso
schänden, wie die der deutschen Soldaten, die das Unglück hatten, diese Menschen bewa-
59
Ernst Günther: Buchbesprechung „Über den Verlust der Väterlichkeit oder Das Jahrhundert der Juden“, in:
Deutsche Zukunft 4/5 (1998), S. 35.
60
Wolfgang R. Frenz: Der Verlust der Väterlichkeit oder Das Jahrhundert der Juden (2. Aufl.), Solingen
1999, S. 5
61
Ebenda, S. 84f.NPD-Antisemitismus 22
chen zu müssen. Alles, was der Legende des Holocaust dient, vergiftet die Herzen künfti-
ger Generationen von Juden und Deutschen.“62
Geworben wurde auch für die jüngere Arbeit von Frenz mit dem Titel „Konservative Re-
flexionen zur deutschen Geschichte“, in dem die Frontstellung gegen das Judentum weni-
ger explizit ist, aber wie in der früheren Publikation zum Konzept der Darlegungen gehört.
In dem Abschnitt „Zu den europäisch-germanischen Wurzeln – Odin statt Jehova“ heißt es:
„Man kann die Menschheit nicht retten indem man die Völker abschafft! Um sie zu retten,
sollten wir uns von dem jüdisch-christlichen Weltbild trennen, das uns vor zweitausend
Jahren wie ein großer Mantel bedeckt und unsere Geschichte erstickt hat. Wir sollten uns
wieder an unsere germanisch-europäischen Wurzeln erinnern. Die Trennung vom jüdisch-
christlichen Weltbild muß radikal sein, denn dieses Menschen- und Weltbild ist dekadent
[...].“63
62
Ebenda, S. 89.
63
Wolfgang Frenz: Konservative Reflexionen zur deutschen Geschichte, Solingen o.J., S. 18.Sie können auch lesen