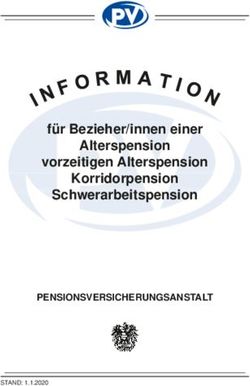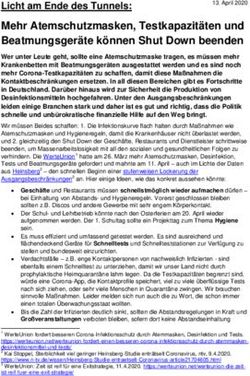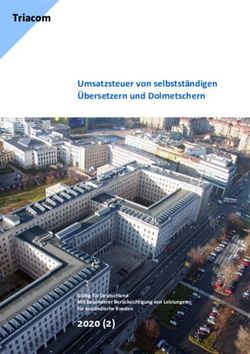Casualty Risk Consulting Informationen für Versicherer 21 Gentechnisch veränderte - Pflanzen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Casualty Risk Consulting
Informationen für Versicherer
21 Gentechnisch veränderte
Pflanzen
© 2005
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Königinstraße 107
80802 München
Bestellnummer 302-04743Inhalt Für Nachbestellungen nutzen Sie bitte die beiliegende Bestellkarte
unseres Zentrallagers für Publikationen, Tel.: +49 (89) 38 91-27 52,
oder das Publikationsportal der Münchener Rück im Internet
(http://www.munichre.com). Dort können Sie auch alle weiteren
1 Übersicht 1 Veröffentlichungen von Casualty Risk Consulting herunterladen
oder bestellen.
1.1 Begriffe 1
1.2 Mögliche Anwendungsgebiete der Grünen Bisher sind folgende Faltblätter erschienen:
Gentechnik 2 1 Mikrobiologische Bodensanierung
2 Bauschuttdeponien
1.3 Verbreitung 5
3 Holzbearbeitende Betriebe
4 N.A.T.U.R. (Das Münchener-Rück-Softwarepaket hilft bei der
2 Mögliche Gefahren 10 Quotierung von Umweltrisiken.)
5 Tankstellen
2.1 Toxizität bzw. Allergenität der gentechnisch
6 Münchener Ecoconsult GmbH (MEC)
veränderten Pflanze 10 7 Das EG-Öko-Audit
2.2 Auskreuzungen 10 8 Gefahrstoffibel
9 Flachbodentanks
2.3 Wirkung auf Nicht-Zielorganismen 13
10 Flüssiggasanlagen
2.4 Gentechnisch veränderter Pollen im Honig 14 11 Reaktionswände – eine neue Technologie zur Grundwassersanierung
2.5 Auswirkungen auf die Artenvielfalt 15 12 Umweltrisiken in der industriellen Landwirtschaft
13 Oberflächenreinigung von Metallen
14 Haftpflichtrisiken im Internet für kleine und mittlere Unternehmen
3 Rechtliche Situation 15 15 Gefährdungszonen
3.1 Cartagena-Protokoll 15 16 Umweltmanagementsysteme
17 Internet und Versicherung, Kompendium zum Workshop der
3.2 EG-Freisetzungs-Richtlinie (2001/18/EG) 16
Münchener Rück
3.3 EG-Verordnung 1829/2003 über die Zulassung und 18 Risikomanagement von Omnibussen
Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 19 Risikomanagement von Eisenbahnen
20 Rückrufrisiko für Zulieferfirmen der Automobilindustrie
Lebens- und Futtermitteln 18
3.4 Das Deutsche Gentechnikgesetz (GenTG) 19
3.5 EG-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 20 © 2005
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Königinstraße 107
4 Versicherungsrelevante Aspekte 21 80802 München
4.1 Haftpflichtschäden 21 Telefon: +49 (89) 38 91-0
4.2 Umweltschäden 23 Telefax: +49 (89) 39 90 56
http://www.munichre.com
4.3 Wo kommt es zu Schäden? 23
4.4 Nachweismethoden für GV-Anteile und Verantwortlich für den Inhalt
ihre Grenzen 25 Corporate Underwriting/Global Clients
Casualty Risk Consulting (CRC)
4.5 Maßnahmen zum Risikomanagement 26
Ihr Ansprechpartner
5 Fazit 27 Dr. Sabine Eberhardt
Telefon: +49 (89) 38 91-57 23
Telefax: +49 (89) 38 91-7 57 23
E-Mail: seberhardt@munichre.com
Druck
Lipp GmbH, Graphische Betriebe, Meglingerstraße 60, 81477 MünchenMünchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
1 Übersicht
Heutzutage wird Gentechnik in vielen Bereichen einge-
setzt. Während sie bei einigen medizinischen Anwendun-
gen seit Jahren etabliert und akzeptiert ist, stößt sie im
landwirtschaftlichen Bereich auf Skepsis.
Das Risikopotenzial in der Landwirtschaft variiert stark in
Abhängigkeit von den Eigenheiten der veränderten Pflan-
zenart, der Natur der Veränderung, dem Klima und dem
Verwendungszweck. Diese Broschüre informiert über
Gentechnikanwendungen in der Landwirtschaft und gibt
einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen.
1.1 Begriffe
Als gentechnisch verändert gemäß der EG-Richtlinie
2001/18/EG und dem Deutschen Gentechnikgesetz (GenTG)
gilt ein Organismus, dessen genetisches Material in einer
Weise verändert worden ist, wie es unter natürlichen
Bedingungen durch Kreuzen oder Rekombination nicht
vorkommt.
Das GenTG unterscheidet zwischen „Inverkehrbringen“
und „Freisetzungen“. Werden Produkte, die gentechnisch
veränderte (GV) Organismen enthalten oder aus ihnen
bestehen, an Dritte abgegeben, bezeichnet man das als
Inverkehrbringen. Hierzu zählt auch der Anbau von GV-
Pflanzen zu kommerziellen Zwecken. Gentechnische
Arbeiten in geschlossenen Anlagen werden vom GenTG
hingegen nicht erfasst.
Werden gentechnisch veränderte Pflanzen gezielt in die
Umwelt ausgebracht (Anbau zu Versuchszwecken), bevor
das Inverkehrbringen genehmigt wurde, spricht man von
Freisetzung. Die Freisetzung erfolgt zu Forschungszwe-
cken. Das GV-Produkt wird anschließend vernichtet oder zu
überwachten Fütterungsversuchen (meist beim Erzeuger)
verwendet. Die Produkte werden nicht verkauft. Da sie
1Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
weder verarbeitet noch transportiert werden, sind die
Risiken für den Versicherer geringer als beim kommerziel-
len Anbau (vgl. Tabelle S. 24). Bringt man GV-Pflanzen in
Verkehr, ergeben sich durch Verarbeitung, Transport und
Vertriebsschritte mehr Gelegenheiten zur Vermischung mit
genetisch unveränderten Produkten.
Unter „Grüner Gentechnik“ versteht man die Anwendung
gentechnischer Methoden bei Nutzpflanzen.
Quelle: Icon Genetics AG
1.2 Mögliche Anwendungsgebiete der Grünen Gentechnik
Die Grüne Gentechnik wird angewandt, um insekten-,
herbizid- und krankheitsresistente Pflanzen zu züchten,
Pflanzeninhaltsstoffe zu verändern und pharmazeutische
Wirkstoffe in Pflanzen zu produzieren (Pharming).
Züchtung von herbizid-, insekten- und krankheits-
resistenten Pflanzen
Die Entwicklung von Resistenzmerkmalen ist am weitesten
fortgeschritten. Entsprechende Soja-, Mais-, Baumwoll-
und Rapssorten werden bereits wirtschaftlich genutzt.
2Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Die gentechnische Veränderung, die bisher am häufigsten
kommerziell eingesetzt wird, ist die Vermittlung von Resis-
tenzen gegen Unkrautvernichtungsmittel mit breitem
Wirkungsspektrum wie Glyphosphat und Gluphosinat.
Tomaten-, Soja-, Baumwoll- und Rapssorten mit diesen
Eigenschaften werden bereits angebaut. Das Saatgut bie-
tet der Hersteller im Set mit dem entsprechenden Herbizid
an. Wegen der Resistenz der Kulturpflanze kann ein wirk-
sames Breitbandherbizid ausgebracht werden, das es
überflüssig macht, selektive Mittel wiederholt einzusetzen.
Die Effizienz dieses Vorgehens hängt von den klimatischen
Verhältnissen ab.
Auch gentechnisch vermittelte Insektenresistenzen nutzt
man bereits zu kommerziellen Zwecken. Oft werden dabei
Gene aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) einge-
fügt. Diese Gene sorgen für die Herstellung von Toxinen,
die für Säuger ungefährlich sind. Die Zielpflanze stellt dann
selbst ein Gift her, das bestimmte Insekten wie den Mais-
zünsler schädigt. Heute werden vor allem Baumwolle,
Mais und Raps mit Bt-Genen zum Schutz vor Fraßinsekten
angebaut.
Die toxische Wirkung einiger Stoffe aus Bacillus thurin-
giensis wird seit Jahren im ökologischen Landbau zur
Insektenbekämpfung genutzt. Dabei werden Präparate,
die das Bakterium Bt enthalten, auf die Felder gesprüht.
Das Toxin wirkt wie bei den GV-Pflanzen gegen die Raupen
von Schadinsekten. Diese Mittel gelten als besonders gut
verträglich für Mensch und Umwelt, da sie für Säuger
und Nutzinsekten unschädlich sind und schnell abgebaut
werden.
In der Forschung arbeitet man an Resistenzen gegen
Pilzbefall (zum Beispiel bei Mais) und gegen Viruskrank-
heiten (zum Beispiel bei der Kartoffel gegen den Y-Virus,
beim Tabak gegen den Tabakmosaikvirus, bei der Tomate
gegen den „Bushy-Stunt-Virus“ und beim Wein gegen die
„Reisig-Krankheit“). Pflanzen, die aufgrund gentechnischer
3Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen Veränderungen krankheitsbeständig sind, spielen im kommerziellen Anbau jedoch noch keine Rolle. Veränderung von Pflanzeninhaltsstoffen und Eigenschaften Ob Pflanzen als Lebensmittel dienen oder im technischen Bereich eingesetzt werden – die Veränderung von Inhalts- stoffen wie der Gehalt an Stärke, Ölen und Fetten kann in beiden Fällen von Interesse sein. So verwendet man Industriekartoffeln zum Beispiel, um Amylopektinstärke zu gewinnen. Stärke besteht von Natur aus zu etwa 25 % aus Amylose und zu 75 % aus Amylopektin. Wird Amylose technisch aus dem Gemisch abgetrennt, entstehen giftige Abfälle. Um diesen Schritt zu vereinfachen oder über- flüssig zu machen, wurden Kartoffeln gentechnisch so ver- ändert, dass sie kaum noch Amylose bilden. Bei Versuchs- pflanzen sank der Amylosegehalt auf 4 bis 6 %. Nach der Versuchsanbauphase wurde in Deutschland bereits die Zulassung beantragt. Um Lebensmittel „gesünder“ zu machen, versucht man, den Gehalt an bestimmten Inhaltsstoffen zu erhöhen. So soll GV-Reis mit mehr Provitamin A („golden rice“) helfen, bestimmte Mangelerscheinungen beim Konsumenten zu vermeiden. Bei Tomaten sorgt eine verzögerte Reifung dafür, dass sie länger haltbar sind. Erdbeeren sollen durch genetische Veränderungen unempfindlich gegen Frost werden. Bäume verändert man gentechnisch, damit sie beispiels- weise schneller wachsen, weniger Lignin enthalten (Lignin muss bei der Papierherstellung entfernt werden) oder resistent gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten werden. In Indonesien gibt es bereits Eukalyptusbäume, die nach nur fünf statt den üblichen zehn bis zwölf Jahren schlagreif sind. Die Fähigkeit von Pappeln, Schwermetalle in den Blättern zu speichern, wurde verstärkt, um so die 4
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Gentechnik für die Bodensanierung einzusetzen. Auf
kontaminierten Böden entziehen diese Bäume dem Boden
die Schwermetalle. Das Laub wird gezielt entsorgt.
Derzeit finden in den USA wie auch in Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Spanien und Norwegen
Freisetzungsversuche mit transgenen Pappeln statt. Als
„transgen“ bezeichnet man Organismen, die in ihrem
Genom fremde Gene tragen.
Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe in Pflanzen
(Pharming)
Unter „Pharming“ versteht man die Produktion pharma-
zeutischer Wirkstoffe in Pflanzen oder Tieren. So könnten
komplexe Wirkstoffe kostengünstig produziert werden.
Da die Wirkstoffe, die in GV-Pflanzen hergestellt werden,
jedoch danach noch einmal als Arzneimittel zugelassen
werden müssen, entsteht ein hoher, zusätzlicher finanziel-
ler Aufwand. Für völlig neue Wirkstoffe könnte Pharming
aber in Zukunft eine Option sein. Einige derart veränderte
Pflanzen werden schon zu Versuchszwecken angebaut,
aber es gibt bisher noch keine Zulassung und keine kom-
merzielle Verwertung.
1.3 Verbreitung
Geographische Verbreitung
Gentechnisch veränderte Pflanzen werden seit 1995 kom-
merzialisiert. Weltweit wurden 2004 auf 81,0 Millionen
Hektar GV-Pflanzen angebaut. Das waren 20 % mehr als im
Vorjahr (67,7 Millionen Hektar). Eine Vorreiterrolle hat die
USA mit 47,6 Millionen Hektar im Jahr 2004 (59 % der welt-
weiten Anbaufläche). In einigen Schwellen- und Entwick-
lungsländern nimmt der GV-Anbau jedoch stark zu. Die
neue Technologie wird hier weitgehend ohne Kritik akzep-
tiert. In China verwendet man nicht nur Saatgut der großen
Anbieter, sondern man forscht vor allem bei Gemüse- und
5Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Getreidearten auch an zahlreichen eigenen Modifikatio-
nen. Bereits heute gibt es hier große GV-Anbauflächen
(vor allem Baumwolle). Auch in Indien setzt man vermehrt
auf GV-Pflanzen. Hier vervierfachte sich die Fläche für
Bt-Baumwolle 2004 im Vergleich zum Vorjahr.
Anbaufläche (Mio. ha)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Abb. 1: Anbaufläche gentechnisch veränderter Pflanzen weltweit (Mio. ha).
Quelle: Clive James, ISAAA briefs “Global status of commercialised
transgenic crops: 2004“
China legte bereits gesetzlich fest, dass GV-Lebensmittel
ohne Schwellenwert gekennzeichnet werden müssen. Ent-
sprechend ausgewiesenes Speiseöl wird schon in Super-
märkten verkauft. Die Verbraucher akzeptieren diese Pro-
dukte gut. Auf Druck internationaler Lebensmittelkonzerne,
die vertraglich zugesichert nur GV-freie Produkte abneh-
men wollen, etabliert sich in China neben der GV-Landwirt-
schaft auch eine bewusst GV-freie Produktion. Sie erzielt
mit dem Siegel „GV-frei“ beim Export höhere Preise.
Die Hauptanbauländer für transgene Pflanzen sind die
USA, Argentinien, Kanada und Brasilien. Abbildung 2 zeigt
die Verteilung der Anbauflächen in den wichtigsten
Ländern in den Jahren 2003 und 2004.
6Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Transgene Pflanzen: Anbauflächen und Anbauländer
USA 42 794
47 600
13 887
Argentinien 16 200
Kanada 4 413
5 400
Brasilien 2 996
5 000
China 2 794
3 700
Paraguay –
1 200
Südafrika 400
500
Australien 100
200
100 2003
Indien 500 2004
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
Abb. 2: Anbauflächen von GV-Pflanzen 2003 und 2004 (Tsd. ha).
Quelle: Clive James, ISAAA briefs “Global status of commercialised
transgenic crops: 2004“
In der EU werden nur in Spanien GV-Pflanzen in nennens-
wertem Umfang angebaut: Im Jahr 2004 waren es 58 000 ha
Mais und damit 80 % mehr als 2003. Im De-facto-Morato-
rium des Jahres 1998 hatten sich die Mitglieder der EU
verständigt, bis zur Verabschiedung einer einheitlichen
Regelung keine weiteren Zulassungen für GV-Pflanzen zu
erteilen. Der in Spanien angebaute Bt-Mais (Syn 176) war
schon vorher genehmigt worden.
Durch die EG-Verordnungen 1829/2003 (Zulassung und
Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebens-
und Futtermitteln) und 1830/2003 (Rückverfolgbarkeit und
Kennzeichnung) änderte sich die Situation im November
2003 jedoch und die Zulassung weiterer Arten wurde
möglich. Allerdings ist die Akzeptanz der Verbraucher in
vielen EU-Ländern gering.
Außerhalb der EU wird in Rumänien GV-Soja angebaut; in
Bulgarien gibt es zwar noch keine Arten, die für den kom-
merziellen Anbau zugelassen sind, aber großflächigen
Mais-Versuchsanbau. An 30 verschiedenen GV-Sorten wird
7Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
geforscht. Das Land bemüht sich um EU-Konformität
seiner Gesetzgebung, die zum Thema „gentechnisch
veränderte Organismen“ (GVO) entsteht. In Slowenien
wurden Testmethoden für Soja und Mais etabliert, die
EU-konform sind. Auch hier ist bald mit dem Anbau von
GV-Pflanzen zu rechnen.
Kommerziell genutzte Pflanzen und Merkmale
Weltweit werden derzeit genveränderte Soja-, Mais-,
Baumwoll- und Rapssorten kommerziell genutzt. Dominie-
rend ist Soja. Soja wird auf etwa 48,4 Millionen Hektar
angebaut. Damit sind bereits 56 % der weltweiten Soja-
produktion gentechnisch verändert.
Konventioneller und GV-Anbau bei Mais, Soja, Baumwolle und Raps
(Mio. ha)
160 Anbaufläche konventionell
Anbaufläche GV
140
120
100
80
60
40
20
0
Mais Soja Baumwolle Raps
Abb. 3: Anteil von GV-Pflanzen an den weltweiten Anbauflächen 2004
(in Mio. ha).
Quelle: Clive James, ISAAA briefs “Global status of commercialised
transgenic crops: 2004“
Was die veränderten Merkmale betrifft, überwiegen bei
den kommerziell genutzten transgenen Pflanzen bisher
gentechnisch vermittelte Resistenzen. Diese Eigenschaften
vereinfachen die Produktion, bilden aber keinen Mehrwert
für den Verbraucher, was zum Teil die Ablehnung in der
8Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Bevölkerung erhöht. Änderungen der Inhaltsstoffe oder die
Produktion von Wirkstoffen spielen wirtschaftlich bisher
keine Rolle.
Bei den gentechnisch vermittelten Resistenzen ist weltweit
die Herbizidresistenz am wichtigsten. 73 % der angebauten
GV-Pflanzen sind gegen bestimmte unspezifische Unkraut-
vernichtungsmittel resistent, die zusammen mit dem
Saatgut im Paket vertrieben werden. Die entsprechenden
Herbizide stammen von den Firmen Monsanto (Roundup)
und Bayer (Basta/Liberty).
Die wichtigsten Resistenzen im Überblick
Herbizid- und
Insektenresistenz 8 %
Herbizidtoleranz 73 %
Insekten-
resistenz 19 %
Abb. 4: Merkmale der kommerziell genutzten gentechnisch
veränderten Pflanzen 2004 weltweit.
Quelle: Clive James, ISAAA briefs “Global status of commercialised
transgenic crops: 2004”
Pflanzen mit veränderten Produkteigenschaften oder
solche zur Produktion von Pharmawirkstoffen sind weit-
gehend noch in der Erprobungsphase. Lediglich die Ent-
wicklung einer gentechnisch veränderten Kartoffelsorte,
die als industrieller Rohstoff mit „maßgeschneiderter“
Stärkezusammensetzung dienen soll (s. o.), ist weit fort-
geschritten.
9Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen 2 Mögliche Gefahren 2.1 Toxizität bzw. Allergenität der gentechnisch veränderten Pflanze Genprodukte, die für den Menschen giftig sind, kommen für die Erzeugung transgener Lebens- und Futtermittel- pflanzen selbstverständlich nicht infrage. Dennoch wird jede neue gentechnische Veränderung auf Toxizität im Pro- dukt überprüft. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass eine Giftwirkung im Versuch übersehen wird. Da es Eiweißmoleküle sind, die Allergien auslösen (Aller- gene), ist es denkbar, dass eine transgene Pflanze mit einem neuen Gen durch die Produktion des entsprechen- den neuen Proteins ein höheres Allergiepotenzial hat als die Ausgangspflanze. Bei einer gentechnisch veränderten Form der Sojabohne, die als Tierfutter vorgesehen war, wurde ein Gen aus der Paranuss eingeführt. Somit wurde ein Paranussallergen übernommen. Produkte dieser Soja- pflanze wären also für Paranussallergiker problematisch gewesen. Obwohl die Pflanze nur als Viehfutter vorgese- hen war, hat man die Entwicklung eingestellt. Da vor der Zulassung einer GV-Pflanze routinemäßig umfangreiche Labortests durchgeführt werden, die das gentechnikspe- zifische Allergierisiko untersuchen, kann man eine neue Allergenität mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Bei keinem vermarkteten GV-Produkt wurden bisher Allergien beobachtet. 2.2 Auskreuzungen Aufgrund von Pollenflug und Bestäubung durch Insekten (Honigbienen transportieren Pollen durchschnittlich 2 km, teilweise aber auch bis zu 14 km) könnte sich das veränder- te Merkmal in verwandte Wildarten oder nicht manipulier- ten Kulturpflanzen auskreuzen. Handelt es sich um Herbi- zidresistenzen, so können unerwünschte, schwer bekämpf- 10
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
bare, mehrfach resistente Pflanzen entstehen. Wie groß
das Risiko der Auskreuzung ist, unterscheidet sich von
Art zu Art.
Bei Raps ist das Auskreuzungsrisiko in gemäßigten Breiten
sehr hoch. Die Pflanze hat nahe Verwandte in der mittel-
europäischen Flora, sodass eine Auskreuzung auf Wild-
pflanzen möglich ist. Unter Laborbedingungen wurde
beobachtet, dass Raps Merkmale auf verwandte Kreuz-
blütler wie Schwarzen Senf, Grausenf, Sareptasenf, Acker-
senf, Rübse und Hederich sowie auf traditionell gezüchte-
ten Raps übertragen kann. In der Natur ist das in diesem
Umfang nicht zu erwarten, da die Pflanzen nicht zur glei-
chen Zeit blühen. Die Rapspflanze ist jedoch auf bereits
besiedelter Fläche sehr durchsetzungsfähig und ihr Samen
kann jahrelang ruhen, bevor er auskeimt. Das heißt, es ist
auch nach langer Zeit möglich, dass GV-Samen wiederaus-
keimt. Raps wird zum Teil durch Bienen bestäubt, was den
Ausbreitungsradius des Pollens vergrößert.
Quelle: Eberhardt
Anders ist die Situation bei Mais. Da Maissamen nicht
winterhart sind, ist ein Auswildern in Mitteleuropa kaum
möglich. Maispflanzen sind gegenüber Unkräutern sehr
empfindlich und würden auf bereits besiedeltem Boden
11Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
(Natur) nicht keimen. Mais hat keine Verwandten unter den
heimischen Wildkräutern. Ein Auskreuzen des veränderten
Merkmals ist also nur auf andere Kulturmaissorten, nicht
aber in die freie Natur möglich. Ein Ökoschaden scheint
also nur durch horizontalen Gentransfer oder durch Schä-
digung von Insekten möglich. Ein Feldversuch zur Aus-
kreuzung von GV-Mais in Spanien ergab in einem Abstand
von 10 m zum GV-Mais durchschnittlich Anteile von unter
1 % gentechnisch veränderter DNA an der Gesamt-DNA
in Maiskolbenproben. Dieses Ergebnis deckt sich mit
Versuchsergebnissen in Deutschland. Im Gegensatz zur
Situation in Deutschland ist in Spanien jedoch die Durch-
wuchsproblematik zu berücksichtigen: Da es keine Frost-
perioden gibt, keimen Vorjahressamen in der Folgekultur
aus und können diese verunreinigen. Die Ausbreitungs-
gefahren können also nicht pauschal für eine modifizierte
Sorte beurteilt werden, sondern sind auch vom Klima
abhängig.
Quelle: Eberhardt
Bei Kartoffeln ist das Risiko als relativ gering einzuschät-
zen, da mitteleuropäische Kultursorten nicht winterhart
sind. Die Knollen keimen in der Regel also im Folgejahr
nicht wieder aus, besonders wenn sie nicht tief im Boden
liegen. Kommt es dennoch im Folgejahr zum Durchwuchs,
sind die Pflanzen leicht zu erkennen und werden durch die
12Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Herbizide der Folgekultur, in der Regel Getreide, vernichtet.
Auch im Jahr des Anbaus ist die Möglichkeit gering, Nach-
barkulturen zu verunreinigen, da bei Bestäubung mit GV-
Pollen nur die Frucht der Nachbarkulturpflanze gentech-
nisch verändert wird, nicht jedoch die ganze Pflanze.
Anders als bei Mais wird aber bei der Kartoffel die Knolle
genutzt und nicht die Frucht, eine kirschgroße Beere.
Quelle: Eberhardt
Zuckerrüben sind zweijährige Pflanzen. Werden sie zur
Zuckerherstellung angebaut, so erntet man die Pflanzen im
ersten Jahr. Es kommt also im Normalfall nicht zur Blüte.
Ein Auskreuzungsrisiko durch Bestäubung besteht nur
durch so genannte Schosser, vorzeitige Blütentriebe im
ersten Jahr, die bisweilen auftreten. Anders ist die Situa-
tion bei der Saatgutherstellung, bei der die Pflanzen zur
Blüte gebracht werden. Hier ist das Risiko der Auskreuzung
in Wildformen und die Verbreitung des Merkmals in andere
(blühende, also zur Saatguterzeugung bestimmte) Kultur-
pflanzen relativ groß.
2.3 Wirkung auf Nicht-Zielorganismen
Transgene Pflanzen, die Gifte gegen Schadinsekten pro-
duzieren, könnten auch andere Insekten und Organismen
wie Bodenbakterien beeinträchtigen. So enthalten Nektar
13Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen und Pollen von transgenem Raps zum Beispiel geringe Konzentrationen des auch in den grünen Pflanzenteilen enthaltenen Insektengifts. Blütenbesuchende Insekten könnten also geschädigt werden. Im Laborversuch gibt es Hinweise auf Schädigungen von Bienen, wenn das Gift direkt verfüttert wird. Dies ist aber mit den Konzentratio- nen in der natürlichen Umgebung nicht zu vergleichen. Diskutiert werden Auswirkungen von Bt-Mais auf Monarch- falter und Florfliege. Fressen die Raupen des Monarch- falters auf ihrer Futterpflanze, einem Ackerunkraut, Pollen von Bt-Mais mit, entwickeln sie sich langsamer und es sterben mehr als in der Kontrollgruppe. Für die Florfliege gilt Ähnliches: Ernähren sich die räuberischen Larven von Blattläusen, die an Bt-Mais gesaugt haben, sterben auch hier wieder mehr. Hierzu ist anzumerken, dass die Ver- wendung von Bt als Insektizid im klassischen Pflanzen- anbau diese Insekten ebenfalls signifikant schädigt. Verrottet die transgene Pflanze, dann könnte das über- tragene Gen von Bodenbakterien aufgenommen werden. Schwer vorstellbar ist jedoch, dass daraus ein Schaden entsteht. Bacillus thuringiensis, der „Spenderorganismus“ für das in Pflanzen eingebrachte Gen, ist selbst ein Boden- organismus. Der hier skizzierte horizontale Gentransfer von Art zu Art ist also von jeher auch ohne den Umweg des Gens über die Pflanze möglich. 2.4 Gentechnisch veränderter Pollen im Honig Pollen gentechnisch veränderter Pflanzen finden sich in Honig. Bereits 1997 wurde in Deutschland Pollen von GV- Raps in kanadischem Raps- und Kleehonig nachgewiesen. Um das zu vermeiden, müssen Imker mehr als 10 km Abstand zu Feldern mit GV-Pflanzen halten. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Pflanzenarten sehr unterschiedlich. Mais wird windbe- stäubt und ist für Bienen unattraktiv, da er keinen Nektar produziert. Bei Untersuchungen in Bayern wurden Bienen- 14
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
stöcke direkt an GV-Maisfeldern und in einem Abstand von
bis zu 700 m aufgestellt. In einigen Honigproben fand man
Kontaminationen mit GV-Maispollen, die an der Nachweis-
grenze lagen. Wurden die Bienen schon vor der Maisblüte
an den Standort gebracht, war gar kein GV-Maispollen
nachzuweisen. Bei Raps, der zu etwa 30 % von Insekten
bestäubt wird, ist es als sicher anzusehen, dass Bienen zur
Verbreitung über weite Distanzen beitragen und GV-Raps-
pollen im Honig zu finden sind, wenn die Bienenstöcke in
weniger als 10 km Abstand von einem GV-Rapsfeld auf-
gestellt werden.
2.5 Auswirkungen auf die Artenvielfalt
Durch den Einsatz von GV-Pflanzen werden sich in der
Landwirtschaft die Sortenpalette und das Angebot an
Pflanzenschutzmitteln verringern. Dadurch besteht die
Gefahr, dass es bei einer Resistenzentwicklung zu groß-
flächigen Ernteausfällen kommt. Außerdem könnten
herbizidresistent gewordene Unkräuter oder Kulturpflan-
zen in Folgekulturen für ernsthafte Probleme sorgen.
Die veränderte Überlebens- oder Vermehrungsfähigkeit
der GV-Pflanzen könnte lokal dazu führen, dass natürliche
Florenbestandteile verdrängt werden. Die komplexen
Zusammenhänge in Ökosystemen machen Vorhersagen
schwierig. In der Regel werden die Veränderungen der
GV-Pflanze aber in der natürlichen Umgebung keinen
Selektionsvorteil mit sich bringen, sodass eine massen-
hafte Ausbreitung nicht zu erwarten ist.
3 Rechtliche Situation
3.1 Cartagena-Protokoll
Das im Januar 2000 verabschiedete „Cartagena Protocol on
biosafety“ regelt den grenzüberschreitenden Handel mit
lebenden gentechnisch veränderten Organismen (GVO).
15Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen Nach der Ratifizierung durch den 50. Staat im Juni 2003 wurde es rechtskräftig. In der EU wurde das Abkommen mit der Verordnung 1946/2003 umgesetzt. Dem Protokoll zufol- ge muss der Exportstaat bei der Ausfuhr von GVO dem importierenden Land alle sicherheitsrelevanten Informatio- nen zur Verfügung stellen. Das übernimmt ein internatio- nales „Clearing House“. Falls die GVO im Zielland in die Umwelt ausgebracht werden sollen, muss das Einfuhrland zustimmen. Es darf aber auch vorsorglich – ohne wissen- schaftliche Beweisführung – den Import verbieten, wenn plausible Zweifel an der Sicherheit für die Umwelt, biologi- sche Vielfalt und menschliche Gesundheit bestehen. Diese Regelungen gelten nicht für die Verwendung der GVO in geschlossenen Systemen und bei Produkten, die sofort zu Lebens- und Futtermitteln verarbeitet werden sollen. In diesen Fällen können die Regierungen pauschale Genehmi- gungen oder Ablehnungen beim Clearing House hinter- legen, sodass keine Einzelerlaubnis nötig ist. 3.2 EG-Freisetzungs-Richtlinie (2001/18/EG) Diese Richtlinie regelt die absichtliche Freisetzung gen- technisch veränderter Organismen in die Umwelt zu experimentellen und kommerziellen Zwecken (Inverkehr- bringen). Sie wurde nach Ablauf der Umsetzungssfrist im Oktober 2002 von den meisten, aber nicht allen Mitglieds- staaten in nationales Recht umgesetzt. GVO sollen nach dem Stufenprinzip in die Umwelt eingebracht werden. Zunächst werden sie nur in geschlossenen Systemen getestet, danach mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Natur. Die Bedingungen, zum Beispiel zur Abschir- mung, werden stufenweise gelockert, wenn sich heraus- gestellt hat, dass die vorhergehende Anbauphase für Mensch und Natur unbedenklich war. In der Richtlinie ist das Zulassungsverfahren für Freisetzungen und für das Inverkehrbringen geregelt. Sie beschreibt Prinzipien und Methodik der Umweltverträglichkeitsprüfung und enthält die Informationen über den GVO, die für eine Zulassung nötig sind. 16
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Freisetzungen
Für jede Freisetzung ist eine Genehmigung nötig, die auf
nationaler Ebene vergeben wird. Jede Freisetzung zu Ver-
suchszwecken muss einzeln auf Umweltauswirkungen
geprüft werden. Die Zulassungsbehörde kann Auflagen
erlassen wie Vorschriften zur Abschirmung des Versuchs-
felds oder die Vernichtung der Pflanzen nach Projektende.
Liegen genügend Erfahrungswerte vor, kann nach einem
„differenzierten Verfahren“ zugelassen werden. Es er-
möglicht, ohne Einzelzulassungen den GVO an mehreren
Standorten in einem bestimmten Zeitraum anzubauen.
Nur noch bis 2008 können Genehmigungen für die Frei-
setzung von Pflanzen erteilt werden, die ein Antibiotika-
resistenzgen tragen. Wird die Pflanze später in Verkehr
gebracht, muss das entsprechende Gen jedoch wieder
entfernt werden. Dadurch will man die Verwendung von
Antibiotikaresistenzgenen schrittweise einstellen.
Die Mitgliedstaaten müssen öffentliche Register anlegen,
in denen die Orte der genehmigten Freisetzungsversuche
verzeichnet sind.
Inverkehrbringen
Für die kommerzielle Nutzung von GVO (Weitergabe an
Dritte), das Inverkehrbringen, ist eine Genehmigung
erforderlich, die – anders als bei Freisetzungen – EU-weit
gilt und zunächst auf zehn Jahre beschränkt ist. Neben
der Umweltverträglichkeit wird gemäß der Verordnung
1829/2003 über gentechnisch veränderte Lebens- und
Futtermittel die Sicherheit der aus den GVO erzeugten Pro-
dukten bewertet. Das übernimmt die Europäische Lebens-
mittelbehörde (European Food Safety Authority, EFSA).
Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Nutzung des
GVO keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und
17Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen die Gesundheit von Mensch und Tier hat. Er ist zudem ver- pflichtet, während des Anbaus auf mögliche Beeinträchti- gungen zu achten. Ab 2005 werden keine Genehmigungen mehr für das Inverkehrbringen von Pflanzen mit einem Antibiotika- resistenzgen erteilt. In Deutschland wurde die Richtlinie mit dem GenTG in nationales Recht umgesetzt. 3.3 EG-Verordnung 1829/2003 über die Zulassung und Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln Diese EG-Verordnung gilt seit April 2004 in allen Mitglied- staaten. Im Gegensatz zu Richtlinien, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, gelten Verordnungen unmittelbar. In der EG-Verordnung werden Sicherheitsanforderungen definiert und die Kennzeichnung und Zulassung von GV- Lebens- und Futtermitteln geregelt. Erfasst werden Lebensmittel, Zutaten, Zusatzstoffe und Aromen, die GVO sind oder enthalten oder aus ihnen hergestellt werden. Das gilt unabhängig davon, ob der GVO-Gehalt im Lebens- mittel nachweisbar ist oder nicht. Von der Verordnung nicht betroffen sind Lebens- und Futtermittel, die mithilfe von GVO hergestellt werden, wie Fleisch von Tieren, die mit GV-Pflanzen gefüttert werden. Technische Hilfsstoffe, wie Enzyme in Lebensmitteln, erfasst die Verordnung nicht. Futtermittel müssen wie Lebensmittel gekenn- zeichnet werden. Der Kennzeichnungsschwellenwert liegt bei 0,9 % GV- Anteil für GVO, die von der Europäischen Lebensmittel- Sicherheitsbehörde (EFSA) zugelassen sind. Für GVO, deren Sicherheitsbeurteilung abgeschlossen ist, die aber noch nicht in der EU zugelassen sind, liegt der Schwellen- 18
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
wert bei 0,5 %. Für andere GV-Merkmale gilt der Wert 0,0 %.
Nur ein kleiner Teil der weltweit angebauten GVO ist in der
EU zugelassen. Für einige GVO liegt also der Schwellen-
wert in der EU bei 0,0 %: Wird der Schwellenwert unter-
schritten, kann eine Kennzeichnung nur dann unterbleiben,
wenn die Beimischung von GVO zufällig und technisch
unvermeidbar ist. Bewusstes Vermischen des GVO durch
Verdünnung ist also kennzeichnungspflichtig.
Für alle Lebens- und Futtermittel, welche die Verordnung
erfasst, gibt es ein EU-einheitliches Verfahren. Die GV-Pro-
dukte dürfen sich nicht nachteilig auf Mensch, Tier und
Umwelt auswirken, nicht zu Ernährungsmängeln führen
und den Verbraucher nicht irreführen. Zulassungen sind
zunächst auf zehn Jahre beschränkt. Alle zugelassenen GV-
Lebensmittel müssen in ein öffentliches Register einge-
tragen werden.
Da die Kennzeichnungspflicht auch dann gilt, wenn ein
Nachweis des GVO nicht möglich ist, muss sichergestellt
sein, dass sich die Grundstoffe über die ganze Produktions-
kette rückverfolgen lassen. Anhand von Unterlagen kann
man dann den Gehalt an verwendetem GV-Material nach-
vollziehen.
Mit der Überwachung der Kennzeichnungsvorschriften
sind in Deutschland die Lebensmittelüberwachungsämter
der Länder betraut. In Deutschland können bei Verstoß
gegen die Kennzeichnungsbestimmungen Geldstrafen bis
zu 50 000 € verhängt werden.
3.4 Das Deutsche Gentechnikgesetz (GenTG)
Seit Februar 2005 ist das neue deutsche GenTG in Kraft. Es
soll Umwelt und Gesundheit schützen, einen rechtlichen
Rahmen für die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und
Förderung der Gentechnik schaffen und die Koexistenz von
konventioneller, ökologischer und GV-Landwirtschaft
gewährleisten.
19Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen Anlass für das neue GenTG war die EG-Freisetzungs-Richt- linie 2001/18/EG. Da die EG-Richtlinie 90/219/EWG (eine Systemrichtlinie, die den Umgang mit GVO in geschlosse- nen Systemen regelt) durch die Richtlinie 98/81/EG geän- dert worden war, musste auch diese Änderung in natio- nales Recht umgesetzt werden, was ebenfalls mit dem GenTG geschah. Über die EG-Richtlinie hinaus legt das GenTG eine gesamt- schuldnerische Gefährdungshaftung für den Betreiber fest. Beim Anbau von GV-Pflanzen haftet also der Landwirt ver- schuldensunabhängig für Schäden. In § 36 a wird die Über- tragung eines gentechnisch veränderten Merkmals als wesentliche Beeinträchtigung gemäß § 906 BGB definiert. Damit wird die Auskreuzung als Schaden angesehen, für den zu haften ist. Diese Maßnahme soll dauerhaft die Ko- existenz verschiedener landwirtschaftlicher Anbauformen mit und ohne Verwendung von Gentechnik ermöglichen. Je nach Pflanzenart variiert die Auskreuzungswahrschein- lichkeit. Die Landwirte müssten abhängig von den Eigen- schaften der Pflanze dafür sorgen, dass ein GV-Merkmal nicht verbreitet wird. Das ist unterschiedlich aufwändig und bei einigen Pflanzen wie dem Raps kaum möglich. Zuständig für den Vollzug des GenTG ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das BVL führt auch ein öffentliches Standortregister, in dem geplante Anbauflächen für GV-Pflanzen aufgelistet sind. Bei Genehmigungen für das Inverkehrbringen müs- sen das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Bundes- institut für Risikobewertung zustimmen. 3.5 EG-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) Die Richtlinie wurde im April 2004 verabschiedet und muss bis April 2007 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie legt fest, dass derjenige, der durch seine berufliche Tätig- keit einen Umweltschaden verursacht, diesen Schaden 20
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
sanieren muss, auch wenn er die Natur und nicht das Gut
eines Dritten betrifft. Gehaftet wird verschuldensunabhän-
gig unter anderem für eine „Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume“ infolge Freisetzung, Beför-
derung und Inverkehrbringen von GVO.
4 Versicherungsrelevante Aspekte
Durch Auskreuzung oder Vermischung entlang der Pro-
duktionskette kann das GV-Merkmal ungewollt verbreitet
werden. Dadurch sind Schäden am Gut eines Dritten oder
an der Natur denkbar.
4.1 Haftpflichtschäden
Ein nahe liegender Schaden ist, die Pflanzenkultur eines
Nachbarfelds mit GVO über dem Grenzwert von 0,9 % zu
verunreinigen. Das Produkt dieser Kultur wäre in der EU ab
diesem Gehalt an GVO kennzeichnungspflichtig. Dadurch
verliert es an Wert, wofür der Verursacher haftbar ist. Ob
es sich hierbei um einen Sach- oder einen Vermögens-
schaden handelt, ist strittig. Dieser nachbarschaftsrecht-
liche Ausgleichsanspruch ist die Basis für den „unmittel-
baren Koexistenzschaden“.
Falls der Nachbar seine Waren als Ökoprodukte verkaufen
möchte, könnte eventuell jede, auch unter der Kennzeich-
nungsschwelle liegende Verunreinigung den Wert min-
dern, wenn die Abnehmer auf völliger GV-Freiheit beste-
hen. In der derzeitigen Form des deutschen GenTG muss
unter Umständen auch für derartige „unterschwellige“
Verunreinigungen gehaftet werden. Es wird jedoch eine
Präzisierung angestrebt.
21Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen Quelle: Eberhardt Auch Folgeschäden sind denkbar: Ein finanziell weiter reichender Schaden könnte zum Bei- spiel entstehen, wenn ein Ökolandwirt seinen Mais als Futter für eigene Milchkühe verwendet und aufgrund der unerwünschten GV-Verunreinigung über längere Zeit- räume (zum Beispiel ein Jahr) die Milch nicht mehr an Ökoabnehmer liefern kann. In der Milch sind zwar keine GV-Bestandteile enthalten, wenn die Kuh GV-Pflanzen frisst, aber wenn der Milchverarbeiter GV-freie Fütterung verlangt, kann er die Abnahme verweigern. Neben der Verbreitung des Merkmals durch Auskreuzung ist auch eine Vermischung bei der Ernte, dem Transport, der Lagerung oder an anderen Stationen der Produktions- kette möglich. Hiervon wären Produkthaftung oder Rück- rufdeckungen für Händler und Produzenten betroffen. 22
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
4.2 Umweltschäden
Gemäß der seit April 2004 verabschiedeten EG-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) könnte zur zivilrechtlichen
eine öffentlich-rechtliche Haftung für Schäden an der Natur
kommen. Die Verbreitung eines GV-Merkmals in die Natur
könnte Schäden an der Biodiversität hervorrufen. Mögli-
cherweise wird ein GV-Merkmal in einer geschützten Pflan-
ze als Schaden angesehen. Wenn dieses neue Merkmal
Wildpflanzen vitaler machen und so zur Verdrängung
geschützter Arten beitragen würde, wäre das ebenfalls ein
Ökoschaden, für den der Verursacher haften müsste.
Das Risiko für die Auswilderung der GV-Pflanzen bzw. des
GV-Merkmals ist wie erwähnt für verschiedene Kultur-
pflanzen unterschiedlich hoch (vgl. 2.2 [S. 10–13]). Beim
horizontalen Gentransfer (von einer auf eine andere Art)
ist zu beachten, welche Merkmale die GV-Pflanze trägt:
So wäre ein Gen unerwünscht, das Antibiotikaresistenz
vermittelt. Je nachdem, welche Komponenten eine GV-
Pflanze trägt, unterscheidet sich das Risiko also abhängig
von der Art der vorgenommenen Veränderung stark.
4.3 Wo kommt es zu Schäden?
Neben der Auskreuzung des GV-Merkmals durch Pollen-
flug gibt es entlang der Herstellungskette für Futter- und
Lebensmittel weiteres Schadenpotenzial. Das wahrschein-
lichste Risiko liegt darin, dass sich transgenes mit kon-
ventionellem Erntegut bei Ernte, Transport und Lagerung
vermischt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht
über mögliche Schäden. Einige Szenarien – wie die
Allergieentwicklung bei Mensch oder Tier – sind als sehr
unwahrscheinlich anzusehen, aber theoretisch denkbar.
23Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
Mögliche Schäden während der Verarbeitung
Herstellungsprozess pflanzlicher Nahrungs- oder Futtermittel
Potenzielle Schäden Erläuterung/Beispiel
Saatguterzeugung
Fehlerhaftes Produkt/Rückruf Zugesicherte Eigenschaften fehlen
Vermögens- oder evtl. Pollenflug und Auskreuzung
Sachschaden
Durchwuchs (transgenes Saatgut
keimt im Folgejahr und verunreinigt
eine andere Kultur)
Umweltschaden Gentransfer in Wildpflanzen, Aus-
breitung der GV-Pflanze, Verdrän-
gung natürlicher Florenbestandteile
Anbau
Vermögens- oder evtl. Pollenflug und Auskreuzung
Sachschaden
Durchwuchs (transgenes Saatgut
keimt im Folgejahr und verunreinigt
eine andere Kultur)
Umweltschaden Gentransfer in Wildpflanzen, Aus-
breitung der GV-Pflanze, Verdrän-
gung natürlicher Florenbestandteile
Vermögensschaden Ein Biobauer wird dauerhaft
unglaubwürdig, wenn seine Ernte
einmal verunreinigt war; Verdienst-
ausfall
Ernte
Vermögens- oder evtl. Vermischung transgener und
Sachschaden, Rückruf ursprünglicher Pflanzenprodukte
Umweltschaden GV-Samen gelangen in die Umwelt
Lagerung, Transport, Verarbeitung
Vermögens- oder evtl. Vermischung transgener und
Sachschaden, Rückruf ursprünglicher Pflanzenprodukte
Anwendung
Personenschaden Allergie (dank aufwändiger Test-
verfahren sehr unwahrscheinlich)
Sachschaden Nutztier erleidet Allergie (s. o.)
Vermögensschaden Nutztier verliert an Wert durch
Fütterung mit GV-Material
24Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
4.4 Nachweismethoden für GV-Anteile und ihre Grenzen
Der qualitative Nachweis gentechnischer Veränderungen
in frischem Pflanzenmaterial ist einfach und selektiv. Ver-
wendet werden Probestreifen, so genannte Lateral-Flow-
Strips (LFS), die ein Protein anzeigen, das für die gentech-
nische Veränderung charakteristisch ist. Dabei genügen
bereits kleine Mengen. Im Gegensatz dazu ist es schwierig –
zum Teil sogar unmöglich –, GV-Anteile in verarbeiteten
Nahrungsmitteln zu quantifizieren. Hier wird kein Protein,
sondern DNA getestet. Starkes Erhitzen, die Anwesenheit
von Säure oder eine Reinigung entfernen oder zerstören
die DNA. In Speiseöl oder Zucker kann man die Herkunft
aus GV-Pflanzen im Endprodukt nicht nachweisen. Das
kann, je nach Beweislage, für Anbieter GV-freier Produkte
problematisch werden. Wird behauptet, es gebe eine Ver-
unreinigung mit GV, wäre das Gegenteil diagnostisch nicht
zu beweisen. Herangezogen werden könnte nur die
Dokumentation zur Herkunft des Produkts.
Bei Produkten mit geringem GV-Anteil ist die mangelnde
Quantifizierungsmöglichkeit problematisch, da die Kenn-
zeichnungspflicht eventuell unwissentlich umgangen wird.
Auch bei Produkten, in denen noch DNA messbar ist,
lassen sich Messergebnisse im Bereich geringer GV-
Anteile nur unzureichend reproduzieren. Genau diese
Messbereiche sind jedoch für die Kennzeichnungs-
schwellenwerte relevant. Schwierigkeiten bei der Messung
gibt es des Weiteren bei Kulturpflanzen mit mehrfachem
Chromosomensatz oder bei Produkten mit teildegradierter
DNA. Die rechtlichen Regelungen definieren die Bezugs-
größe der Prozentangaben nicht. Üblich ist, GV-DNA im
Verhältnis zur nachweisbaren Gesamt-DNA zu messen.
25Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen 4.5 Maßnahmen zum Risikomanagement Je nach Kulturpflanze und Art der Veränderung kann mit unterschiedlich aufwändigen Maßnahmen verhindert werden, dass sich das GV-Merkmal verbreitet. Bis dato wurde jedoch noch keine Zusammenstellung von Vor- sichtsmaßnahmen für den Anbau von GV-Pflanzen ver- öffentlicht. Derartige „Regeln guter fachlicher Praxis“ (gfP) können gemäß GenTG als Verordnung erlassen werden. Im Folgenden sind einige mögliche Risikomanagement- maßnahmen genannt. Für den Einzelfall wären detaillierte Maßnahmen zu formulieren: – Pharming nur in Pflanzen, die nicht als Lebensmittel verwendet werden – Eingangskontrolle (DNA-Arrays) bei Nicht-GVO- Herstellern/-Transporten/-Lagerorten – Sicherstellen der Rückverfolgbarkeit – genügend Abstand zu Nachbarfeldern – Transport in abgedeckten Fahrzeugen – Einhaltung getrennter Warenströme bei Lagerung und Transport – Anbau nur in Gegenden, in denen wenige Wildkräuter aus der gleichen Gattung wachsen – In der EU: Gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) kein Anbau in der Nähe geschützter Flächen. So könnte man die Umwelthaftung nach der EG-Umwelt- haftungsrichtlinie 82004/35/EG vermeiden. 26
Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen
5 Fazit
In manchen Ländern sind gentechnische Anwendungen in
der Landwirtschaft bereits weit verbreitet. In der EU ist die
Problematik der Vermischung von GV-Produkten mit kon-
ventionellen Produkten und der Kennzeichnung von
Lebens- und Futtermitteln zumindest über den Import
schon jetzt relevant. Nach den Freisetzungsversuchen
beginnt derzeit auch in Deutschland der kommerzielle
Anbau. Damit kommen neue Risiken der Verbreitung gen-
technisch veränderter Merkmale, etwa durch Pollenflug,
hinzu. Für die Versicherungswirtschaft ergibt sich die Frage
nach der Deckung des nachbarschaftsrechtlichen Aus-
gleichsanspruchs. Solange das GenTG den Schadenbegriff
nicht klar als „GVO-Eintrag größer 0,9 %“ definiert, muss
der Schadeneintritt nahezu als sicher angesehen werden.
Betrachtet man das Risiko zur Auskreuzung über 0,9 %, so
hängt die Wahrscheinlichkeit des Überschreitens stark von
den Charakteristika der Kulturpflanzen ab. Die Möglichkeit
der Versicherung ist deshalb von Fall zu Fall zu prüfen.
27Münchener Rück, Gentechnisch veränderte Pflanzen Quellen Brandt, P., Transgene Pflanzen, Birkhäuser Verlag, 2004. Clive James, ISAAA briefs “Global status of commercialised transgenic crops: 2004”. Weber, W. et al, „Koexistenz von gentechnisch verändertem und konventionellem Mais“, mais, 2005. http://www.aphis.usda.gov/brs/usergd.html http://www.blackwellpublishing.com/static/ plantgm.asp http://www.bdp-online.de/ http://www.transgen.de 28
Inhalt Für Nachbestellungen nutzen Sie bitte die beiliegende Bestellkarte
unseres Zentrallagers für Publikationen, Tel.: +49 (89) 38 91-27 52,
oder das Publikationsportal der Münchener Rück im Internet
(http://www.munichre.com). Dort können Sie auch alle weiteren
1 Übersicht 1 Veröffentlichungen von Casualty Risk Consulting herunterladen
oder bestellen.
1.1 Begriffe 1
1.2 Mögliche Anwendungsgebiete der Grünen Bisher sind folgende Faltblätter erschienen:
Gentechnik 2 1 Mikrobiologische Bodensanierung
2 Bauschuttdeponien
1.3 Verbreitung 5
3 Holzbearbeitende Betriebe
4 N.A.T.U.R. (Das Münchener-Rück-Softwarepaket hilft bei der
2 Mögliche Gefahren 10 Quotierung von Umweltrisiken.)
5 Tankstellen
2.1 Toxizität bzw. Allergenität der gentechnisch
6 Münchener Ecoconsult GmbH (MEC)
veränderten Pflanze 10 7 Das EG-Öko-Audit
2.2 Auskreuzungen 10 8 Gefahrstoffibel
9 Flachbodentanks
2.3 Wirkung auf Nicht-Zielorganismen 13
10 Flüssiggasanlagen
2.4 Gentechnisch veränderter Pollen im Honig 14 11 Reaktionswände – eine neue Technologie zur Grundwassersanierung
2.5 Auswirkungen auf die Artenvielfalt 15 12 Umweltrisiken in der industriellen Landwirtschaft
13 Oberflächenreinigung von Metallen
14 Haftpflichtrisiken im Internet für kleine und mittlere Unternehmen
3 Rechtliche Situation 15 15 Gefährdungszonen
3.1 Cartagena-Protokoll 15 16 Umweltmanagementsysteme
17 Internet und Versicherung, Kompendium zum Workshop der
3.2 EG-Freisetzungs-Richtlinie (2001/18/EG) 16
Münchener Rück
3.3 EG-Verordnung 1829/2003 über die Zulassung und 18 Risikomanagement von Omnibussen
Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 19 Risikomanagement von Eisenbahnen
20 Rückrufrisiko für Zulieferfirmen der Automobilindustrie
Lebens- und Futtermitteln 18
3.4 Das Deutsche Gentechnikgesetz (GenTG) 19
3.5 EG-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 20 © 2005
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Königinstraße 107
4 Versicherungsrelevante Aspekte 21 80802 München
4.1 Haftpflichtschäden 21 Telefon: +49 (89) 38 91-0
4.2 Umweltschäden 23 Telefax: +49 (89) 39 90 56
http://www.munichre.com
4.3 Wo kommt es zu Schäden? 23
4.4 Nachweismethoden für GV-Anteile und Verantwortlich für den Inhalt
ihre Grenzen 25 Corporate Underwriting/Global Clients
Casualty Risk Consulting (CRC)
4.5 Maßnahmen zum Risikomanagement 26
Ihr Ansprechpartner
5 Fazit 27 Dr. Sabine Eberhardt
Telefon: +49 (89) 38 91-57 23
Telefax: +49 (89) 38 91-7 57 23
E-Mail: seberhardt@munichre.com
Druck
Lipp GmbH, Graphische Betriebe, Meglingerstraße 60, 81477 MünchenCasualty Risk Consulting
Informationen für Versicherer
21 Gentechnisch veränderte
Pflanzen
© 2005
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Königinstraße 107
80802 München
Bestellnummer 302-04743Sie können auch lesen