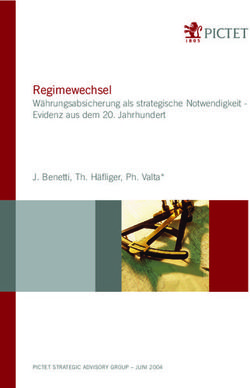AKTIONSPLAN FÜR NACHHALTIGE ENERGIE (APNE) - für die Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Impressum
Die Erarbeitung wird von der Energieagentur der Regionen (RENA) im Auftrag der Marktgemeinde Laxenburg durchgeführt.
Das Projektteam bedankt sich ganz herzlich bei allen,
die persönlich und/oder fachlich zur Erstellung des Berichtes beigetragen haben.
Projektteam der Energieagentur:
Mag. Renate Brandner-Weiß
Dr. Horst Lunzer
Verfasst von: Energieagentur der Regionen
Aignerstraße 1
3830 Waidhofen an der Thaya
T: 02842 / 9025 - 40871
F: 02842 / 9025 - 40870
E: energieagentur@wvnet.at
www.energieagentur.co.at
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 2Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011 Vorbemerkungen zur Erstellung des APNE Laxenburg Die Versorgung mit Energie ist eine Voraussetzung für das Funktionieren unserer Gesellschaft und somit auch unserer kommunalen gesellschaftlichen Strukturen. Daher empfiehlt sich gerade hier die Arbeit nach Leitbildern, welche Bedarf und Verfügbarkeit berücksichtigen. Der oft sorglose Umgang mit Energie in unserer stark industrialisierten Gesellschaft beruht noch immer zum allergrößten Teil auf der Verfügbarkeit und Verwendung fossiler Energieträger. Dies hat auf Menschen und Umwelt nachgewiesenermaßen äußerst schädliche Auswirkungen. Die Abhängigkeit von einigen international agierenden Anbietern, deren Produkte die Versorgungssysteme dominieren, zwingt bei allen Entscheidungen zur Berücksichtigung von deren Angebot und deren Preis und lässt für andere, regional angepasste und sinnvolle Lösungen oft wenig Spielraum. Mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister (Convent of Mayors; CoM, der Erarbeitung des Energiekonzeptes sowie der Erstellung des Aktionsplans für nachhaltige Energie werden von der Marktgemeinde Laxenburg grundlegende Schritte und wichtige Signale gesetzt. Damit wird auf der so wichtigen kommunalen Umsetzungsebene an der Realisierung der EU -20-20-20-Ziele gearbeitet: Unter dem Motto "20-20-20 bis 2020" sollen Treibhausgasemissionen um 20%, der Gesamtanteil an erneuerbaren Energien soll in der EU auf 20% steigen und die Energieeffizienz ebenso um 20% erhöht werden. Das vorliegende Dokument soll in möglichst kompakter Form die Aktivitäten zusammenfassen. Auf weiterführende bzw. verwandte Themen, Aktivitäten und Massnahmen in und von der Marktgemeinde Laxenburg in anderen Bereichen kann daher hier nicht Bezug genommen werden. Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 3
Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Erstellungsprozess und Zeitplan zur Erstellung des Aktionsplans für Nachhaltige Energie
Dieser umfassende Prozess der Erstellung des APNE wurde mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister gestartet und im Oktober 2011
abgeschlossen.
Zentrale Schritte zur Erstellung waren die Datensammlung und Aufbereitung sowie ausgehend von den 20-20-20-Zielen die Erarbeitung des
Maßnahmenkataloges.
Das Basis-Emissionsinventar wurde als Voraussetzung für den APNE möglichst lückenlos erstellt. Als Basisjahr wurde 2008 gewählt.
Die Arbeiten für das kommunale Energiekonzept (Herbst 2010 bis Herbst 2011) erfolgten in koordinierter Form mit den Aktivitäten zum Konvent der
Bürgermeister und stellten damit eine Stärkung dieses Themenbereichs dar.
Arbeitsplan zur Erstellung des Aktionsplans für Nachhaltige Energie Laxenburg
Nr. Arbeitsschritt Bereich
1 Datenerhebung Wärme, Strom, Mobilität
2 Fertigstellung Basis-Emissionsinventar Wärme, Strom, Mobilität
3 Entwurf Zielkatalog und Massnahmen Wärme, Strom, Mobilität
4 Zieldefinition und Massnahmenkatalog finalisieren Wärme, Strom, Mobilität
Fertigstellung Aktionsplan für Nachhaltige Energie, Dokumentation für
5 Massnahmenumsetzung bzw. -vorbereitung Wärme, Strom, Mobilität
6 Umsetzung in Abstimmung mit anderen Aktivitäten Wärme, Strom, Mobilität
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 4Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Zusammenfassung
Der gesamte Bedarf an Endenergie für Laxenburg beträgt für 2008 etwa 61 GWh (Gigawattstunden).
Davon wird mehr als die Hälfte für Wärme (Raumwärme + Warmwasserbereitung bzw. Heizung + Prozesswärme) verwendet. Der Rest verteilt sich auf
elektrischen Strom und Energiebedarf für Mobilität.
Wie die Grafiken zeigen, dominiert beim Bedarf der Wärmesektor mit fast 70 %, gefolgt vom Bereich Verkehr mit über 20 % und dem Strom mit rund
10 %. Die Treibhausgas-Emissionen für Wärme-Strom-Verkehr sind aufgrund der überwiegenden Nutzung fossiler Energieträger sehr ähnlich.
Energiebedarf nach Sektoren Treibhausgas-Emissionen nach Sektoren
9% 10%
22%
30%
Strom Strom
W ärme
Verkehr Wärme
Verkehr
61%
69%
Die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen () inklusive aller damit verbundenen Vorprozesse betragen rund 17 000 Tonnen CO2-Äquivalent.
Um eine Vergleichszahl zu erhalten, wird dieser Wert auf die Bevölkerungszahl bezogen (2715 Personen). Als Ausgangswert für 2008 ergibt sich
damit ein Pro-Kopf-Wert an Treibhausgasemissionen in Höhe von 6,2 Tonnen pro Jahr.
Entsprechend dem Beschluss zum Beitritt des Konvents der Bürgermeister wurde die Zieldefinition für die Reduktion der Treibhausgase in der
Marktgemeinde Laxenburg mit 20 % beschlossen.
Konkrete Zielsetzung der Marktgemeinde Laxenburg bis 2020 ist die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen pro Kopf um 20 %, d.h. auf knapp 5
Tonnen pro Kopf und Jahr.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 5Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Wie aus der nachstehenden Grafik ersichtlich, überwiegen die fossilen Energieträger Erdgas und Erdöl bei weitem. Biomasse bzw. andere
erneuerbare Energieträger tragen aktuell nur ganz wenig zur Gesamtenergieversorgung in Laxenburg bei.
Ganz abgesehen von der bereits spürbaren Verteuerung kann langfristig die Versorgung mit fossilen Energieträgern nicht garantiert werden.
Damit wird klar:
Nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch im Sinne der Versorgungssicherheit ist ein Umsteuern in Richtung mehr Effizienz und erneuerbare
Energieträger unbedingt notwendig.
Energiebedarf nach Energieträger
0,0%
1,5%
0,1% Strom
19,0% 22,1% Nahwärme
Erdgas
Flüssiggas
0,2% 0,5% Mineralölprodukte
Braunkohle
Steinkohle
Biokraftstoff/ Biobrennstoff
56,6%
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 6Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Die folgende Grafik zeigt die enormen Einsparpotenziale im Bereich Wärme, denn die bestehenden Gebäude sind im Durchschnitt weit über dem
Verbrauch von Niedrigenergie- oder Passivhäusern.
Hier ist die Verbesserung der Bauqualität bei Neubauten und im Bestand ebenso notwendig wie sinnvoll. Kurz gefasst, lässt sich der Energiebedarf
hier auf die Hälfte gegenüber bisher bzw. noch mehr reduzieren.
Wärmebedarf und Einsparpotenzial in MWh
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Wärmebedarf Einsparpotenzial Einsparpotenzial Einsparpotenzial
Gemeindeobjekte Betriebe Wohnobjekte
Wichtig ist zu sehen, wie groß die Einsparmöglichkeiten sind bzw. wie sehr sich damit der Energiebedarf reduzieren und gleichzeitig der
Anteil der erneuerbaren Energieträger steigern lässt.
Im Folgenden wird das Basis-Emissionsinventar dargestellt, darauf folgen die Potenziale bzgl. Energieeffizienz und erneuerbare Quellen als
Grundlage für den geplanten Massnahmenkatalog.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 7Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
*
Im Folgenden wird das Basis-Emissionsinventar 2008 dargestellt und zwar mit folgenden Tabellenblättern:
• Endenergieverbrauch in MWh (Megawattstunden)
• Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2-Äquivalent
• Lokale Energiebereitstellung in MWh (Megawattstunden)
Endenergieverbrauch (MWh)
Kategorie Fossile Brennstoffe Erneuerbare Energien
Wärme/ Sonstige Biokraftstof
Strom Sonstige Solar Geo Gesamt
Kälte Erdgas Flüssiggas Heizöl Diesel Benzin Braunkohle Steinkohle fossile Brenn- Pflanzenöl f/ Biobrenn-
Biomasse thermie thermie
stoffe stoff
Gebäude, Anlagen/Einrichtungen
und Industrie: 0
Kommunale Gebäude,
Anlagen/Einrichtungen 475 942 1.416
Tertiäre (nicht kommunale)
Gebäude, Anlagen/Einrichtungen 40 125 165
Wohngebäude 5.474 305 19.194 41 1.957 12 62 440 57 94 27.638
Öffentliche kommunale
Beleuchtung 132 132
Industrie (ohne Branchen, die sich
am Europäischen
Emissionshandelssystem
beteiligen) 7.367 14.318 66 4.395 1 469 26.616
Zwischensumme Gebäude,
Anlagen/Einrichtungen und
Industrie 13.488 305 34.579 107 6.352 0 0 12 63 0 0 910 0 57 94 55.968
Verkehr: 0
Kommunale Fahrzeugflotte 1.312 15 1.328
öffentlicher Verkehr 0
privater und gewerblicher Verkehr 1 2.421 1.518 109 68 4.116
Zwischensumme Verkehr 1 0 0 0 0 3.733 1.533 0 0 0 0 109 68 0 0 5.443
Gesamt 13.489 305 34.579 107 6.352 3.733 1.533 12 63 0 0 1.019 68 57 94 61.411
ggf. kommunale Beschaffung von
zertifiziertem Ökostrom (MWh) Holz Stroh/Sonstige BM
CO2-Emissionsfaktor für den
Ankauf von zertifiziertem Ökostrom
(für den LCA-Ansatz) 0,04 Biodiesel Bioethanol
*
Als Basisjahr wurde aus Gründen der Datenverfügbarkeit das Jahr 2008 gewählt.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 8Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Bezüglich Treibhausgasemissionen zeigt sich folgendes Bild (s. nachstehende Tabelle). Auch hier beziehen sich die Daten auf das Jahr 2008.
CO2 -Emissionen (t)/CO2-äquivalente Emissionen
Fossile Brennstoffe Erneuerbare Energien
Kategorie Sonstige
Wärme/ Biokraftstof
Strom Braun- fossile Sonstige Solar Geo Gesamt
Kälte Erdgas Flüssiggas Heizöl Diesel Benzin
kohle
Stein-kohle
Brenn-
Pflanzen-öl f/ Biobrenn-
Biomasse thermie thermie*
stoff
stoffe
Gebäude, Anlagen/Einrichtungen und
Industrie: 0
Kommunale Gebäude,
Anlagen/Einrichtungen 176 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399
Tertiäre (nicht kommunale) Gebäude,
Anlagen/Einrichtungen 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Wohngebäude 2.024 10 4.549 13 607 0 0 5 24 0 13 0 1 10 7.255
Öffentliche kommunale Beleuchtung 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Industrie (ohne Branchen, die sich am
Europäischen
Emissionshandelssystem beteiligen)
2.724 0 3.393 21 1.362 0 0 0 0,3 0 14 0 0 0 7.515
Zwischensumme Gebäude,
Anlagen/Einrichtungen und
Industrie 4.988 10 8.195 34 1.969 0 0 5 25 0 0 26 0 1 10 15.262
Verkehr: 0
Kommunale Fahrzeugflotte 0 0 0 0 0 400 5 0 0 0 0 0 405
öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
privater und gewerblicher Verkehr 0,2 0 0 0 0 738 454 0 0 0 17 14 1.223
Zwischensumme Verkehr 0 0 0 0 0 1.139 458 0 0 0 0 17 14 0 0 1.628
Sonstiges: 0
Abfallwirtschaft 0
Abwasserwirtschaft 0
Sonstige Emissionen 0
Gesamt 4.988 10 8.195 34 1.969 1.139 458 5 25 0 0 43 14 1 10 16.890
entsprechende CO2-Emissionen
(t/MWh) 0,370 0,032 0,237 0,313 0,310 0,305 0,299 0,375 0,393 0,182 0,029 0,030 0,017 0,106 in CO2-Äquiv.
CO2-Emissionsfaktor für nicht lokal
*als Wärmepumpe mit
erzeugten Strom (t/MWh)
0,370 0,156 0,206 JAZ=3,5
Stroh/S
lokaler Emissionsfaktor für elektrische onstige
Energie [t/MW he] 0,370 Holz BM
Gesamtstromverbrauch der Stadt bzw. Bio- Bioetha Für Beimeng-
Gemeinde [MWh] 13.489 diesel nol 4,30% 2008 verordnung
lokal erzeugter Strom [MWh] 9
Bezug von Ökostrom durch die Stadt bzw.
Gemeinde [MWh] 0
landesspezifischer /europ. Emissionsfaktor
für elektrische Energie [t/MWh e] 0,37
CO 2-Emissionen durch die lokale
Stromerzeugung [t] 0,2
Zur Berechnung/Quelle:
Emissionswerte stammen aus dem Guidebook für APNE/SEAP, falls keine Werte angegeben aus GEMIS 4.6, Österreich, ebenso für Strom
Werte auf LCA-Basis inkl. Vorprozesse in CO2-Äquivalenten.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 9Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Die lokale Energiebereitstellung für Strom und Wärme stellt sich anhand der bisher verfügbaren Daten wie folgt (s. nachstehende Tabellen) dar.
entsprechende CO2
Lokal erzeugter Strom (ohne Anlagen,
lokal Energieträger-Input (MWh) CO2-/CO2- Emissionsfaktoren
die unter das
erzeugter sonstige äquivalente für die
Emissionshandelssystem fallen, und fossile Brennstoffe Sonstige
Strom (MWh) Dampf Abfall Pflanzenöl erneuerbare Sonstige Emissionen [t] Stromproduktion in
alle Anlagen/Blöcke > 20 MW) Biomasse Energien
Erdgas Flüssiggas Heizöl Braunkohle Steinkohle t/MWh
Windkraft 0,007
Wasserkraft 0,024
Photovoltaik 9 0,2184 0,024
Kraft-Wärme-Kopplung
Sonstiges
Gesamt 9 0,2184
entsprechende
lokal CO2-/CO2-
CO2 Emissions-
erzeugte Energieträger-Input (MWh) äuquivalente
Lokal erzeugte Wärme/Kälte sonstige faktoren für die
Wärme/Kälte fossile Brennstoffe Sonstige Emissionen
Abfall Pflanzenöl erneuerbar Sonstige Wärme-
(MWh) Erdgas Flüssiggas Heizöl Braunkohle Steinkohle Biomasse [t]
e Energien /Kälteerzeugung
Kraft-Wärme-Koppelung
Fernwärme-Kraftwerke 305 340 0,032
Sonstiges
Gesamt 305 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0
Im Folgenden werden die Potenziale bzgl. Energieeffizienz und erneuerbare Quellen als Basis für den geplanten Massnahmenkatalog detailliert
dargestellt.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 10Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Potenzial Energieeffizienz – Basisdaten, Begriffe, Richtwerte
Gesamtes Einsparpotenzial (abgeschätzt)
Verringerung des
Sektor Bereich Sektor Energiebedarfs
um
Infrastruktur Wärme 19%
Strom 14%
Wohnobjekte Wärme 55%
Strom 25%
Betriebe/ Gewerbe Raumwärme Wärme 30%
Strom 30%
Individualverkehr Maßnahmenmix Verkehr 30%
Elektromobilität Verkehr 75%
Laxenburg gesamt mit Verkehrsmaßnahmenmix 36%
mit Elektromobilität 50%
Richtwerte Wärmedämmung
Energieeffizient bauen bzw. modernisieren! - Dämmen bringt’s!
Die Qualität der Wärmedämmung der Außenbauteile ist die mit Abstand wichtigste Größe für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
Das Niedrigenergiehaus ist ein Haus mit sehr geringem Heizenergiebedarf und bietet hohe Behaglichkeit.
Das Passivhaus nutzt die Sonnenenergie durch seine Architektur und benötigt aufgrund des sehr sehr geringen Heizenergiebedarfs kein
konventionelles Heizsystem.
U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient (frühere Bezeichnung: k-Wert Einheit: W/m2K):
Ist ein Maß für den Wärmeschutz eines Bauteils und besagt, wie viel Wärmeleistung pro m2 Bauteilfläche bei einem Temperaturunterschied
von 1°C (1 Kelvin) durch den Bauteil fließt.
Energieausweis (Energiepass)= Berechnungsverfahren für Heizenergiebedarf
Im Energieausweis wird mittels eines Berechnungsverfahrens der jährliche Heizenergiebedarf bzw. die Energiekennzahl eines Gebäudes
berechnet.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 11Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Richtwerte Wärmedämmung
Je kleiner der U-Wert, umso besser der Wärmeschutz!
Bauteil Niedrigenergie-Standard (EKZ < 50) Passivhaus-Standard (EKZ < 15)
U-Wert U-Wert
Dämmstärke*
in W/m2K Dämmstärke*in cm in W/m2K
in cm
(maximal) (maximal)
Außenwände 0,16 18-20 cm 0,1 mind. 38 cm
Fenster Wärmeschutz- Wärmeschutz-
(U-Wert gesamt!, 1,1 Verglasung 0,8 Verglasung
d.h. inkl. Rahmen!) 2-fach 3-fach
Oberste Decke/ Dachschräge 0,15 25-30 cm 0,1 mind. 38 cm
Kellerdecke, erdberührter
0,2 15 cm 0,15 mind. 20 cm
Fußboden
* Die angegebenen Dämmstärken sind Richtwerte, die sich auf handelsübliche Dämmstoffe mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) von 0,040 W/mK beziehen. Bei
Maßnahmen im Bestand ist die Dämmstärke je
nach vorhandener Konstruktion zu variieren.
Wer an Dämmstärken spart, handelt kurzsichtig! ---
Denn damit wird Einsparpotenzial nicht genutzt und spätere Verbesserungen der Dämmung sind im Vergleich aufwendig und kostspielig.
Für die Einschätzung der Energieeffizienz bzgl. Wärme- und Stromverbrauch, insbesondere bei Haushalten ist folgende – auch von der
Energieberatung NÖ verwendete – Darstellung anhand der Energiekennzahl gebräuchlich.
Energiekennzahl:
Die Energiekennzahl, die der Energieausweis angibt, ist der berechnete Heizenergiebedarf eines Gebäudes und zwar pro Quadratmeter
Bruttogeschoßfläche und Jahr.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 12Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Potenzial Energieeffizienz beim Wärmebedarf
Hier kann durch Verbesserung der Bauqualität bei Neubauten und Sanierungen der größte Anteil an Energie eingespart werden. Das
Einsparungspotenzial beim Wärmebedarf liegt erfahrungsgemäß bei 30% bis 50%.
Potenzial Energieeffizienz beim Strombedarf
Hier lassen sich durch effizientere Geräte und Anlagen, Leuchtmittel und optimierte Steuerung bzw. geändertes Nutzungsverhalten in Summe 10 bis
zu 30% des Energiebedarfs einsparen.
Potenzial Energieeffizienz bei Mobilität/Individualverkehr
Hier geht es um den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel, Transport der Güter vermehrt auf der Schiene,
geändertes Nutzungsverhalten und Ökodrive-Fahrweise, höhere Besetzungsdichte der Pkws und Umstellen der Flotte auf sparsamere Kraftfahrzeuge
sowie Vermeidung von Kurzstrecken.
Ein weiterer Effizienzsprung ist durch den Umstieg auf Elektromobilität möglich.
Potenzialabschätzung erneuerbare Energiequellen
Das Potenzial erneuerbarer Energiequellen ist in seiner Vielfalt und im Ausmaß sehr groß. Die folgende Darstellung fasst ausgewählte zentrale
Quellen und deren Potenzial bezogen auf die Marktgemeinde Laxenburg zusammen.
Allerdings ist, ausgehend von diesem technischen Potenzial auch die Berücksichtigung anderer Aspekte wesentlich, insbesondere rechtlicher
Rahmenbedingungen (Mindest-Abstandswerte zu bewohntem Gebiet, …).
Aufgrund der Wichtigkeit sei nochmals erwähnt, dass aus Ressourcen- und Klimaschutzgründen die Optimierung von Prozessen in Richtung
Energieeffizienz immer der erste Schritt sein muss.
Denn aus aktueller Sicht, d.h. ausgehend vom aktuellen Bedarf stellen die Energieeffizienz-maßnahmen das höchste Potenzial dar.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 13Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Potenzial Biomasse - Energetische Nutzung des Waldes
Das Gemeindegebiet ist mit 99 ha Wald bedeckt, dies ist verglichen mit vielen österreichischen Gemeinden prozentuell zur Gesamtgemeindefläche
eher gering (9% der Gemeindefläche). Der Anteil könnte um ~409 MWh auf 1.702 MWh erhöht werden (bis sich Zuwachs und Nutzung die Waage
halten). Im Vergleich dazu: der Holzbedarf in der Gemeinde liegt bei ~2.530 MWh (inklusive Biomasseabfälle), der gesamte Wärmebedarf bei ~44.600
MWh.
Eine vollständige Deckung aus dem im Gemeindegebiet wachsenden Wald ist ohne Effizienzmaßnahmen sicher nicht möglich. Dies ist ein weiterer
Grund, warum Effizienzmaßnahmen im Sinne der Versorgungssicherheit unbedingt nötig sind. Der weitere Teil des Holzbedarfs könnte regional aus
dem Alpenvorland bzw. Wienerwald geliefert werden.
Potenzial Biomasse – Biogas (inkl. Deponie- und Klärgas)
Es besteht derzeit keine Biogasanlage im Gemeindegebiet.
Ausgehend vom anfallenden Grünschnitt (rund 1.500 Tonnen/Jahr) und der anfallenden Tiergülle in der Gemeinde (62.000 m³ Biogas aus 2.650 t
Gülle/a) könnte – bei Verwendung in einem Biogas-Blockheizkraftwerk ein Kraftwerk mit rund 100 kW elektrischer Leistung betrieben werden. Damit
könnten über 780 MWh Strom und Wärme pro Jahr erzeugt werden, damit wird ein wesentlicher Beitrag zur stärkeren Eigenversorgung mit Strom und
Wärme geleistet. Die Wärme sollte über ein Nah-/Fernwärmenetz genutzt werden. Reine Stromerzeugung ohne Wärmenutzung ist ökologisch nicht
sinnvoll und im übrigen auch meist unwirtschaftlich.
Anstelle von Grünschnitt können aber auch biogene Reststoffe aus der Landwirtschaft (Ackerbau und Viehzucht) verwendet werden. Eine
Modellrechnung, die davon ausgeht, dass z.B. rund 13% (60 ha) der nicht landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde für ein Biogas-
Blockheizkraftwerk verwendet werden, ergibt den Betrieb eines Kraftwerks mit rund 100 kW elektrischer Leistung. Damit könnten je 0,8 GWh Strom
und Wärme pro Jahr erzeugt werden.
Potenzial Sonnenenergie: Solarwärme und Solarstrom
Die Globalstrahlung beträgt in Laxenburg hohe 1.114 kWh/m²a. Die Nutzung solarthermischer Energie ist nach Erhebung in ~6% der Haushalte in der
Gemeinde vorhanden.
Alleine die Wohnobjekte der Gemeinde verfügen über eine etwa 23.000 m² Dachfläche. Etwa 30% wird als geeignet angenommen (keine
Verschattung, südseitig ausgerichtete Dachfläche, technische Umsetzbarkeit). Damit lassen sich Solarstrom oder -wärme gewinnen (s. Tabelle):
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 14Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Geeignete Dachflächen in Laxenburg (Beispielhafte Abschätzung)
m² Dachfläche geeignet MWh Strom PV MWh Wärme Solarthermie
Betriebe 1.530 191 536
Wohnobjekte 5.421 678 1.897
Gemeindeobjekte 3.382 423 1.184
Gesamt 10.333 1.292 3.617
Zum Vergleich: Der Warmwasserbedarf der Gemeinde liegt bei etwa 3.100 MWh. Der Strombedarf der Gemeinde liegt bei 12.465 MWh.
Potenzial Wasserkraft
Das niederösterreichische Wasserbuch gibt keine Wasserkraftanlagen am Gemeindegebiet von Laxenburg aus.
Am Gemeindegebiet sind folgende Gewässer (mit eher niedriger Strömungsgeschwindigkeit) vorhanden: Schwechat, Wiener Neustädter Kanal,
Laxenburger Kanal und Haidbach.
Potenzial Windenergie
Windkraftanlagen verwenden nur die Energie aus bewegter Luft, um elektrischen Strom zu erzeugen.
Eine moderne Windkraftanlage hat zwei MW (MW= Megawatt) Leistung, hat eine Turmhöhe von ca. 100m, 80 bis 90m Durchmesser und erzeugt
jährlich rund 4,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht dem Strombedarf von rund 1.200 Haushalten oder einer CO2-Reduktion von rund
3.500 Tonnen.
Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit in 50 m Höhe beträgt im Gemeindegebiet rund 6,8 m/s und ist für Windkraftanlagen als eher hoch
einzustufen. Dementsprechend ist auch das Potenzial für Windkraftnutzung zu bewerten.
Weiters ist, ausgehend von diesem technischen Potenzial auch die Berücksichtigung anderer Aspekte wesentlich, insbesondere rechtlicher
Rahmenbedingungen (Mindest-Abstandswerte zu bewohntem Gebiet, …).
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 15Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Potenzial Tiefengeothermie und Abwärme
Tiefengeothermie ist anhand der geologischen Struktur als günstig zu bewerten
(Wiener Becken).
Die abgebildete Bohrung Laxenburg 2 zeigt in 3.060 m Tiefe ein günstiges
Temperaturniveau (98°C) und eine Schüttung von 9 m³/min.
Aus Godfrid WESSELY Zur Geologie und Hydrodynamik im südlichen Wiener Becken
und seiner Randzone Mitt, österr. geol. Ges. 76; 1983 S. 27—68, 8Taf. Wien, 15.
Dezember 1983
Die Verwendung bereits bestehender Bohrlöcher kann einen großen Teil der hohen
Kosten einsparen. Wichtig ist eine hohe Wärmeabnahme bzw. Anschlußdichte entlang
des Fernwärmenetzes. Bei den zu erwartenden Temperaturen könnte mittels ORC-
Prozess aus der Erdwärme auch elektrischer Strom gewonnen werden. Auch in
Leopoldsdorf ist man an einer tiefengeothermischen Lösung interessiert. Es kann
durchaus eine Fernwärmelösung entstehen, die gemeindeübergreifend ist.
Ø Unter allen erneuerbaren Energieträgern hat weltweit die Tiefengeothermie
gegenwärtig die geringsten Emissionswerte bei den verursachten Treibhausgasen
bei Mitbetrachtung aller vorgelagerten Prozesse.
Ø Es müssen die geologischen Rahmenbedingungen passen und da speziell die
Bohrungen sehr kostenintensiv sind, rechnen sich tiefengeothermische Anlagen
erst bei größeren Wärmeabnahmemengen.
Ø Tiefengeothermische Energie ist der einzige erneuerbare Energieträger, der
unabhängig von der Sonne ist. Diese Energie steht ganzjährig zur Verfügung. Das
ausgekühlte Tiefenwasser wird wieder über eine Reinjektionsbohrung in den
Untergrund verpresst, wodurch es seine Temperatur wieder auflädt.
Ø Der obertägige Platzbedarf ist äußerst gering und üblicherweise kaum anfällig
hinsichtlich Störungen.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 16Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Katalog der geplanten Massnahmen
Der Weg zur Treibhausgasreduktion erfolgt durch zwei Massnahmenbündel. Wie weiter oben ausgeführt, geht es um die Hebung der Potenziale im
Bereich Energieeffizienz sowie um den Ersatz – der in Zukunft wohl nur bedingt bzw. sehr hochpreisig verfügbaren - fossilen Energieträger durch
einen Nutzugsmix der erneuerbaren Quellen möglichst aus der Gemeinde selbst oder aus der Region.
Dabei geht es um Massnahmen in allen drei Bereichen, d.h. beim Bedarf für Wärme, Strom und Mobilität, z.B. Information und Bewusstseinsbildung,
aber auch Hilfestellungen bei der Umsetzung bis hin zur Umsetzung von Vorbildprojekten (auch bei Gemeindeobjekten).
Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Energie und damit verbundenen Klimaschutz sind Bedarfs- und Kostensenkungen in allen Bereichen,
insbesondere auch in den Privathaushalten möglich. Außerdem werden Projektmöglichkeiten erkannt, die wirtschaftlich und ökologisch sind und
zusätzlich Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region sichern bzw. schaffen können.
Im Rahmen der Erstellung des Energiekonzeptes und des Aktionsplanes wurden bereits Maßnahmen gesetzt. Dies sind z.B. die Vorbereitung
bezüglich Einführung der Energiebuchhaltung für die Gemeindeobjekte sowie Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Einbindung der
Bevölkerung bzw. wichtiger Teilgruppen.
Bewusstseinsbildung mit Hilfe geförderter Beratungsangebote
• Energieberatung für Haushalte
• Energieberatung für Betriebe
• Energieberatung für die Landwirtschaft
Information zur Steigerung der Energieeffzienz
• Energiesparende Betriebsführung von Heizungs- und anderen Anlagen
• Durchführung von Thermografien
• Exkursionen zu Beispielobjekten und Anlagen
(z.B. in ein Passivhaus, ein Niedrigstenergiehaus, Ökostromkraftwerk)
• Energiebuchhaltung in Gemeinde, Betrieben und Haushalten
• Ökodriving
• Vermeidung von Kurzstrecken mit dem Kfz und Förderung von Fahrgemeinschaften
• Ausbau Radwege und öffentlicher Verkehrsmittel (inkl. Anschlüsse, Taktfahrplan, …)
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 17Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Initiierung von Gemeindeprojekten zur Bewusstseinsbildung und Motivation der Bevölkerung bzgl. Energiesparen,
Energieeffizienz und erneuerbaren Energiequellen
• Unterstützung bei Projekten, die im Unterricht anknüpfen und spielerisch bewussten Umgang mit „Energie“ fördern
• Energieschwerpunkt in der Bibliothek
• Solarthermischen oder Photovoltaik-Anlage an einem öffentlichen Gebäude (event. mit Bürgerbeteiligung)
Maßnahmenplan der Marktgemeinde im eigenen Wirkungsbereich
Der folgende Maßnahmenkatalog bezieht sich auf die Gemeindeobjekte.
Die wichtigsten Maßnahmen stellen die Energiebuchhaltung, Optimierung der Regelungen, Wärmedämmmaßnahmen, Nutzermotivation,
Tausch alter Geräte zur Kühlung und Optimierung der Beleuchtung dar. Details zu den Massnahmen sind im Rahmen des
Energiekonzeptes erarbeitet worden und entsprechend dokumentiert.
Basismaßnahme Energiebuchhaltung
Die Aufzeichnung des Energiebedarfs erfolgt seit einigen Jahren in einem Tabellenkalkulationsprogramm.
• Im Zuge der Erstellung des Energiekonzepts wurde die Energiebuchhaltung für folgende Gemeindegebäude vorbereitet:
• Rathaus
• Kindergarten Hofstraße
• Kindergarten Friedrich Rauch - Gasse
• Volksschule
• Bücherei & Mediathek
• Feuerwehrhaus
Das System
dokumentiert Energiebedarf und Kosten
zeigt Einsparpotenziale
macht Mängel bei Anlagen und Nutzungsverhalten sichtbar
macht Einsparerfolge sichtbar und präsentierbar
Dadurch wird es möglich, weitere Maßnahmen wie beispielsweise Dämmung der Gebäudehülle, Nachtabsenkung der Heiztemperatur,
Bewegungsmelder für die Beleuchtung, zu bewerten. Durch die Quantität und Qualität der aufgezeichneten Energiedaten und der
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 18Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
graphischen Aufbereitung, ist es möglich, die Veränderung des Energiebedarfes – den Erfolg - aufgrund der umgesetzten Maßnahmen
sichtbar und für die Öffentlichkeit verständlich zugänglich zu machen.
Berichte können verschiedensten Personen automatisch - per Mail - zugestellt werden. Jeder Nutzer erhält die für ihn persönlich relevanten
Informationen, das bringt kontrollierten Informationsfluss anstatt unübersichtlicher Informationsflut.
Kennzahlen machen einen Vergleich des Energiebedarfes von Objekten verschiedenster Nutzungsarten möglich. Über den
Vergleichsbericht wird erkennbar, wo Handlungsbedarf gegeben ist und wo das Setzen einer bestimmten Maßnahme den größten Nutzen
bringt; insbesondere z.B. die Errechnung des Verbrauchs pro genutztem Quadratmeter Fläche zeigt beim Vergleich von Objekten
Einsparpotenziale auf.
Contracting als innovative Möglichkeit zur Entlastung des Gemeindebudgets
Contracting ist ein Modell zur Drittfinanzierung, durch das Einsparungen an Energie und Kosten bei gleichzeitiger Erhaltung, Verbesserung
oder Erneuerung von Anlagen oder Gebäuden durchgeführt werden können. Dies erfolgt entweder ganz ohne Belastung für das
Gemeindebudget oder unter Einbeziehung eines Baukostenzuschusses.
Bei Projekten, die größere Investitionen erfordern, kann Contracting die Umsetzung erleichtern und sollte daher als Option geprüft werden.
Optimierung der Regelungen
Optimierung der Heizzeiten und der Raumtemperaturen in folgenden Objekten:
o Bücherei Mediathek
Wärmedämmmaßnahmen
Dämmung oberste Geschoßdecken/Decke zu EG, Türen:
o Feuerwehrhaus
Dämmung der Außenwände:
o Feuerwehrhaus
Dämmung Fußböden:
o Bücherei & Mediathek
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 19Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Stromsparmaßnahmen
Umwälzpumpentausch (drehzahlgesteuert):
o Feuerwehrhaus
Optimierung der Beleuchtung
Die Optimierung der Beleuchtung (effiziente Leuchtmittel, optimale Regelung) kann Einsparungen bringen, und zwar konkret in fast allen
Gebäuden.
o Bücherei & Mediathek
o Feuerwehrhaus
Bewusstseinsbildung und Nutzungsmotivation
Die Nutzung eines Gebäudes ist ein wesentlicher Faktor für den Energiebedarf, d.h. je nach Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer steigt
oder sinkt der Energiebedarf.
• Workshops oder Vorträge zur Bewusstseinsbildung und Nutzungsmotivation
• Durch die Motivation und Schulung der Gebäudenutzer kann ein Einsparpotenzial an Energie und Wasser gehoben werden, das großteils
oder ganz ohne investive Maßnahmen auskommt (insbes. in Objekten wie Rathaus, Kindergärten und Schule).
• Die Höhe der Einsparung ist abhängig vom Wissen, aber auch der Motivation und Bereitschaft der beteiligten Personen, das erlernte
Wissen umzusetzen.
• Die Beauftragung von „Energieverantwortlichen“ für die einzelnen Gebäude könnte die Einsparungen nachhaltig sichern und ist daher
jedenfalls empfehlenswert.
Vermeidung von Stand-by
• Durch Abschalten oder Ausstecken wird der unnötige Strombedarf bei Elektrogeräten vermieden. Ältere Geräte brauchen im Stand-by-
Modus fast genauso viel Energie wie im Vollbetrieb (z.B. Gemeindeamt, Volksschule).
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 20Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011 Anhang: Hinweise zur Erstellung und Berechnungen des Basis-Emissionsinventars Im Folgenden werden Details zu den Angaben und Annahmen der Berechnung des Basis-Emissionsinventars dargestellt. Energiebedarf für 2008: Das Basis-Emissionsinventar (BEI) wurde für das Ausgangsjahr 2008 festgelegt, da für dieses Jahr eine gute Datenlage besteht. Die Treibhausgase wurden auf LCA-Basis inklusive Vorprozesse als CO2-Äquivalent berechnet. Soweit hier die SEAP-Guidelines Werte vorgeben, wurden diese angewandt. Ergänzt wurden diese durch GEMIS 4.6. Treibhausgaskennzahlen (österreichische Datensätze, LCA). Der Energiebedarf setzt sich aus den Sektoren Wärme, Strom und Mobilität zusammen, es wird die Endenergie für die BEI benötigt. Kommunale Gebäude, Anlagen/Einrichtungen der Marktgemeinde Laxenburg Die Bedarfswerte der Gemeindeobjekte für Wärme und Strom stammen von unterschiedlichen Quellen und Zusammenstellungen. Soweit möglich, wurde das Jahr 2008 als Zeitraum gewählt. Der Wärmebedarf der Gemeindeobjekte wird ausschließlich mit Erdgas gedeckt. Als Objekte für Wärmebedarf zählen • Rathaus • Kindergarten Hofstraße • Kindergarten Friedrich Rauch Gasse • Volksschule • Feuerwehrhaus • Bücherei und Mediathek • Bauhof • Kaiserbahnhof • Heimatmuseum Neben der Straßenbeleuchtung (als eigene Kategorie) und der Kläranlage gibt es folgende weitere Stromnutzungen in der Gemeinde, welche berücksichtigt wurden: Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 21
Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011 Fußballklub, Jugendraum, Pumpen, Sirenen, Kapellen, Lager, Aufzug, Telefonzelle, Radar und Anschlüsse für Veranstaltungen. Tertiäre (nicht kommunale) Gebäude, Anlagen/Einrichtungen Hier wurden folgende Objekte berücksichtigt: • Institut für Systemanalyse • Schloßtheater • Franzensburg • Freibad • Filmarchiv Als Verbrauchsdaten wurden jene für Infrastruktur Sonstiges des NÖ Energiekataster 2008 für Laxenburg verwendet, da hier für den Strombedarf kein Wert vorliegt, wurde ein Wert von 40 MWh dafür abgeschätzt. Wohngebäude Die Werte stammen aus dem Energiekataster 2008, Fehler im Kataster wurden korrigiert. Fernwärme für 14 Abnehmer erfolgt über ein Hackschnitzel- Heizwerk. Der Emissionswert stammt aus GEMIS 4.6. (LCA-Programm, Österreichischer Datensatz). Da im Energiekataster 2008 für Wärmepumpen nur der Strombedarf hierfür angeführt wird, nicht jedoch die genutzte Umweltenergie, wurde diese ergänzt. Weiters wurde eine Jahresarbeitszahl von durchschnittlich 3,5 angenommen, dies deckt sich grob mit den üblichen österreichischen Verhältnissen. Als Emissionswert wurde jener für Strom daher durch 3,5 geteilt. Da der Strombedarf der Haushalte nicht aufscheint, wurde dieser errechnet. Aus der Fragebogenerhebung für 2009 durch die Energieagentur der Regionen wurde ein durchschnittlicher Strombedarf von 3.905 kWh je Haushalt erhoben. Es gibt kaum Unterschiede im Durchschnittsstrombedarf zwischen Einfamilienhäusern und Wohnungen in größeren Wohneinheiten. Nach der Haushaltserhebung von Statistik Austria gab es Ende 2006 in Laxenburg 1275 Wohnungen. Öffentliche kommunale Beleuchtung Die kommunale Beleuchtung wurde durch die Energieagentur Waldviertel erhoben. Der Wert stellt den Stand für Dezember 2008 dar. Dies ist wichtig, da hier Optimierungsarbeiten von 2006 bis 2010 im Gange waren. Die Weihnachtsbeleuchtung fällt jedoch nicht in diese Kategorie sondern unter dem Strombedarf für kommunale Einrichtungen/Anlagen (erste Kategorie). Industrie (ohne Branchen, die sich am Europäischen Emissionshandelssystem beteiligen) Hier wurde für den Wärme und Strombedarf der niederösterreichische Energiekataster 2008 für die Gemeinde Laxenburg herangezogen. Fehler in der Verteilung der Energieträger wurden korrigiert. Die Verbrennung von Stroh auf Feldern in der Landwirtschaft wurde nicht berücksichtigt. Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 22
Aktionsplan für Nachhaltige Energie der Marktgemeinde Laxenburg Oktober 2011
Kommunale Fahrzeugflotte
Hier wurde der Treibstoffbedarf des Wirtschaftshofes (10.557 Liter Diesel und 2873 Liter Benzin) sowie von der Feuerwehr (1383 Liter Diesel und 358
Liter Benzin) für das Jahr 2008 berücksichtigt.
Öffentlicher Verkehr
Es gibt folgende Buslinien: 206,215,216,218,267,566,567,666,558,766. Diese stellen den Nahverkehr und die Anbindung nach Wien her. Weiters führt
eine Eisenbahnstrecke durch das Gemeindegebiet. Der nächstgelegene Bahnhof liegt jedoch außerhalb der Gemeinde (Biedermannsdorf).
Für eine konkrete Energiebedarfsauswertung sind derzeit keine Daten verfügbar.
Privater und gewerblicher Verkehr
Die KFZ-Meldestatistik von 2005 wurde mittels der Flottenzahländerungen je Fahrzeuggruppe auf das Jahr 2008 hochgerechnet.
Durchschnittliche Kilometerleistungen und Treibstoffverbräuche je Fahrzeuggruppe stammen aus Erhebungen der Energieagentur der Regionen.
Daraus wurde der Energiebedarf der KFZ-Flotte Laxenburgs errechnet. Durch die Beimengungsverordnung war bis Oktober 2008 4,3% des
Energieinhalts der fossilen Treibstoffe mit Rapsmethylesther (RME) oder Bioethanol versetzt. (Hu typisch: Benzin 8,77 kWh/l; Bioethanol 5,8 kWh/l;
Diesel 9,86 kWh/l; RME 9,66 kWh/l).
Durch gewisse Annahmen und Berechnngshilfen (Erfahrungswerte, Verteilung nach Herry, …) wurde der obenstehende Energiebedarf für die
Fahrzeuggruppen und für die unterschiedlichen Energieträger/Treibstoffe für die in Laxenburg gemeldeten Fahrzeuge berechnet.
Damit ergibt sich folgender Energiebedarf (Endenergie):
Der Wert für das Elektroauto ist in kWh/100 km in rot dargestellt, alle anderen Werte in dieser Spalte stellen Liter/100 km dar.
Hinsichtlich der Berechnung der Treibhausgase wurden Bioethanol und RME getrennt gerechnet.
Erstellt mit Unterstützung der Energieagentur der Regionen www.energieagentur.co.at 23Sie können auch lesen