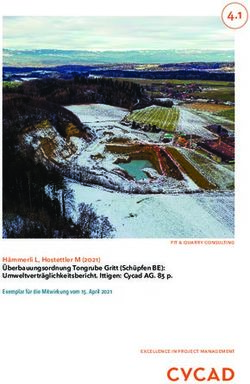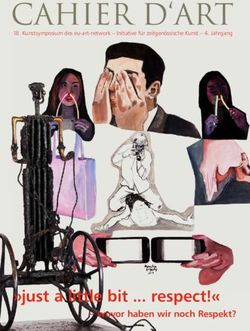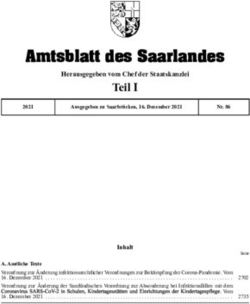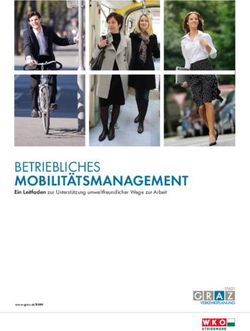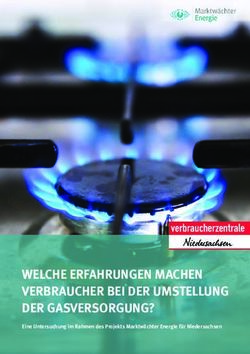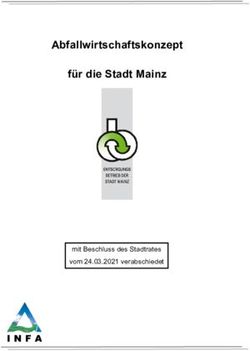Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur geplanten Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz - sachsen.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag
zur geplanten Wohnbebauung
auf den Flurstücken 134/5 und 425/3
der Gemarkung Quesitz
Auftraggeber: Quesitzer Agrar GmbH
Hauptstraße 9
04420 Markranstädt
Auftragnehmer: IB Hauffe GbR
Büro für Landschaftsplanung
Am Eichberg 4
04769 Mügeln / Neubaderitz
Tel.: 034362 / 33572
Fax: 034362 / 379986
e-Mail: info@ib-hauffe.de
web: www.ib-hauffe.de
Datum: 10.08.2020geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Inhaltsverzeichnis
0. Allgemeine Angaben ...................................................................................................... 3
1. Standort des Untersuchungsgebietes ............................................................................. 3
2. Projektinformation und Aufgabenstellung ....................................................................... 4
3. Bearbeitungsgrundlagen ................................................................................................ 5
4. Rechtsgrundlagen .......................................................................................................... 5
5. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen ...................................................... 7
6. Bestandsaufnahme ........................................................................................................ 9
6.1 Biotop- und Flächennutzungstypen; Vegetation ................................................................. 9
6.2 Zauneidechse ................................................................................................................... 14
6.3 Erfassung der Brutvögel ................................................................................................... 14
6.3.1 Einmalige, orientierende Begehung zu Brutvögeln im Jahr 2019 ........................14
6.3.2 Brutvogelkartierung im Jahr 2020 ........................................................................15
7. Beschreibung der Planung und seiner Wirkfaktoren ..................................................... 19
8. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten .................................................. 21
8.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ....................... 21
8.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der VSchRL ................ 24
8.2.1 Brutvögel ..............................................................................................................24
8.2.2 Zug- und Rastvögel ..............................................................................................26
8.3 Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen
gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen .......................................................... 27
9. Artbezogene Wirkungsprognose .................................................................................. 27
9.1 Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie ....................................................................... 27
9.1.1 Artgruppe Fledermäuse .......................................................................................27
9.1.2 Zauneidechse .......................................................................................................27
9.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der VSchRL ............................................................ 30
9.2.1 Ökologische Gilde der Vögel, die in/an Gebäuden brüten...................................30
9.2.2 Ökologische Gilde der Vögel, die in/auf Gehölzen brüten ...................................37
10. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökolog-ischen
Funktionalität .............................................................................................................. 45
11. Zusammenfassung / Ergebnis ...................................................................................... 52
Anhang:
# Anlage 1 - Literatur
# Anlage 2 - Fotodokumentation
# Anlage 3 - Tabelle zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums im Untersu-
chungsgebiet
# Anlage 4 - Plan 1: Flächennutzungs- und Biotoptypen sowie Lage der Vegetations-
aufnahmeflächen und Gehölzbestand und Fundpunkt Zau-
neidechse vom 07.08.2018
# Anlage 5 - Plan 2: Verschnitt der geplanten Flächennutzung mit bestehenden Flä-
chennutzungs- und Biotoptypen
# Anlage 6 - Plan 3: Lage der Artenschutzmaßnahmen
2geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
0. Allgemeine Angaben
Auftraggeber: Quesitzer Agrar GmbH
Hauptstraße 9
04420 Markranstädt
Auftragnehmer: IB Hauffe GbR
Büro für Landschaftsplanung
Am Eichberg 4
OT Neubaderitz
04769 Mügeln
Bearbeitung: Dipl.-Ing. agr. Heiko Hauffe
Dipl.-Ing. (Landschaftsarchitektur) Susann Köhler
Ornithologe Rainer Ulbrich (Avifauna)
1. Standort des Untersuchungsgebietes
Land: Sachsen
Landkreis: Leipzig
Stadt: Markranstädt
Gemarkung: Quesitz
Flurstücke: 134/5 und 425/3
Größe: 24.167 m²
Das UG befindet sich im Südwesten von Markranstädt, im Ortsteil Quesitz.
Die Lage ist aus der folgenden Karte ersichtlich (ohne Maßstab).
Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes (ohne Maßstab)
3geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
2. Projektinformation und Aufgabenstellung
Die Stadt Markranstädt beabsichtigt im Ortsteil Quesitz auf den Flurstücken 134/5 und 425/3
die Aufstellung eines Bebauungsplanes. In Vorbereitung des Bebauungsplanes wurde ein
Städtebaulicher Entwurf erarbeitet [GEISINGER/RAJCZAK: Planzeichnung mit Flächenangaben zum Städtebaulichen Entwurf,
Stand 22.08.2019, welcher von der Stadt Markranstädt freigegeben wurde].
Der Entwurf zeigt, dass das Untersuchungsgebiet (UG) als Wohngebiet entwickelt werden soll.
Neben Einfamilienhäuser sind auch Geschossbauten geplant. Die Grundstücksflächen wer-
den über eine zentral verlaufende Straße erschlossen, welche an die Hauptstraße angebun-
den wird. Auch sind ein Kinderspielplatz und eine Grünfläche im Osten einschließlich
Teich/Regenrückhaltebecken angedacht.
Das UG liegt im Nordosten von Quesitz und hat eine Größe von etwa 2,4 ha. Neben dem
landwirtschaftlichen Betriebsgelände, welches zu einem Wohngebiet einschließlich Grünflä-
che umgestaltet werden soll, umfasst das Untersuchungsgebiet noch eine etwa 1.660 m²
große Ackerfläche.
Im Südwesten des UGs stehen Verwaltungsgebäude sowie Gebäude und Unterstände, die
u.a. zur Unterstellung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen genutzt werden. Grund-
stückszuwegungen und Plätze sind in dem Bereich großflächig vollversiegelt, nur in Randbe-
reichen sind Ruderalfluren und kleine Gebüsche anzutreffen. Im zentralen Untersuchungsge-
biet steht ein Schornstein. Eine Halle, welche zum Zeitpunkt der Ortsbegehungen als Getrei-
delager genutzt wurde, steht im Nordwesten des Flurstückes 134/5. Hinter dieser Halle bis zur
Grenze der Flurstücke 134/2 und 134/a hat sich ein dichter Gehölzbestand aus alten Hyb-
ridpappeln und einigen weiteren Laubgehölzen mit einem dichten Unterwuchs aus jüngeren
Gehölzen etabliert. Der östliche Teil des Untersuchungsgebietes wird von Ruderalfluren domi-
niert, welche auf den größeren Flächen offensichtlich regelmäßig gemulcht werden. Innerhalb
der Ruderalfluren wurden verschiedenste Materialien abgelagert, so u.a.: Bitumenschredder,
Erde, Sand und im zentralen Teil auf einer Fläche von etwa 800 m² eine Sammlung von Feld-
steinen, Bauschutt, Holz u.a. Materialien. Die Ruderalfluren werden durch einige wasserdurch-
lässig befestigte Wege gequert. In Randbereichen haben sich (Brombeer-)gebüsche etabliert.
Die nördliche und östliche Grenze wird von einer Reihe aus Pyramidenpappeln gebildet, wobei
die nördliche Reihe der Pyramidenpappeln kurz außerhalb des UG steht. An einigen Pyrami-
denpappeln konnten Baumhöhlen festgestellt werden. Weitere Hybridpappeln stehen an der
südöstlichen Grenze des Flurstückes 425/3 sowie eine einzelne im Südwesten an der Haupt-
straße.
Im näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach dem
Naturschutzrecht. Nächstgelegene Schutzgebiete sind das FFH-Gebiet und gleichnamige Na-
turschutzgebiet „Kulkwitzer Lachen“ in etwa 2 km Entfernung zum Vorhabensgebiet.
Aufgrund der Biotopausstattung ist ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erstellen.
Als Grundlage für die Artenschutzrechtliche Prüfung sind Bestandsaufnahmen zu Zauneidech-
sen und zu Brutvögeln durchzuführen. Alle weiteren, relevanten Arten sind einer Potentialana-
lyse zu unterziehen, wobei vorhandene Daten mit herangezogen werden. Auch sind flächen-
deckend Flächennutzungs- sowie Biotoptypen zu kartieren und es sind Vegetationsaufnah-
men zu erbringen. Der durch den Vermesser aufgenommene Gehölzbestand soll kontrolliert
und auf artenschutzrechtlich relevante Strukturen überprüft werden.
Aufgabe des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist es:
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen
Vogelarten i. S. Art. 1 VSchRL, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) und der nicht
gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. nationalem Recht streng ge-
schützt sind, die durch die Realisierung des Vorhabens erfüllt werden können, zu er-
mitteln und darzustellen und
4geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten ge-
mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.
Entsprechend dem im Kap. 4 erläuterten § 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote
für die nach nationalem Recht besonders geschützten Arten für die zu prüfenden Planungs-
ziele nicht.
3. Bearbeitungsgrundlagen
QUESITZER AGRAR GMBH, Projektinformationen sowie digitale Plangrundlage (Vermes-
sungsplan), Vorabstimmung zu durchzuführenden Artenschutz-Maßnahmen bei der
Ortsbegehung am 30.07.2019.
LANDRATSAMT LANDKREIS LEIPZIG: Abfrage aus der Multi-Base-Artdatenbank für einen eng
und einen weit gefassten Betrachtungsraum, Übergabe der Daten am 02.10.2018.
Ergebnisse der Ortsbegehungen durch IB HAUFFE GBR: Kartierung der Biotoptypenaus-
stattung, Vegetationsaufnahmen, Baumbestandserfassung sowie Kontrolle der Gehölze
auf artenschutzrechtlich relevanten Strukturen im August 2018 sowie eine orientierende
Begehung zur Avifauna am 15.07.2019; Nachkontrolle Gehölze, Zauneidechse und
Ortsbegehung zu CEF-Maßnahmenflächen am 30.07.2019.
IB HAUFFE GBR: Brutvogelkartierung im Zeitraum vom 16.04. bis 23.06.2020.
GEISINGER/RAJCZAK: Planzeichnung mit Flächenangaben zum Städtebaulichen Entwurf,
Stand 22.08.2019, welcher von der Stadt Markranstädt freigegeben wurde.
weitere Literatur siehe Literaturverzeichnis.
4. Rechtsgrundlagen
Im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wird geprüft, ob die Verbotstatbestände
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Demnach ist es verboten (§ 44 Abs.1 BNatSchG):
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).
Weiterhin gilt § 44 Abs. 5 BNatSchG:
Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach
§ 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffe-
nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich
anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,
2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder
Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor
5geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung
und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,
3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin
erfüllt wird.
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild
lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die
Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-
bote vor.
Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 14.07.2011 (Az.9 A 12.10; „Freiberg-Urteil“) wird klargestellt,
dass die Privilegierung überhaupt nur in Betracht komme, wenn ein nach § 15 BNatSchG zulässiger Eingriff
in Natur und Landschaft vorliegt. Als Eingriff in diesem Sinne sei nicht die konkrete Beeinträchtigung, sondern
nach dem eindeutigen, zwischen Eingriff und Beeinträchtigungen unterscheidenden Wortlaut des § 14 Abs. 1
BNatSchG die Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen als Ganzes zu verstehen1. Dies habe
zur Konsequenz, dass Gegenstand der Zulässigkeitsbeurteilung das Vorhaben und nicht die einzelne Beein-
trächtigung sei; führt also das Vorhaben in bestimmter Hinsicht zu Beeinträchtigungen, die den Vorgaben der
Eingriffsregelung widersprechen, so sei der Eingriff insgesamt unzulässig mit der Folge, dass auch anderen
von ihm ausgehenden Beeinträchtigungen die Privilegierung des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG verwehrt
bleibe.
Der Wortlaut „unvermeidbare Beeinträchtigungen“ macht klar, dass vermeidbare Tötungen oder Beeinträchti-
gungen zu unterlassen sind, d.h. Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden müssen.
Soll ein Vorhaben realisiert werden und liegen Verbotstatbestände i. S. des § 44 Abs. 1
BNatSchG (unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 5 BNatSchG) vor, können im Einzelfall Aus-
nahmen zugelassen werden, es gilt:
§ 45 Abs. 7 BNatSchG:
„Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland
das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher
Schäden,
2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung
und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder
5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art.
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhal-
tungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie
92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9
Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein
durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere
Landesbehörden übertragen.
Weiterhin gilt § 67 Abs. 2:
Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Geboten und Verboten im Sinne des § 32
Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer
unzumutbaren Belastung führen würde. Im Fall des Verbringens von Tieren oder Pflanzen aus dem Ausland wird
die Befreiung vom Bundesamt für Naturschutz gewährt.
1
BVwerG, (Fn.6), Rn.117
6geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
5. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen
Das methodische Vorgehen und die Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung
stützen sich auf die Veröffentlichungen zum Speziellen Artenschutz in der Planungspraxis von
der BAYRISCHEN AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, 2009 und auf das
Prüfschema zum Artenschutz des SMUL, 2010.
Als Datengrundlage des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages gilt es, die betroffenen ge-
schützten Arten zu ermitteln – In Anlehnung an in Kap. 4 dargestellte Rechtsgrundlagen müs-
sen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten,
d.h.:
alle europäischen Vogelarten i. S. Art. 1 VSchRL und
Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie
betrachtet werden.
[Entsprechend dem im Kap. 4 erläuterten § 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote für die nach natio-
nalem Recht besonders geschützten Arten für das zu prüfende Vorhaben nicht, so dass nach nationalem Recht
besonders geschützte Arten nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind.]
In einem ersten Schritt findet eine Vorprüfung statt. Durch eine projektspezifische Abschich-
tung des zu prüfenden Artenspektrums brauchen die Arten dem Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das
jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanz-
schwelle). Es können dazu die Arten „abgeschichtet“ werden, die aufgrund vorliegender Daten
(vgl. Kap. 3) oder allgemein auf Grund der Roten Liste bzw. für Vogelarten die Tabelle „In
Sachsen auftretende Vogelarten“ (Version 2.0, 30.03.2017) als zunächst nicht relevant für die
weiteren Prüfschritte identifiziert werden können. Die Abschichtung der Arten erfolgt transpa-
rent und nachvollziehbar.
Folgende Kriterien finden bei der „Abschichtung“ Verwendung:
- „N“: Art im GroßNaturraum entsprechend Roter Listen Sachsen ausgestorben / verschollen,
- „V“: Wirkraum liegt nicht im bekannten Verbreitungsgebiet der Art; Vogelarten werden als „im Gebiet nicht
brütend/nicht vorkommend“ bewertet, wenn Brutvogelnachweise /Vorkommensnachweise nach dem
Brutvogelatlas Sachsens im Wirkraum und auch in den benachbarten TK25-Quadranten nicht vorlie-
gen.
- „L“: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommend (Lebens-
raum-Grobfilter nach z.B. Mooren, Wälder, Magerrasen, Gewässern etc.)
Gastvögel: Es werden nur diejenigen Gastvögel erfasst, die in relevanten Rast- / Überwinterungsstät-
ten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind.
- „E“: WirkungsEmfindlichkeit der Art ist vorhabensspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit
davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (in der
Regel euryöke, weit verbreitete, ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit geringer Wirkungsintensi-
tät. Für Vogelarten wird die Tabelle der „Regelmäßig in Sachsen auftretenden Vogelarten2 als Hilfs-
mittel zur Bewertung der Wirkungsempfindlichkeit mit heran gezogen.)
Danach gilt es für die in der Vorprüfung nicht abgeschichteten Arten durch Bestandaufnahmen
bzw. durch Potenzialanalyse die einzelartenbezogene Bestandssituation im Untersuchungs-
raum zu erheben. Auf Basis dieser Untersuchungen können dann die Arten identifiziert wer-
den, die bei Realisierung des Vorhabens tatsächlich betroffen sind (sein können).
Nach der Vorprüfung verbleiben die bei der Realisierung des Vorhabens betroffenen Arten,
die dem weiteren Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu Grunde zu legen sind. Es finden wei-
tergehende Prüfschritte statt, deren Ziel es ist:
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-
2
LfULG: Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“, Version 2.0, 30.03.2017, hier: Unterscheidung in Vogelarten mit hervor-
gehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung und in häufige Brutvogelarten.
7geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Richtlinie, alle europäischen Vogelarten), die bei Realisierung des Vorhabens erfüllt werden
können, zu ermitteln und darzustellen,
zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den
Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.
Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL und der Europäischen Vogelarten
gem. Art. 1 VRL wird geprüft, ob die in § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG genannten Ver-
botstatbestände erfüllt sind. Wenn unter Berücksichtigung erforderlicher Vermeidungs- und
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.
1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, erfolgt - um den sachlichen Zusammenhang zu wahren
- textlich unmittelbar anschließend eine Prüfung, ob die naturschutzfachlichen3 Vorausset-
zungen für eine Befreiung von den Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG gegeben sind.
Eine besondere Bedeutung im Zuge der Prüfung der Verbotstatbestände nehmen Maßnah-
men ein, die der Prognose zugrunde gelegt werden können. Dabei handelt es sich einerseits
um Maßnahmen, die Beeinträchtigungen vermeiden und andererseits um solche, die zur Wah-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität dienen.
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Pro-
jekt an. Vermeidungsmaßnahmen haben zur Folge, dass Projektwirkungen entweder vollstän-
dig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine er-
hebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt (z.B. Durchführung von Rodungen oder der
Vorbereitung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit vorkommender Vogelarten).
Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen, continuous ecological functionalty-measures) setzen unmittelbar am betroffenen
Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen Le-
bensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu er-
halten. Um dies zu gewährleisten, müssen sie hohe Anforderungen erfüllen. So müssen die
Maßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein sowie im funktionalen Zusammenhang
mit der vom Eingriff betroffenen Lebensstätte stehen, um die ökologische Funktionalität der
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der jeweiligen Art erhalten zu können (z.B. Verbesserung
bzw. Neuschaffung von Habitaten, die in funktionaler Beziehung zu der betroffenen Lebens-
stätte stehen).
Liegen Verbotstatbestände trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und/oder
CEF-Maßnahmen vor, müssen kompensatorische Maßnahmen (compensatory measures)
dem Erhalt des derzeitig (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art dienen. Die
Kompensatorischen Maßnahmen, die auch als „Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungs-
zustandes“ (FCS-Maßnahmen) bezeichnet werden, können im Rahmen der Ausnahmezulas-
sung festgesetzt werden. Abgeleitet werden diese aus den spezifischen Empfindlichkeiten und
ökologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population. Geeignet ist zum
Beispiel die Anlage einer neuen Lebensstätte ohne direkte funktionale Verbindung zur be-
troffenen Lebensstätte in einem großräumigeren Kontext oder Umsiedlung einer lokalen Po-
pulation. Diese kompensatorischen Maßnahmen kommen der gesamten Population in der bi-
ogeografischen Region zugute und sind daher nicht mit den vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen gleichzusetzen, die immer unmittelbar an den betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten ansetzen. Sie sollten möglichst bereits vor der Beeinträchtigung realisiert sein und
Wirkung zeigen. Im Einzelfall können jedoch auch zeitliche Funktionsdefizite in Kauf genom-
men werden. [SMUL: Hinweise zu zentralen, unbestimmten Rechtsbegriffen im Bundesnaturschutzgesetz, 26.10.2009.]
3 die Beurteilung, ob für ein Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher
sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder ob es im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit,
einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen
auf die Umwelt ist und welche Varianten für den Vorhabensträger als zumutbar oder unzumutbar einzustufen sind, ist nicht Be-
standteil des Fachbeitrages. Fachlicher Inhalt ist jedoch herauszuarbeiten, inwieweit sich verschiedene Varianten hinsichtlich
der Betroffenheit der relevanten Arten unterscheiden
[Quelle: Oberste Baubehörde im Bayrischen Staatsministerium des Inneren: Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen
Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, S.5; 2008]
8geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
6. Bestandsaufnahme
6.1 Biotop- und Flächennutzungstypen; Vegetation
Am 20.08.2018 wurde innerhalb des Untersuchungsgebietes eine flächendeckende Biotop-
und Flächennutzungstypenkartierung durchgeführt.
Folgende Biotop- und Flächennutzungstypen sind (Stand August 2018) im Untersuchungsge-
biet anzutreffen (vgl. Plan 1 in der Anlage 4):
vollversiegelte Flächen - Gebäude
Alle geschlossenen Gebäude (Verwaltungsgebäude, (Getreidelager-)Hallen, Garagen wurde unter die-
sem Biotoptyp zusammengefasst.
vollversiegelte Flächen – Schuppen/Schauer
Schuppen und Schauer, welche zur Unterstellung von Maschinen, Geräten etc. genutzt werden wurden
gesondert differenziert.
vollversiegelte Flächen
Vollversiegelte Flächen konzentrieren sich überwiegend auf den südwestlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes. Diesem Biotoptyp mit zugerechnet wurde ein Schornstein im zentralen Untersuchungsgebiet
sowie eine Tankstelle.
teilversiegelte Flächen; Pflaster
Kleinflächig sind im Nordosten des Flurstückes 134/5 Flächen gepflastert.
wasserdurchlässig befestigte Flächen
Wege und Plätze wurden im Osten und im zentralen Untersuchungsgebiet mit wassergebundener Wege-
decke befestigt. Weiterhin wurden diesem Flächennutzungstyp bituminös befestigte Flächen zugrechnet,
welche sehr beschädigt waren.
vollversiegelte Flächen mit schwacher Substratauflage und spärlicher Ruderalvegetation
Im zentralen Untersuchungsgebiet ist im Bereich des Schornsteins eine Fläche anzutreffen, auf der sich
eine schwache Substratauflage (bis 5 cm Stärke) gebildet hat. Durch die Substratauflage konnten sich
spärlich Ruderalfluren etablieren.
wenig befahrene wasserdurchlässig befestigte Flächen mit schütterer Ruderalvegetation
Zwei Flächen im Osten des Untersuchungsgebietes werden offensichtlich wenig befahren, so dass sich
auf ihnen eine schüttere Ruderalvegetation etablieren konnte.
Ablagerungen von Bitumenschredder
Im Osten des Flurstückes 425/3 wurde Bitumenschredder abgelagert. Auf diesem Material hat sich keine
Vegation gebildet.
Ablagerungen von Feldsteinen, zwischen den Steinen Ruderalvegetation
Auf einer etwa 800 m² großen Fläche im Osten des Untersuchungsgebietes wurden Feldsteine, Schutt,
Bauschutt, Holz, Betonteile und Gummimatten abgelagert. Zwischen den Steinen hat sich Ruderalvege-
tation etabliert. Vorkommende Pflanzenarten vgl. Aufnahmefläche 2.
Sand- und Erdaufschüttungen mit spärlicher Ruderalvegetation, Deckungsgrad der Vege-
tation bis max. 50 %
Aufschüttungen aus Sand und Erde sind entlang der nördlichen Grenze anzutreffen. Auf den Aufschüttun-
gen hat sich eine Ruderalvegetation etabliert.
intensiv genutztes Ackerland
Im Nordosten des Untersuchungsgebietes (Flurstück 134/4) wird auf einer etwa 1.660 m² großen Fläche
intensiv genutztes Ackerland angeschnitten. Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung im August 2018 wurde auf
der Fläche Mais angebaut. Bei der Begehung am 30.07.2019 stellte sich die Fläche als Stoppelfeld (Wei-
zen) dar.
9geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Ruderalfluren
Der Osten des Untersuchungsgebietes wird von Ruderalfluren dominiert. Auch haben sich in Randberei-
chen Ruderalfluren entwickelt. Zu 0 bis 5 % ist auf den Ruderalfluren Gehölz-Jungwuchs aufgekommen.
Vorkommende Pflanzenarten vgl. Aufnahmeflächen 1 und 3. Die größeren Flächen der Ruderalfluren
werden offensichtlich regelmäßig in größeren Abständen gemulcht.
Brombeerengebüsch
Brombeergebüsche wachsen im Osten des Flurstückes 425/3 sowie im Bereich eines Unterstandes auf
dem Flurstück 134/5.
Gebüsche
In Randbereichen und auf wenig genutzten Flächen sind Gebüsche anzutreffen. Die Gebüsche sind in
der Tabelle 3 detailliert beschrieben.
Baumbestand; Gehölz
Zwischen dem als Getreidelagerhalle genutzten Gebäude und angrenzender Wohngrundstücke im Nord-
westen hat sich ein Baumbestand mit dichten Gehölzunterwuchs etabliert (vorkommende Arten vgl. Ta-
belle 3). Entlang der östlichen Untersuchungsgebietsgrenze erstreckt sich eine Baumreihe aus alten Py-
ramidenpappeln. Eine weitere Reihe Pyramidenpappeln steht im Norden kurz außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Beide Baumreihen aus Pyramidenpappeln weisen einen dichten Gehölzunterwuchs auf (vorkom-
mende Arten vgl. Tabelle 3).
Einzelbäume
Einzelbäume ab einem Stammdurchmesser von 10 cm in 1,30 m Höhe und Solitärsträucher wurden auf-
genommen und in der nachfolgenden Tabelle detailliert beschrieben.
Zum Zeitpunkt der Ortsbegehungen (August 2018) erfolgten auf repräsentativen Aufnahme-
flächen Aufnahmen der nachweisbaren Vegetation.
Die Lage der Aufnahmeflächen geht mit aus dem Bestandsplan (Plan 1 in der Anlage 4) her-
vor. Die einzelnen Aufnahmeflächen können wie folgt charakterisiert werden:
Tabelle 1: Charakterisierung der einzelnen Aufnahmeflächen
Nr. Kurzbeschreibung
1. Ruderalflur im Nordosten des Untersuchungsgebietes
2. Ruderalflur im Bereich des Steinhaufens
3. Ruderalflur auf abgelagerten Material
Tabelle 2: Nachgewiesene Pflanzen innerhalb des Untersuchungsgebietes (geordnet nach Stetigkeit)
Art Aufnahmefläche
wissenschaftlich deutsch 1 2 3
Arrhenatherum elatius Glatthafer x x x
Cichorium intybus Gemeine Wegwarte x x x
Dactylis glomerata Gemeines Knaulgras x x x
Lactuca serriola Kompaß-Lattich x x x
Picris hieracioides Gemeines Bitterkraut x x x
Solidago canadensis Kanadische Goldrute x x x
Taraxacum officinale Gemeine Kuhblume x x x
Urtica dioica Große Brennessel x x x
Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuß x x
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel x x
Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel x x
Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut x x
Daucus carota Wilde Möhre x x
Elytrigia repens Gemeine Quecke x x
Polygonum aviculare Vogel-Knöterich x x
Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer x x
Arctium lappa Große Klette x x
Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe x
Atriplex patula Spreizende Melde x
Avena sativa Saat-Hafer x
Berteroa incana Graukresse x
Bromus sterilis Taube-Trespe x
Bromus sterilis Taube-Trespe x
10geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Art Aufnahmefläche
wissenschaftlich deutsch 1 2 3
Calamagrostis epigejos Land-Reitgras x
Calystegia sepium Echte Zaunwinde x
Chelidonium majus Großes Schöllkraut x
Chenopodium album Weißer Gänsefuß x
Crepis biennis Wiesen-Pippau x
Echinochloa crus-galli Gemeine Hühnerhirse x
Echinops sphaerocephalus Große Kugeldistel x
Erigerron annuus Feinstrahl x
Festuca ovina Echter Schaf-Schwingel x
Festuca rubra Rot-Schwingel x
Galium mollugo Wiesen-Labkraut x
Geum urbanum Echte Nelkenwurz x
Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu x
Lamium maculatum Gefleckte Taubnessel x
Lolium perenne Deutsches Weidelgras x
Matricaria maritima Geruchlose Kamille x
Medicago sativa Saat-Luzerne x
Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze x
Papaver dubium Saat-Mohn x
Plantago major Breit-Wegerich x
Poa pratensis Wiesen-Rispengras x
Potentilla anglica Englisches Fingerkraut x
Potentilla argentea Silber-Fingerkraut x
Senecio inaequidens Schmalblättriges Greiskraut x
Sisymbrium altissimum Hohe Rauke x
Sisymbrium loeselii Lösels Rauke x
Trifolium arvense Hasen-Klee x
Trifolium pratense Rot-Klee x
Trifolium repens Weiß-Klee x
Tussilago farfara Huflattich x
Verbascum thapsus Kleinblütige Königskerze x
Vulpia myuros Mäuseschwanz-Federschwingel x
Gehölzjungwuchs / Gebüsche
Rosa spec. Wildrose-Art x x
Sambucus nigra Schwarzer Holunder x x
Prunus avium Süß-Kirsche x
Prunus mahaleb Steinweichsel x
Populus spec. Hybrid-Pappel x
Als Grundlage für die Baumbestandsaufnahme lag ein Vermessungsplan mit Baumstandorten
vor [Vermessungsplan, zur Verfügung gestellt von der QUESITZER AGRAR GMBH]. Bei der Ortsbegehung am
01.08.2018 wurden die eingemessenen Gehölze auf artenschutzrechtlich relevante Strukturen
(Baumhöhlen, Spalten, Totholz, etc.) geprüft. Ergänzend wurden noch nicht eingemessene
Gehölze ab einem Stammdurchmesser von 8 cm in 1,30 m Höhe aufgenommen. Gehölze im
dichten Stand wurden zu Gehölzgruppen zusammengefasst. Eine Nachkontrolle der Gehölze
fand am 30.07.2019 statt.
Die Lage der Gehölze geht aus dem Plan 1 hervor, welcher sich in der Anlage 4 befindet.
Tabelle 3: Einzelbäume, Sträucher und Gehölzgruppen im Untersuchungsgebiet
lfd. Art Stamm-Ø Höhe in m Kronen-Ø Bemerkung
Nr. in 1,30 m in m
Höhe
in cm
1 Hybridpappel kleine trockene Äste; unteren Starkäste
120 30 12
(Populus x canadensis) entfernt
2 Kriechender Wachholder (Ju-
- 1,5 4
niperus procumbens)
3 Sandbirke (Betula pendula) Kronenspitze abgebrochen, kleine tro-
ckene Äste; zwei Astausfaulungen-mög-
45 15 8
licherweise Baumhöhlen (nicht einseh-
bar) Lochdurchmesser jeweils ca. 10 cm
4 Gewöhnliche Esche (Fraxinus kleine trockene Äste
75 14 10
excelsior)
11geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
lfd. Art Stamm-Ø Höhe in m Kronen-Ø Bemerkung
Nr. in 1,30 m in m
Höhe
in cm
5 Hybridpappel (Populus x ca- an Pappeln Starkäste rausgebrochen;
nadensis), Gewöhnliche trockene Starkäste; der Bergahorn ist
Fichte (Picea abies), Schwar- mittelalt (Stammdurchmesser 20 bis 25
zer Holunder (Sambucus cm); Gewöhnliche Esche und Vogelkir-
nigra), Sandbirke (Betula pen- sche sind Jungwüchse
dula); Schneebeere (Sympho-
ricarpos albus), Brombeere bis 150 bis 25
(Rubus fruticosus), Gewöhnli-
che Esche (Fraxinus excel-
sior), Bergahorn (Acer pseu-
doplatanus), Robinie (Robinia
pseudoacacia); Prunus avium
(Vogelkirsche)
6 Robinie (Robinia pseudoaca- Jungwüchse
cia), Bergahorn (Acer pseudo- bis 2 bis 3.5
platanus)
7 Pyramidenpappel (Populus Baumreihe kurz außerhalb des Untersu-
nigra ‘Italica’), Bergahorn (A- chungsgebietes, welche überwiegend
cer pseudoplatanus), Schnee- aus Pyramidenpappeln besteht und über
beere (Symphoricarpos), Blut- einen dichten Unterwuchs verfügt; an Py-
roter Hartriegel (Cornus san- ramidenpappeln trockene Äste; an vielen
guinea); Steinweichsel Pyramidenpappeln abgestorbene Kro-
(Prunus mahaleb); Gewöhnli- nenspitzen; viel Totholz, z.T. auch ab-
che Esche (Fraxinus excel- blätternde Rinde; in der Strauchsicht do-
bis 40 bis 25
sior); Stieleiche (Quercus ro- miniert die Steinweichsel, z. T. ist in der
bur); Wildrose-Art (Rosa Strauchschicht auch Pyramidenpappel-
spec.); Pflaumenwildling Jungwuchs vorhanden; Quartiereigen-
(Prunus domestica); Schwar- schaften für baumbewohnende Fleder-
zer Holunder (Sambucus mäuse innerhalb der gesamten Baum-
nigra); Europäischer Pfei- reihe vorhanden
fenstrauch (Philadelphus
coronarius);
8 Pyramidenpappel (Populus steht kurz außerhalb des Untersu-
nigra ‘Italica’) chungsgebietes innerhalb der Baumreihe
30 12 3 Nr. 7; Baumhöhle ca. 2 cm Durchmes-
ser; Rinde zu 2/3 fehlend; trockene Äste;
Krone fehlend
9 Pyramidenpappel (Populus steht kurz außerhalb des Untersu-
nigra ‘Italica’) chungsgebietes innerhalb der Baumreihe
25 8 1 Nr. 7; vollständig abgestorben; Baum-
höhle; Kronenspitze fehlt; vermutlich
ausgehöhlter Stamm
10 überwiegend Pyramidenpap- Baumreihe, welche überwiegend aus Py-
pel (Populus nigra ‘Italica’), ramidenpappeln besteht; an Pyramiden-
weiterhin: Bergahorn (Acer pappeln gehäuft trockene Kronenspitzen;
pseudoplatanus), Schwarzer frühzeitiger Laubabfall; viel Totholz, z. T.
Holunder (Sambucus nigra), auch abblätternde Rinde; die anderen
Schneebeere (Symphoricar- Laubbäume sind Jungwüchse; in der
pos albus), Gewöhnliche Strauchsicht dominiert die Steinweichsel,
Esche (Fraxinus excelsior), z. T. ist in der Strauchschicht auch Pyra-
Sandbirke (Betula pendula), bis 40 bis 25 midenpappel-Jungwuchs vorhanden;
Blutroter Hartriegel (Cornus Quartiereigenschaften für baumbewoh-
sanguinea), Wildrose (Rosa nende Fledermäuse innerhalb der ge-
spec.), Europäischer Pfei- samten Baumreihe vorhanden
fenstrauch (Philadelphus
coronarius); Steinweichsel
(Prunus mahaleb); Stieleiche
(Quercus robur); Pflaumen-
wildling (Prunus domestica);
11 Pyramidenpappel 2 Stück; vollständig abgestorben, Krone
(Populus nigra ‘Italica’) 20 8 - fehlt; steht innerhalb der Baumreihe Nr.
10
12 Pyramidenpappel fehlende Krone und Rinde; vollständig
(Populus nigra ‘Italica’) 20 8 - abgestorben; steht innerhalb der Baum-
reihe Nr. 10
13 Pyramidenpappel vollständig abgestorben; Krone fehlt, ab-
(Populus nigra ‘Italica’) 30 8 - blätternde Rinde; steht innerhalb der
Baumreihe Nr. 10
14 Pyramidenpappel abgängig; Krone fehlt; abblätternde
(Populus nigra ‘Italica’) 40 10 1 Rinde; steht innerhalb der Baumreihe Nr.
10
12geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
lfd. Art Stamm-Ø Höhe in m Kronen-Ø Bemerkung
Nr. in 1,30 m in m
Höhe
in cm
15 Pyramidenpappel abgängig; Krone ursprünglich abgebro-
(Populus nigra ‘Italica’) chen, Sekundärkrone gebildet; Rinde ab-
50 12 3
blätternd, stellenweise fehlend; steht in-
nerhalb der Baumreihe Nr. 10
16 Hybridpappel 2 Stück; trockene Äste
120,150 20 20
(Populus x canadensis)
17 Vogelkirsche (Prunus avium)
Kirschpflaume (Prunus
cerasifera), Walnuss (Juglans
regia), Wildrose (Rosa spec.),
bis 5 bis 6 -
Salweide (Salix caprea),
Schwarzer Holunder (Sam-
bucus nigra), Knackweide (Sa-
lix fragilis)
18 Hybridpappel (Populus x 2 Stück; trockene Starkäste
100,150 20 bis 15
canadensis)
19 Salweide (Salix caprea) Gewöhnliche Esche ist Jungwuchs
Gewöhnliche Esche (Fraxinus
excelsior), Schwarzer Holun- bis 5 bis 3
der (Sambucus nigra), Brom-
beere (Rubus fruticosus)
20 Jungwuchs aus Gewöhnlicher Gebüsch
Esche (Fraxinus excelsior);
bis 12 bis 9
Schwarzer Holunder (Sam-
bucus nigra)
Legende zu Tabelle 3:
Großstrauch
Gebüsch; Baumreihe oder -gruppe
abgestorbener Baum
abgängiger Baum
Baum der (möglicherweise, da schwer einsehbar) ein oder mehrere
Baumhöhle(n) aufweist
Bei der nachgewiesenen Vegetation handelt es sich um häufig anzutreffende Arten mit einer
hohen ökologischen Potenz, welche typisch für ruderale Säume und Ruderalfluren im mittel-
deutschen Raum sind.
Arten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste Sachsens oder Deutschlands ent-
halten sind, konnten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden.
Die Pyramidenpappeln Nr.8 und 9 weisen Baumhöhlen, welche baumbewohnenden Fleder-
mäusen als Quartier dienen könnten, auf. An der Sandbirke Nr. 3 konnte vom Boden aus nicht
vollständig eingesehen werden, ob an dem Stamm zwei Astausfaulungen oder zwei Baum-
höhlen vorhanden sind. Handelt es sich an der Birke um Baumhöhlen, sind diese auch als
Quartier für Fledermäuse geeignet. An den Pyramidenpappeln Nr. 13, 14, und 15 wurde ab-
blätternde Rinde festgestellt. Auch hinter der abblätternden Rinde können sich Fledermäuse
verbergen. Insbesondere da 2019 zu beobachten war, dass weitere Pyramidenpappeln in den
Baumreihen Nr. 7 und 10 abgängig sind (Trockenheit!), ist ein Vorhandensein von weiteren
Strukturen, die baumbewohnenden Fledermäusen als Quartier dienen könnten, auch an wei-
teren Pyramidenpappeln der Baumreihen Nr. 7 und 10 möglich.
Die Baumstandorte sind im Plan Nr. 1 in der Anlage 4 dargestellt.
13geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
6.2 Zauneidechse
Methodik
Die Erfassung von Zauneidechsen erfolgte mittels Sichtbeobachtung bei geeigneter Witterung,
d.h. ein langsames und ruhiges Abgehen der (potentiellen) Lebensräume und konzentriertes
Absuchen der Fläche (zum Teil auch mit Fernglas), kombiniert mit dem Hören von Geräuschen
flüchtender Tiere. Erweitert wurde die Sichtbeobachtung durch das Aufsuchen von vorhande-
nen möglichen Verstecken im Gelände, welche umgedreht oder angehoben wurden.
Die Erfassungen fanden an den nachfolgend genannten Terminen statt:
1. Begehung: 01.08.2018,
2. Begehung: 07.08.2018,
3. Begehung: 20.08.2018,
4. Begehung: 30.07.2019.
Rückschlüsse auf die Populationsgröße lässt die Art der Erfassungsmethode nicht zu.
Im Zuge der Erfassungsgänge wurde auf weitere relevante Beibeobachtungen im Untersu-
chungsgebiet geachtet.
Erfassungsergebnis
Bei der Geländebegehung am 07.08.2018 konnte eine Zauneidechse im Bereich der abgela-
gerten Feldsteine nachgewiesen werden. Da die Zauneidechse schnell unter einen Stein flüch-
tete, war es nicht möglich das Geschlecht zu bestimmen.
Weitere Nachweise gelangen nicht. Es wird von einer sehr kleinen Population ausgegangen.
Es gelangen keine Nachweise anderer Vertreter der Herpetofauna im Gebiet.
6.3 Erfassung der Brutvögel
6.3.1 Einmalige, orientierende Begehung zu Brutvögeln im Jahr 2019
Am 15.07.2019 wurde eine einmalige, orientierende Begehung zu Brutvögeln durchgeführt.
Bei der Begehung wurden alle Gebäude begangen und auf vorhandene Nester geprüft. Ziel
der Begehung war es auch, die potentielle Eignung der Flächen als Vogellebensraum
einzuschätzen und die Bäume bezüglich eventuell vorhandener Horste zu untersuchen.
Im Ergebnis der einmaligen, orientierenden Begehung steht fest, dass ein Vorkommen von
Rauch- und Mehlschwalben in/an den Gebäuden sicher ausgeschlossen werden kann. Auch
konnten auf den Bäumen keine Greifvogelhorste nachgewiesen werden.
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht, welche Arten bei der Begehung am 15.07.2019 gesichtet
werden konnten:
Tabelle 4: Bei einmaliger, orientierender Begehung im Jahr 2019 nachgewiesene Vogelarten
Art deutsch Art wissenschaftlich Bemerkung
Graureiher Ardea cinerea Nachweis nur als Überflieger
Stieglitz Carduelis carduelis Nachweis mit Brutzeitcode A2
Ringeltaube Columba palumbus Nachweis mit Brutzeitcode A2
Buntspecht Dendrocopos major nur Sichtbeobachtung
nur Sichtbeobachtung/ Nahrungsgast; kein
Rauchschwalbe Hirundo rustica Nestnachweis
Rotmilan Milvus milvus Nachweis nur als Überflieger
14geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Art deutsch Art wissenschaftlich Bemerkung
Haussperling Passer domesticus Nachweis mit Brutzeitcode A1
Hausrotschwanz Phoenicurus ochururos Nachweis mit Brutzeitcode A1
Zilpzalp Phylloscopus collybita Nachweis mit Brutzeitcode A2
Elster Pica pica nur Sichtbeobachtung
Girlitz Serinus serinus Nachweis mit Brutzeitcode A2
Star Sturnus vulgaris Nachweis nur als Überflieger
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Nachweis mit Brutzeitcode B7
Gartengrasmücke Sylvia borin Nachweis mit Brutzeitcode A2
Amsel Turdus merula Nachweis mit Brutzeitcode A1
Legende zur Tabelle 4 / Spalte Bemerkungen
Die Angaben erfolgen nach folgendem international üblichen Schema:
Status (A = möglicher, B = wahrscheinlicher, C = sicherer BV)
A 1 Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt
2 singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Brutha-
bitat festgestellt
B 7 Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein
Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet
6.3.2 Brutvogelkartierung im Jahr 2020
Methodik
Während der Brutzeit der Vögel erfolgten insgesamt 4 Begehungen innerhalb des Plangebie-
tes, so am 16.04., 19.05., 28.05., und am 23.06.2020. Randbereiche wurden mit erfasst und
in der Kartendarstellung sichtbar gemacht. Gebäude wurden nur betreten, wenn diese unver-
schlossen waren. Die Begehungen erfolgten in den Morgenstunden, da zu diesen Tageszeiten
die Gesangsaktivitäten der Reviere anzeigenden Männchen bei den Vögeln am höchsten sind.
Aufgefundene Nester, beobachtete Jungvögel, futtertragende Altvögel und ähnliche Beobach-
tungen wurden ebenfalls als Brutnachweise angesehen. Gewöllfunde, Kotplätze usw. wurden
hinsichtlich der Möglichkeit einer Brut kritisch bewertet.
Die Kartierung und die daraus folgende Darstellung erfolgte gemäß den "Methodenstandards
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands".
Erfassungsergebnis
Insgesamt wurden 34 Vogelarten kartiert. Davon 31, welchen das Plangebiet Brutmöglichkei-
ten bieten könnte. 21 Vogelarten aus dieser Liste zeigten in dem Plangebiet bzw. knapp au-
ßerhalb Revierverhalten bzw. einen höheren Brutstatus. Jene sind in der Kartendarstellung
berücksichtigt.
Sichere Brutnachweise wurden für Star, Garten- und Hausrotschwanz, Haussperling und
Grünfink erbracht.
Das Artinventar konzentriert sich im Wesentlichen auf die mit Gehölzen bewachsenen Rand-
bereiche des Plangebietes. Die voll- und teilversiegelten Flächen besitzen als Brutplatz keine
Bedeutung. Vorhandene Gebäude wurden als Brutplatz von Hausrotschwanz, Star und
Haussperling genutzt. Darüber hinaus dienten sie als Singwarten für Amsel, Girlitz und Tür-
kentaube.
Es kann mit 21 bis 45 Vogelbrutpaaren bzw. Revieren gerechnet werden.
Folgende Vogelarten konnten nachgewiesen werden:
15geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Tabelle 5: Innerhalb des Plangebietes im Frühjahr 2020 nachgewiesene Brutvögel bzw. registrierte Nahrungs-
gäste und Überflieger
ermittelte bzw. geschätzte
Anzahl der Brutpaare
höchster ermittelter
Brutstatus
Art Status
Mauersegler (Apus apus) 0 Überflieger/Nahrungsgast 0
Ringeltaube (Columba palumbus) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 1
Türkentaube (Streptopelia decaocto) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 1
Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus) 0 Überflieger 0
Schwarzmilan (Milvus migrans) 0 Überflieger 0
Buntspecht (Dendrocopos major) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Grünspecht (Picus viridis) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Turmfalke (Falco tinnunculus) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Neuntöter (Lanius collurio) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 1
Eichelhäher (Garrulus glandarius) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0 bis 1
Rabenkrähe (Corvus corone) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Blaumeise (Cyanistes caeruleus) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 1 bis 2
Kohlmeise (Parus major) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 1
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0 bis 1
Mehlschwalbe (Delichon urbicum) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Zilpzalp (Phylloscopus collybita) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 2 bis 3
Gelbspötter (Hippolais icterina) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 1
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 3 bis 5
Gartengrasmücke (Sylvia borin) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 2
Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 1
Kleiber (Sitta europaea) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0 bis 1
Star (Sturnus vulgaris) C16 Sicherer Brutvogel 1 bis 3
Amsel (Turdus merula) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 1 bis 2
Singdrossel (Turdus philomelos) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 2 bis 3
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) C16 Sicherer Brutvogel 2 bis 3
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) C13a Sicherer Brutvogel 1
Haussperling (Passer domesticus) C12 Sicherer Brutvogel 1 bis 2
Bachstelze (Motacilla alba) A1 Möglicher Brutvogel ohne Revierverhalten 0 bis 1
Buchfink (Fringilla coelebs) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 1 bis 2
Grünfink (Carduelis chloris) C12 Sicherer Brutvogel 1
Stieglitz (Carduelis carduelis) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 1 bis 2
Girlitz (Serinus serinus) B4 Wahrscheinlicher Brutvogel 2 bis 3
Goldammer (Emberiza citrinella) A2 Möglicher Brutvogel mit Revierverhalten 0 bis 1
Der Gefährdungsstatus der Arten ist in der Anlage 3 dokumentiert.
16geplante Wohnbebauung auf den Flurstücken 134/5 und 425/3 der Gemarkung Quesitz
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Stand 10.08.2020
Legende zu Tabelle 5: Status der nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet
Die Angaben erfolgen nach folgendem international üblichen Schema:
Status (A = möglicher, B = wahrscheinlicher, C = sicherer BV)
A 1 Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt
2 singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im mögli-
chen Bruthabitat festgestellt
B 3 Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt
4 Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Ta-
gen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft besetz-
tes Revier vermuten
5 Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt
6 Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf
7 Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten,
das auf ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet
8 Brutfleck bei gefangenem Altvogel festgestellt
9 Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet
C 10 Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) beobachtet
11a Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden
11b Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden
12 Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festge-
stellt
13a Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Alt-
vögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden
kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester)
13b Nest mit brütendem Altvogel entdeckt
14a Altvogel trägt Kotsack von Nestling weg
14b Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet
15 Nest mit Eiern entdeckt
16 Junge im Nest gesehen oder gehört
Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel (einschließlich Status A 1) sind be-
sonders geschützt nach §7 Abs.2 Ziff.13 BNatSchG, der Turmfalke und der Grünspecht sind
darüber hinaus auch streng geschützt nach §7 Abs.2 Ziff. 14. Auch ist der Turmfalke im An-
hang A der EG-Artenschutzverordnung und der Neuntöter im Anhang I der Vogelschutzrichtli-
nie enthalten. Die Rauch- und Mehlschwalbe sowie der Gartenrotschwanz sind nach der Roten
Liste Sachsens als gefährdet eingestuft, der Star wird nach der Roten Liste Deutschlands als
gefährdet geführt. Vier der nachgewiesenen Brutvögel stehen auf der Vorwarnliste der Roten
Liste Sachsens (keine Gefährdungskategorie). Bei 24 der innerhalb des Untersuchungsgebie-
tes nachgewiesenen Vogelarten handelt es sich laut der Tabelle „In Sachsen auftretende Vo-
gelarten des LfULG vom 30.03.2017 um häufige Brutvogelarten. Der Turmfalke, der Grün-
specht, der Neuntöter, die Rauch- und Mehlschwalbe, der Gelbspötter und der Gartenrot-
schwanz werden in gleichnamiger Tabelle als Vogelarten mit hervorgehobener artenschutz-
rechtlicher Bedeutung geführt.
Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht zu registrierten Brutvögeln im Plangebiet
und in dessen unmittelbaren Umfeld.
17Sie können auch lesen