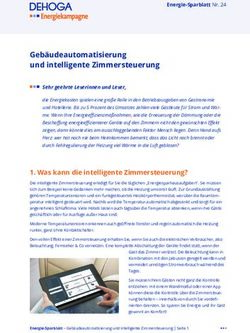Blick ins Grüne - Pflanzengenomforschung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Seiten-Adresse:
Powered by
https://www.biooekonomie-bw.de/fachbeitrag/dossier/blick-ins-gruene-
pflanzengenomforschung
Blick ins Grüne - Pflanzengenomforschung
Die Erforschung des Pflanzengenoms offenbart grundsätzliche Mechanismen, die teilweise auch für Tier und Mensch gelten.
Außerdem liefert sie Impulse für die Anwendung, speziell zur Verbesserung von Nahrungs-, Futter- und Energiepflanzen. Dabei
dreht sich längst nicht alles um transgene Pflanzen.
Schon seit vielen Jahrtausenden nutzen Züchter das genetische Potenzial der Pflanzen. Für den Menschen vorteilhafte
Spontanmutationen wurden seit jeher selektiert und mit Hilfe von Kreuzungen wurde genetisches Material unterschiedlicher Arten
neu kombiniert. Auch ohne Kenntnis der molekularen Zusammenhänge waren diese Prozesse sehr erfolgreich, allerdings auch
sehr langsam. So entstand aus einem unscheinbaren Süßgras in Mittelamerika in Laufe mehrerer Jahrtausende der neuzeitliche
Mais und damit eines der wichtigsten Nahrungs- und Futtermittel der modernen Welt.
Die Ansprüche an eine schnelle Entwicklung ertragreicherer und besonders widerstandsfähiger Sorten stieg in der Neuzeit ebenso
wie der Wissensdurst um die geheimnisvollen Vorgänge, die Veränderungen und Varianten in die Pflanzenwelt bringen. Die
systematische Erforschung der Vererbung bestimmter Merkmale begann mit Gregor Mendel. Mitte des 19. Jahrhunderts kultivierte
der Priester und Forscher geschätzte 28.000 Erbsenpflanzen, um den Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf die Spur zu kommen.
Die Mendelschen Regeln - vormals Mendelschen Gesetze - bilden nach wie vor die Basis der Vererbungslehre. Der Grund für die
Umbenennung war die Entdeckung von Transposons (springenden Genen) und Translokationen einzelner Gene. Beide Phänomene
können die Mendelschen Regeln außer Kraft setzen, was ihre grundsätzliche Bedeutung jedoch nicht schmälert.
Molekularbiologie schafft DurchbrücheGregor Mendel, Vater der Genetik © wikipedia.de
Der modernen Molekulargenetik sind bahnbrechende Einblicke ins Pflanzengenom zu verdanken. Sie haben die Genomforschung allgemein und die Weiterentwicklung von Nutzpflanzen wesentlich vorangebracht. Das einjährige Kraut Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) war die erste höhere Pflanze, deren Genom komplett sequenziert wurde (2000, veröffentlicht in Nature). Es umfasst rund 25.500 Gene. 2002 folgten Sequenzen der beiden Reissorten Oryza sativa ssp. indica und Oryza sativa ssp. japonica (veröffentlicht in Science). Die Blüte der Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana gesehen durch ein Rasterelektronenmikroskop. © Jürgen Berger / Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Arabidopsis ist einfach zu kultivieren, wächst schnell und lässt sich für molekulargenetische Untersuchungen gut handhaben - das hat sie zu einer der weltweit am meisten verbreiteten Laborpflanze gemacht. Viele Entdeckungen, die Pflanzengenetiker zuerst an Arabidopsis machten, sind grundsätzlicher Natur und gelten nicht nur allgemein für Pflanzen, sondern sogar für das Tierreich. Ein Beispiel sind genetische Regulationsmechanismen, die durch RNA vermittelt werden. Aus der Grundlagenforschung kommen wesentliche Impulse für die Anwendung der Pflanzengenomforschung. Speziell die funktionelle Genomforschung, also die Erforschung der biologischen Funktion von Pflanzengenen, steht dabei im Fokus. 2000 startete das BMBF gemeinsam mit mehr als 25 Unternehmen der Privatwirtschaft das Forschungsprogramm GABI, mit dem Nutzpflanzen „fit für die Zukunft" gemacht werden sollen. Es gibt einen Grundlagen- und einen anwendungsorientierten Forschungsbereich mit jeweils fünf Schwerpunkten, denen die einzelnen Projekte zugeordnet sind.
Forschungsprogramm GABI - Herausforderung Pflanzengenom Die Pflanzengenomforschungsinitiative GABI wird gemeinsam vom BMBF und der Wirtschaft getragen und finanziert. Sie hat das Ziel, die wissenschaftliche Basis der Pflanzengenomforschung in Deutschland zu stärken, ein enges und dauerhaftes Netzwerk zwischen akademischer und industrieller Forschung zu knüpfen und mit Hilfe eines effizienten Wissens- und Technologietransfersystems die rasche Überführung der Forschungsergebnisse in die Praxis zu gewährleisten, um die beschleunigte Entwicklung von Produkten mit hohem Wertschöpfungspotential in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Zierpflanzenbau, Ernährung, Gesundheit, Pharmazie, Chemie und Umwelt zu ermöglichen. Wichtige Ziele sind die Entwicklung ertragreicherer Sorten, Resistenzen gegen Krankheiten, Verbesserungen im Geschmack und bessere Lagerfähigkeit. Vorangetrieben wird auch die genomische Erforschung und Weiterentwicklung von Pflanzen, die medizinisch relevante Produkte oder für die Ernährung besonders wertvolle Stoffe (Vitamine, bestimmte Fettsäuren oder Kohlenhydrate) liefern. Es geht also nicht nur um eine rein mengenmäßige Ertragssteigerung, sondern auch um eine Mehrproduktion nützlicher Stoffe pro Pflanze. Generell arbeiten an einem GABI-Projekt jeweils Wissenschaftler mit Züchtern und Fachleuten aus der Industrie zusammen. Ihnen steht inzwischen eine enorme Fülle an genomischen und phänotypischen Daten zur Verfügung, die nur noch mit professionellem Datenmanagement verwaltet und sinnvoll genutzt werden können. Die biometrischen und bioinformatorischen Werkzeuge dafür werden im Rahmen eines GABI-Projektes entwickelt, das an der Uni Hohenheim koordiniert wird. Der Beitrag „ Nichts dem Zufall überlassen - Forscher entwickeln Verfahren für eine wissensbasierte Pflanzenzüchtung" beschreibt die Hohenheimer Ansätze. Neben Nahrungsmittelpflanzen rücken seit einigen Jahren auch Energiepflanzen immer mehr in den Fokus der Forscher und der Produzenten. Aus Rapssaat wird zum Beispiel Pflanzenöl-Kraftstoff und Biodiesel gewonnen, Mais kann ebenso wie diverse Getreide und Kartoffeln als Lieferant für Bioethanol genutzt werden. Die kommerzielle Genomforschung steht aber auch im Dienste der Schönheit. So arbeitet die Stuttgarter Ornamental Bioscience GmbH daran, Zierpflanzen wie Weihnachtsstern, Fleißige Lieschen und Geranien um neue attraktive Sorten zu bereichern. Dabei sind auch Resistenzen ein Thema, Ornamental Bioscience arbeitet an besonders widerstandsfähigen Pflanzen, denen Krankheitserreger, Trockenheit und Kälte weniger zusetzen. Dabei kommen klassische züchterische Methoden nach Mendel, aber auch gentechnische Verfahren zum Einsatz. Genomforschung forciert moderne Züchtung Die Verwendung gentechnischer Methoden mündet nicht immer automatisch in die Herstellung transgener Pflanzen. So werden molekulare Marker und Genomsequenzierung eingesetzt, um Pflanzen züchterisch zu verbessern. Mit Hilfe dieser Methoden werden zum Beispiel Resistenzgene aus verwandten Spezies in Hochleistungssorten eingebracht. Eine Alternative zur Gentechnik bietet der Heterosis-Effekt, also die besondere Leistungsfähigkeit von Hybriden (Mischlingspflanzen). Hybride aus der Kreuzung zweier degenerierter Inzuchtlinien können um bis zu 70 Prozent höhere Erträge liefern. Dieses Phänomen wird jetzt auch molekularbiologisch untersucht, um die Pflanzen-Heterosis optimal in der Züchtung nutzen zu können. Den aktuellen Stand der Forschung rund um die Hybridzüchtung reflektierte die Heterosis-Konferenz unter dem Motto „Renaissance der Hybridzüchtung“ Anfang September 2009 an der Universität Hohenheim. Dossier 01.10.2009 leh © BIOPRO Baden-Württemberg GmbH Weitere Artikel in diesem Dossier
03.03.2020
Universität Hohenheim will die Bedingungen im Linsenanbau verbessern
31.01.2020
LTZ Augustenberg fördert regionale Eiweißproduktion
02.04.2019
Einfacher Zucker könnte Glyphosat bald Konkurrenz machen
26.11.2018
Innovationen für die grüne Transformation der Welt
25.02.2013
Computomics: Ordnung im DNA-Buchstabensalat von Pflanzen
31.12.2012
Mark van Kleunen: Pflanzenspezies und was sie uns erzählen
30.11.2012
Paarberatung für Getreide: Computertechnik und spezielles Saatgut soll Weizen-Ernte steigern
24.09.2012
Kolbenfäule: Universität Hohenheim forscht an pilzresistentem Mais
30.04.2012
Wie Phytochrom B in den Kern transportiert wird
16.04.2012
DNA-Rekombination zur gezielten Pflanzenzüchtung
30.03.2012
Lichtgesteuertes Pflanzenwachstum: Freiburger Forscher decken wichtigen Mechanismus auf
16.03.2012
Hotspots für die Bildung kleiner RNA-Moleküle in Pflanzenzellen entdeckt
05.03.2012
Regulationsnetzwerke pflanzlicher Stammzellsysteme
19.09.2011
Uwe Ludewig und die Zukunft der Nutzpflanzen
25.10.2010
Ein Pflanzenhormon und das Wachstum im Dunkeln
14.01.2010
Winzige RNAs bringen Gene zum Schweigen
11.12.2009
Genomsequenzierung pilzresistenter WeinrebenSie können auch lesen