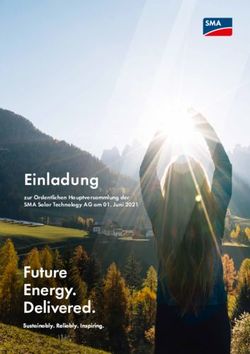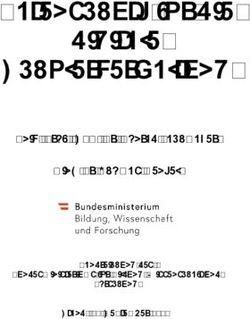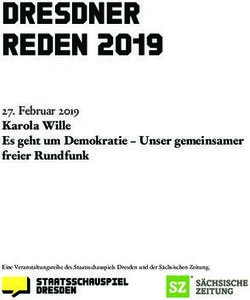ÜBUNGEN UND MATERIALIEN, DIE LUST AUF POLITIK MACHEN INFORMATIONEN FÜR DIE LEHRKRAFT - die lust auf politik machen ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ÜBUNGEN UND MATERIALIEN, DIE LUST AUF POLITIK MACHEN INFORMATIONEN FÜR DIE LEHRKRAFT HERAUSGEGEBEN VON GEFÖRDERT VOM IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMS
IMPRESSUM Herausgegeben vom Kinder- und Jugendbeirat der Landeshauptstadt Kiel, vertreten durch Niklas Becker, Laura Bertram, Sebastian Thiede und der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, vertreten durch Helen Ruck und die beiden FÖJler*innen Yonca Akbay und Tilman Bretschneider. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! Autor*innen: Helen Ruck Johann Knigge-Blietschau Tilman Bretschneider Yonca Akbay Yannik Fisker Tobias Brück Niklas Becker Katrin Lindstädt Gestaltung: Friedrich Art Druck: Gebr. Peters Druckerei GmbH, Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein Gedruckt auf Recyclingpapier Danksagung: An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt haben: Den Geschäftsführungen des Jungen Rats und der Heinrich-Böll- Stiftung Schleswig-Holstein, dem Verein Gesicht Zeigen!, Johann Knigge-Blietschau, Medi Kuhlemann, Dorothea Keudel, Theresa Kramer, Mathias Löffert, Friederike Löffert-Pokatis, Jonna Bevernitz, Mirco Mührenberg, Bibeth von Lüttichau und natürlich auch allen anderen, die wir hier vergessen haben. 1. Auflage, Kiel 2017
ICH WÄHL’ MIR DIE WELT ÜBUNGEN UND MATERIALIEN, DIE LUST AUF POLITIK MACHEN LIEBE LEHRER*INNEN, LIEBE SCHÜLER*INNEN! Wir freuen uns sehr, dass Sie in die „Ich wähl’ mir die Welt“-Box schauen. Sie finden darin eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien und Vermittlungsmethoden zu den Themen Politik und Demokratie, die wir, der Junge Rat Kiel und die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, allen Kieler Schulen ab der neunten Klasse kostenlos zur Verfügung stellen. Die Box teilt sich auf in Materialien und Kopiervorlagen für Schüler*innen, die sich in den Mappen befinden, didaktische Informationen, Arbeitshinweise und Lösungsansätze in gebundener Form für Lehrkräfte sowie ein Spiel, lose Flyer und Infobroschüren. Inhaltlich gliedert sich die Box in drei thematische Blöcke: Block A: „Meine Stimme in der Demokratie“ be- schäftigt sich mit der Frage, was Demokratie und politisches Engagement überhaupt bedeuten und welche vielfältigen, zivilgesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten dadurch eröffnet werden. Daran schließt Block B: „Wen wähle ich? Parteien und ihre Ziele“ an, in dem es um die zur schleswig-holsteinischen Land- tagswahl aufgestellten Parteien, ihre programmatischen Inhalte und ihre Selbstdarstellung geht. Der letzte Block: „Herausforderungen und Gefahren für die Demokratie“ möchte aus aktuellem Anlass für die Themen Populismus und Fake-News sensibilisieren und Handlungsoptionen aufzeigen. Wir verstehen Demokratie als nichts Selbstverständliches, nichts, das einfach existiert und allen zur Verfügung steht. Demokratie ist ein lebendiger Prozess, den wir alle mitgestalten, der Auseinandersetzungen und Kon- troversen braucht, genauso wie Kompromisse und Toleranz. Eine demokratische Politik durchzieht alle Lebens- bereiche, vom Alltagsleben bis hin zu abstrakten Wirtschaftsgeschäften. Sie kann sich ausdrücken in der Teilnahme an Wahlen, genauso wie in der Organisation einer Demonstration oder der Entscheidung, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Es ist uns wichtig, spielerische und abwechslungsreiche Zugänge zu den einzelnen Inhalten zu finden, um Lust und Neugierde auf Politik zu wecken. Wir sind überzeugt, dass jemand, der Politik langweilig, zu abstrakt oder uninteressant findet, noch nicht sein*ihr Feld gefunden hat oder vielleicht noch gar nicht weiß, dass das eigene Hobby total politisch sein kann. Wir freuen uns, wenn diese Box, genauso wie unsere „Ich wähl’ mir die Welt“-Veranstaltung am 20. März 2017 im Kieler Rathaus, die einen Markt der politischen Möglichkeiten, eine Art World Café mit Politiker*innen und ein gesellschaftspolitisches Forum umfasst, Schüler*innen dabei unterstützen kann, die eigene politische Stimme zu entdecken oder zu stärken. Wir wünschen viel Vergnügen mit der Box und bis bald auf der Veranstaltung. Ihre „Ich wähl’ mir die Welt“-Crew PS: Unser Projekt ist als lernendes Projekt gedacht. Deshalb würden wir uns sehr freuen, von Ihnen eine Rück- meldung über Ihre Erfahrungen zu erhalten. Dies können Sie per Mail unter info@ich-wähl-mir-die-welt.de oder mit einem Kommentar in unserem Blog www.ich-wähl-mir-die-welt.de machen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ergänzungen zu unseren Materialien sowie weitere Informationen zu unserem Projekt zu finden. www.ich-wähl-mir-die-welt.de 3
ICH WÄHL’ MIR DIE WELT ÜBUNGEN UND MATERIALIEN, DIE LUST AUF POLITIK MACHEN INHALTSVERZEICHNIS 2 Impressum 3 Einleitung 5 Block A: Meine Stimme in der Demokratie 6 A1: Was heißt hier Demokratie? 7 A2: Was heißt hier politisch? 8 A3: 4-Ecken-Spiel 9 A4: Positionierungsspiel zu politischen Aussagen 10 A5: Politik direkt vor der Haustür 12 A6: Wahlbeteiligung 13 A7: Sollte es in Deutschland eine Wahlpflicht geben? 14 A8: Teste dich: Welcher Wahltyp bist du? 15 Block B: Wen wähle ich? – Parteien und ihre Ziele 16 B1: Wofür stehen sie? – Parteien und ihr Grundverständnis 17 B2: Was machen sie? – Parteien und ihr Programm 21 B3: Wie sehen sie aus? – Parteien und ihre Plakate 24 Block C: Herausforderungen und Gefahren für die Demokratie 25 C1: „Popu-was?“ 26 C2: „Wir sind das Volk – Du nicht!“ 27 C3: Ideal-Politiker*innen - Volksnah oder spezialisiert? 28 C4: „Ich teile jeden Dreck ohne Überprüfung“ 29 C5: Was tun gegen Fake-News? 31 Quellenverzeichnis 4 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE
BLOCK A
MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE
„Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine.“
Alice Walker, US-amerikanische Schriftstellerin
Schon der griechische Philosoph Sokrates soll sich einst über die „Jugend von heute“ beklagt haben, welcher
er vorwarf, verwöhnt, faul und respektlos gegenüber den Erziehenden zu sein. Damit war er sicher nicht der
Erste und ganz bestimmt nicht der Letzte. „Die Jugend von heute“ ist zu einem geflügelten Wort (der Älteren)
geworden, das eigentlich immer dann Verwendung findet, wenn sich Verhältnisse im Wandel befinden und
Rollen sich verschieben.
Vergessen wird dabei gerne, dass es die Jugend als eine homogene Gruppe gar nicht gibt, genauso wenig wie
eine Generation Golf, Maybe oder What. Vielmehr ist es ein Kennzeichen von Jugend, noch nicht genau zu wissen,
wohin die Reise geht: Sie gibt Zeit zur Orientierung, um herauszufinden wer oder was man sein möchte.
Dieser Umstand betrifft natürlich auch die Politik. Während die Älteren sagen, „die Jugend von heute“ sei
politikverdrossen, nicht engagiert und gleichgültig, wird dabei womöglich übersehen, dass sich das Verhältnis
zur Politik und die Art und Weise, sich zu engagieren schlicht im Wandel befindet. Es gibt bereits vielfache
Möglichkeiten, für Jugendliche politisch aktiv zu sein: Dazu gehören Online-Petitionen unterschreiben, umwelt-,
tier- und menschenschädliche Produkte meiden oder sich im sozialen Nahraum für Geflüchtete einsetzen.
Anstatt Politikverdrossenheit zu attestieren, sollten Möglichkeiten aufgezeigt und geschaffen werden. Es ist
notwendig, zu verstehen, dass die Demokratie nicht leicht ist. Sie kann anstrengend, widersprüchlich und frus-
trierend sein, doch sie gibt allen die Chance, sich einzumischen und für die eigenen Interessen einzustehen.
Das Ziel dieses Blocks ist es, den Schüler*innen die Chance zu geben, sich selbst im politischen System zu
verorten und für sich die Frage zu beantworten: Wo ist mein Platz in der Demokratie?
Tipp: Jugend im Landtag
Einmal im Jahr bietet der Landtag Schüler*innen
die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Politik
zu schauen und mit den Abgeordneten die Plätze
zu tauschen, um selbst zu erleben, wie es ist,
Politik zu machen.
Weitere Informationen unter:
http://www.landtag.ltsh.de/service/jugend/
www.ich-wähl-mir-die-welt.de 5BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A1 WAS HEISST HIER DEMOKRATIE? Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Diese Übung soll den Schüler*innen die Möglichkeit geben, sich der Bedeutung und der Dimensionen von Demo- kratie bewusst zu werden. Darüber hinaus soll ein Bezug zur gegenwärtigen politischen Situation hergestellt werden (sinkende Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit, Forderung nach mehr Demokratie). Material: Arbeitsbögen A1a – c Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: 1) Die Schüler*innen sollen sich darüber Gedanken machen, was sie persönlich mit dem Begriff Demokratie verbinden (Arbeitsbogen A1a). 2) In einem nächsten Schritt sollen sie anhand von Zitaten sammeln, was andere unter Demokratie verstehen (Arbeitsbogen A1b). Mögliche Ergebnisse: • Demokratie als Gemeinschaftsprodukt • Wählen als zentraler Bestandteil des demokratischen Prozesses, doch erst durch Bewusstseinsbildung und aktive Mitwirkung von Menschen und Organisationsformen wird Demokratie „lebendig“ • Die Freiheit, die eigene Meinung zu äußern und Dinge zu kritisieren, aber auch die Verantwortung, Wider- sprüche und Kritik aushalten zu können • Die Freiheit, nach eigenen Interessen und Überzeugungen zu handeln • Die Notwendigkeit, sich selbst zu reflektieren und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen 3) Anschließend soll der Cartoon von Schilling und Blum beschrieben und interpretiert werden (Arbeitsbogen A1c). Mögliche Ergebnisse: • Beschreibung: Wahllokal, je zwei Wählerinnen und Wahlhelfer, Stimmabgabe • Deutung: Zentraler Bestandteil von Demokratie: Wählen von Repräsentant*innen, an die Regierungsaufgaben abgegeben werden versus demokratische Grundrechte Versammlungs- und Meinungsfreiheit • Bezug: Unzufriedenheit über mangelnde Mitbestimmung versus Nichtwählen (Demonstrieren als Alternative zum Wählen, Nichtwählen aus Protest) 4) Zum Schluss schreibt die Lehrkraft den Begriff Demokratie an die Tafel. Im Plenum sollen die Dimensionen von Demokratie gesammelt werden, welche die Lehrkraft um diesen Begriff gruppiert, um so ein Schaubild zu erhalten. Nun könnte erneut die Frage ans Plenum gestellt werden: Was versteht ihr unter Demokratie? 6 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A2 WAS HEISST HIER POLITISCH? Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Vielen ist gar nicht klar, dass sich die Beteiligung in einer Demokratie nicht ausschließlich in der Teilnahme an Wahlen oder der Mitgliedschaft einer Partei ausdrückt. Beteiligung kann ebenso die Mitwirkung in einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder die Teilnahme an einer Demonstration sein. In dieser Übung soll das Verständnis dafür erweitert werden, was alles politisch ist und in welchen Formen sich „politisch sein“ ausdrücken kann. Material: Arbeitsbögen A2a – d Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: Nach einem kurzen Brainstorming im Plenum legen die Schüler*innen an der Tafel eine Mindmap an, in der Kriterien für politisches Engagement gesammelt werden. Wahrscheinlich wird der Fokus auf der Parteienpolitik liegen, worauf jedoch noch nicht weiter eingegangen werden soll, da sich in der folgenden Übung mit verschiedenen Formen politischen Engagements befasst werden wird. 1) Die Schüler*innen bilden Vierergruppen und bekommen die Steckbriefe ausgeteilt, wobei in jeder Gruppe alle vier Steckbriefe einmal vertreten sein sollen. Je eine Person liest sich in Stillarbeit einen Steckbrief durch und soll anhand der an der Tafel gesammelten Kriterien beurteilen, ob die im Steckbrief vorgestellte Tätigkeit politisch ist. 2) In den Vierergruppen tauschen sich die Schüler*innen über die Steckbriefe aus und bewerten diese im Hinblick auf die zuvor gesammelten Kriterien. 3) In der Gruppe soll nun gemeinsam überlegt werden, ob und mit welchen Begriffen die Liste mit den Kriterien für „politisch sein“ erweitert werden soll. Anschließend werden diese an die Tafel geschrieben. 4) Im letzten Teil der Übung sollen die Schüler*innen ein Partner*inneninterview führen. Dabei fragt eine Person die andere, was sie in ihrer Freizeit macht. Die fragende Person soll daraufhin beurteilen, ob die Frei- zeitbeschäftigung der befragten Person politisch ist. Anschließend werden die Rollen getauscht. Zum Abschluss der Übung werden im Plenum die Ergebnisse besprochen. www.ich-wähl-mir-die-welt.de 7
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A3 4-ECKEN-SPIEL Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Unsere Demokratie findet nicht nur auf politischer Ebene statt. Sie ist vielmehr auch ein Lebensgefühl, welches sich im Alltag in Toleranz und gegenseitigem Respekt widerspiegelt. Diese Werte zu schützen und füreinander einzutreten, ist für ein gemeinsames Miteinander von elementarer Bedeutung. Mit dem 4-Ecken-Spiel des Vereins Gesicht zeigen! möchten wir Schüler*innen mit verschiedenen, kurz skizzier- ten Situationen konfrontieren, in denen es darum geht, einen Standpunkt zu beziehen, zu erläutern und weitere mögliche Handlungsoptionen zu finden. Zu jeder Situation gibt es drei festgelegte Handlungsoptionen und eine offene. Ziel ist es, den Teilnehmer*innen zu ermöglichen, ihren eigenen Standpunkt zu finden, Perspektiven zu wechseln und sie zu zivilcouragiertem Handeln zu motivieren! Material: 4-Ecken-Spiel (befindet sich in der Box, nicht in der Mappe) Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: Das Spiel enthält eine eigene Anleitung. 8 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE
A4 POSITIONIERUNGSSPIEL ZU POLITISCHEN AUSSAGEN
Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II
In diesem Spiel werden die Schüler*innen mit aktuellen politischen Aussagen konfrontiert, zu denen sie sich
positionieren sollen, um anschließend eine Entscheidung zu treffen. Den Schüler*innen soll bewusst werden,
dass es zwar möglich ist, schnelle Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen, dass dieses Prinzip aber
in der Politik nicht funktionieren kann. Ob nun die Verabschiedung eines neuen Gesetzes oder das Ankreuzen
eines Wahlzettels, politische Entscheidungen haben immer Auswirkungen und müssen deshalb wohl über-
legt sein.
Zeitaufwand: 20 – 30 Minuten
Arbeitsanweisung:
In der Mitte des Klassenraumes wird ein gedanklicher Positionsstrahl gezogen. Je weiter von der Mitte nach
links, desto mehr Zustimmung, je weiter von der Mitte nach rechts, desto mehr Ablehnung. Die Lehrkraft sucht
sich drei bis fünf der unten genannten Aussagen aus, liest sie nacheinander vor und fordert die Schüler*innen auf,
sich spontan entlang des Strahls zu positionieren. Nach jeder Aussage/Positionierung sollen die Schüler*innen
ihre Wahl begründen. Wer sich umstellen möchte, kann dies tun.
Im Anschluss werden sie vor die Entscheidung gestellt, klar zuzustimmen oder klar abzulehnen (z. B. Mehrheits-
entscheid). Die Schüler*innen sollen Stellung beziehen, ob es ihnen leicht oder schwer fiel, eine Entscheidung
zu treffen.
Aussagen zu denen sich die Schüler*innen positionieren sollen:
1. Der Islam gehört zu Deutschland.
2. Das Tragen einer Burka oder Niqab sollte verboten werden.
3. Gymnasien sollten abgeschafft werden. (Nur noch Gemeinschaftsschulen)
4. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sollten gleichgestellt werden (Ehe, Adoption).
5. Jede*r Studierende sollte unabhängig vom Einkommen seiner*ihrer Eltern vom Staat
Unterstützung während des Studiums bzw. der schulischen Ausbildung bekommen.
6. Es sollte einen „Veggieday“ in öffentlichen Kantinen geben.
7. Rüstungsexporte sollten verboten werden.
8. Die Türkei sollte in die EU aufgenommen werden.
9. Die Frauenquote ist überflüssig.
10. Atomkraftwerke müssen sofort abgeschaltet werden.
11. Die Linkspartei ist nicht regierungsfähig.
12. Deutschland braucht mehr direkte Demokratie. / Alle wichtigen Entscheidungen
in der Politik sollten mit Volksentscheiden getroffen werden.
13. Ärzt*innen sollten Sterbehilfe leisten dürfen.
www.ich-wähl-mir-die-welt.de 9BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE
A5 POLITIK DIREKT VOR DER HAUSTÜR
„Partizipation ist keine Spielwiese, sondern meint das Recht von Kindern,
sich an realen Entscheidungen beteiligen zu dürfen!“
Jürgen Bombosch, Diakonie RWL)
Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II
Welche gesellschaftspolitischen Partizipationsmöglichkeiten Kinder und Jugendliche haben, ist ihnen manch-
mal gar nicht klar. Es gibt eigens für sie geschaffene Gremien und Einrichtungen, in denen sie ihre Interessen
vertreten können. Denn auch Kinder und Jugendliche haben eine eigene Meinung. Wer, wenn nicht sie, kennt
sich mit den Themen, die nur sie betreffen, am besten aus. Es fehlt nur manchmal an dem Wissen, wie sie sich
beteiligen können.
Ziel dieser Übung ist es deshalb, mittels Diskussionen zu alltagsnahen Themen und bekannten Bereichen,
Jugendliche zu bestärken, sich vor Ort einzumischen und ihre Interessen zu vertreten. Hierfür sollen ihnen die
für sie geschaffenen kommunalpolitischen Gremien näher gebracht werden.
Zeitaufwand: Jeweils 1 Schulstunde
Arbeitsanweisung:
Variante 1: Diskussion als Mitglied des Jungen Rats
1) Einstieg: Die Lehrkraft fragt die Klasse, was Kindern und Jugendlichen an Kiel nicht gefällt, welche Probleme
es gibt, was ihnen fehlt. (Oberbegriffe: Freizeit, Sport, Verkehr, Bauwesen etc.). Die Äußerungen der Schüler*innen
werden an der Tafel gesammelt.
Daraufhin fragt die Lehrkraft, ob die Schüler*innen eine Idee haben, wo sie ihre Probleme einbringen können
bzw. wer sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Mögliche Antworten sind:
• Jugendhilfeausschuss (Zusammensetzung aus Politiker*innen und öffentlichen Träger*innen für allg. Kinder-
und Jugendhilfe, Teil des Jugendamtes)
• Kinder- und Jugendkommission (gewählte Ratsherren*frauen aller Parteien der Ratsversammlung, bespricht
alle Belange von Kindern- und Jugendlichen)
• der Junge Rat Kiel (16 Kinder- und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, besprechen nur die Belange von
Gleichaltrigen und planen entsprechende Projekte)
2) Diskussionsvorbereitung: Die Klasse oder Lehrkraft wählt eine Problemstellung aus Teil 1 oder aus den unten
aufgeführten Beispielen für eine anschließende Diskussion (alle Schüler*innen sollten die gleichen Hintergrund-
informationen haben). Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die eine die Pro-, die andere die Kontra-
seite übernimmt.
Szenario: Ihr seid nun ein Mitglied des Jungen Rates. Ein Jugendlicher aus Kiel kommt zu euch und schildert
euch sein Problem. Soll dieses Problem behoben werden?
Die Schüler*innen bekommen 10 Minuten Zeit, sich Gedanken zu Ihrer Position zu machen und auf eine Dis-
kussion vorzubereiten. (Gerne auch mit dem Handy oder anderen Medien)
3) Diskussion: Es wird ein*e Diskussionsleiter*in gewählt oder ernannt (Einhaltung der Gesprächsregeln,
sachliches faires Miteinander, gerechte Redezeit). Die Diskussionsleitung eröffnet die Diskussion und die zwei
Seiten dürfen ca. 15 Minuten ihre Meinungen vertreten. Kommt das Gespräch ins Stocken, kann die Lehrkraft
durch kleine Provokationen die Parteien zu neuen Gedankengängen anregen.
Nach Abschluss der Debatte sollen die Parteien einen Kompromiss finden, der alle Meinungen gleichermaßen
berücksichtigt und darüber abstimmen.
10 www.ich-wähl-mir-die-welt.deBLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE 4) Vertiefung: Die Lehrkraft fragt die Klasse: Warum gibt es überhaupt Kinder- und Jugendvertretungen in der Politik, können das nicht auch Erwachsene übernehmen? Oder: Was passiert wenn kein Kompromiss gefunden wird? Oder: Was würdet Ihr von einer Kinder-und Jugendvertretung auf Bundesebene halten? Variante 2: Diskussion als Expert*innen 1) Einstieg: Die Lehrkraft fragt die Klasse, was Kindern und Jugendlichen an Kiel nicht gefällt, welche Probleme es gibt, was ihnen fehlt. (Oberbegriffe: Freizeit, Sport, Verkehr, Bauwesen etc.). Die Äußerungen der Schüler*innen werden an der Tafel gesammelt. Daraufhin fragt die Lehrkraft: Wer hat alles ein Mitspracherecht an diesen Themen? Welche Gremien sollten berücksichtigt werden? (Ratsversammlung, Umweltschützer*innen, alle Altersgruppen, Unternehmen etc.) 2) Diskussionsvorbereitung: Die Klasse oder Lehrkraft wählt eine Problemstellung aus Teil 1 oder aus den vorgeschlagenen Beispielen für die anschließende Diskussion (alle Schüler*innen sollten die gleichen Hinter- grundinformationen haben). Die Klasse wird in fünf Gruppen eingeteilt. Gruppe: Die Stadt Kiel/ stellv. der*die Oberbürgermeister*in Gruppe: Ökologie/ Vertreter*innen einer Umweltorganisation aus Kiel Gruppe: Ökonomie/ Vertreter*innen der Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi) Gruppe: Gesellschaft/ Vertreter*innen der Kieler Bürger*inneninitiative Gruppe: Kinder-und Jugendliche/ Vertreter*innen des Jungen Rats Kiel Jede Gruppe überlegt sich, welche Haltung ihre Gruppe vertritt (Pro/Kontra). Danach bereiten sie Argumente für eine Diskussion vor. (Gerne auch mit dem Handy oder anderen Medien.) 3) Diskussion: Jede Gruppe schickt eine*n Vertreter*in in die Diskussion. Alle anderen beobachten. Zu Beginn darf jede Partei ihre Haltung kurz vorstellen (Plädoyer), dann wird diskutiert. Die Diskutant*innen können ausgetauscht werden, z.B. falls die Argumente ausgehen. Zum Schluss sollen die Gruppen einen Kompromiss finden und darüber abstimmen. 4) Vertiefung: Die Lehrkraft fragt die Klasse: Warum müssen überhaupt so viele verschiedene Gruppen mitreden? Was passiert, wenn nicht? Oder: Wieso sollten Kinder-und Jugendliche mitreden? Oder: Was würde passieren, wenn die Stadt alleine mit Ökonom*innen über Probleme diskutiert? Beispielthemen: • Ein neues Sport- und Freizeitbad soll am Hörn-Areal gebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25 Mio. Euro und die Kieler Bäderlandschaft wird grundlegend verändert. • Eine neue Veloroute (Fahrradstraße) soll gebaut werden. Diese soll das Universitätsgelände mit dem Ortsteil Hassee (CITTI-Park) verbinden. • Schüler*innen sollen, wie Senior*innen, höhere Rabatte auf Fahrten mit dem Öffentlichen Nahverkehr bekommen: ein Schüler*innenticket mit 25 Prozent auf eine übliche Monatskarte. • „Kiel - Sailing City“, aber nicht alle Kinder und Jugendliche können schwimmen. Verpflichtender Schwimmunterricht an allen Schulen und mehr Möglichkeiten in Vereinen kostengünstig schwimmen zu gehen. Tipp: Der Junge Rat hat eine eigene Homepage, über die die Schüler*innen gerne Kontakt aufnehmen können: www.jungerrat-kiel.de www.ich-wähl-mir-die-welt.de 11
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A6 WAHLBETEILIGUNG Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. II Diese Übung soll die Schüler*innen mit dem Problem der sinkenden Wahlbeteiligung konfrontieren. Es soll erkannt werden, dass die Gründe dafür vielschichtig sind. Material: Arbeitsbogen A6 (Wahlbeteiligungsstatistiken der Europa- und Bundestagswahlen nach Alter) Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: 1) Die Schüler*innen sollen die beiden Statistiken auswerten und folgendes erkennen: • sinkende Wahlbeteiligung (seit den 70er Jahren bis 2014 erkennbar) • Jüngere wählen seltener • Seit 1999 beteiligten sich weniger als die Hälfte aller deutschen Wahlberechtigten an den Europawahlen 2) Im nächsten Schritt sollen mögliche Gründe für die sinkende Wahlbeteiligung aufgezeigt werden. Mögliche Ergebnisse: • Politikverdrossenheit • Mangel an Transparenz in der Politik • Zu komplizierte Strukturen • Soziale und wirtschaftliche Unzufriedenheit • Unzufriedenheit mit dem politischen System • Mangelndes Vertrauen in die Parteien 3) Die Schüler*innen sollen die sinkende Wahlbeteiligung bewerten. Dabei ist die Bewertung mit Argumen- ten zu belegen. Mögliche Ergebnisse: • Es ist nicht die gesamte Bevölkerung repräsentiert • Die Meinung der jungen Wähler*innen wird nicht ausreichend abgebildet (Info für Schüler*innen: Menschen mit niedrigem Sozialstatus oder geringer Bildung gehen auch seltener zur Wahl als andere) • Desinteresse an der Demokratie stellt eine große Gefahr dar • jedoch: Wahlbeteiligung ist nicht der einzige Indikator für eine vitale Demokratie 4) Bei dieser Aufgabe entwickeln die Schüler*innen eigene Ideen, wie man dieser Entwicklung entgegenwir- ken kann. Mögliche Ergebnisse: • Mehr Möglichkeiten für Bürger*innenbeteiligung schaffen • Eine größere öffentliche Debatte trägt zur Politisierung der Gesellschaft bei • mehr politische Bildung • Einführung einer Wahlpflicht 5) Zum Abschluss der Einheit können die Schüler*innen folgendes Gedankenexperiment machen: Überlegt euch, was es für die Demokratie bedeutet, wenn die Wahlbeteiligung unter ca. 20 % sinkt? Welche Auswirkungen sind denkbar? (Info für Schüler*innen: In der Slowakei haben bei der Europawahl 2014 nur 13 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.) 12 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A7 SOLLTE ES IN DEUTSCHLAND EINE WAHLPFLICHT GEBEN? Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. II Das Phänomen der sinkenden Wahlbeteiligung muss den Schüler*innen vorab bekannt sein und als Problem verstanden werden. Hierzu kann entweder die Aufgabe A6 bearbeitet werden oder es muss eine kurze Ein- führung in die Problematik, inklusive einiger Gründe und möglicher Folgen geben (diese können Sie in den möglichen Ergebnissen von A6 finden). Material: Arbeitsbögen A7a – b Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: Diese Übung kann mit folgender Meinungsabfrage eingeleitet werden: Seid ihr dafür, dass die Teilnahme an Wahlen in Deutschland Pflicht wird? Anschließend wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe bekommt den Artikel gegen Wahlpflicht, die andere Gruppe den Artikel für Wahlpflicht. Die Schüler*innen erhalten ca. 20 Minuten Zeit, um sich ihren Artikel durchzulesen, die darin enthaltenen Argumente zu entnehmen und sich auf eine Diskussion vorzube- reiten. Die Diskussion kann erst in Kleingruppen ausgetragen werden, sodass jede*r die Chance bekommt, zu Wort zu kommen. Abschließend werden im Plenum die Argumente gesammelt. Argumente gegen Wahlpflicht: • Einschränkung der individuellen Handlungsfreiheit • Behandlung der Ursachen, nicht des Symptoms • Nichtwählen kann politisch sein, z. B. Ausdruck des Protests • Zivilgesellschaftliches Engagement ist auch eine Form der Beteiligung • Wähler*innen sind nicht informierter • aus Protest zufällig ausgefüllte Wahlzettel Argumente für Wahlpflicht: • kann bewirken, dass populistische Parteien geschwächt werden • Wahlbeteiligungen von über 90 % bildet die Bevölkerung genau ab • kann den Einfluss von Protestwähler*innen relativieren • schmälert die Macht von Interessengruppen bei Wahlen • Parteien verpflichtet, attraktive Inhalte zu liefern, Wahlkampfstrategien ändern sich: • keine Demobilisierung der Wähler*innenschaft der Konkurrenz • keine Wahlversprechen an Stammwähler*innenschaft • ungültiger Wahlzettel als Protest weiterhin möglich Es folgt eine Probeabstimmung. Die Schüler*innen stimmen in der Klasse über die Einführung einer Wahlpflicht ab. Hierbei kann ein Vergleich zur vorherigen Meinungsabfrage gezogen werden. Haben sich die Ansichten der Schüler*innen über eine Wahlpflicht verändert? Warum hat sich ihre Meinung geändert und was hat sie besonders überzeugt? www.ich-wähl-mir-die-welt.de 13
BLOCK A MEINE STIMME IN DER DEMOKRATIE A8 TESTE DICH: WELCHER WAHLTYP BIST DU? Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen zur Wahl gehen oder nicht und es gibt unterschiedliche Arten, wie sie ihre Entscheidung, ein Kreuz zu setzen oder es zu lassen, treffen: Vielleicht sind sie frustriert, ein Gewohnheitstier oder absolut überzeugt. Diese Übung soll die Schüler*innen mit ihrem eigenen Wahlverhalten konfrontieren: Sie setzen sich mit den verschiedenen Möglichkeiten des Wählens und Nichtwählens, den dahinter stehenden Motivationen, sowie Vor- und Nachteilen auseinander. Sie denken über ihre eigene Rolle und über ihr eigenes politisches (Wahl-) Verhalten nach. Zugleich wird eine politische Diskussion geübt, um sich auf eine gemeinsame Lösung auf Basis eines Kompromisses zu einigen. Darüber hinaus positionieren sich die Schüler*innen zu einem Wahltyp und denken über die Vielfältigkeit demokratischer Wahlentscheidung nach. Die verschiedenen Typen und die dazugehörigen fiktiven Personen sollen die Möglichkeiten des Wählens und Nichtwählens veranschaulichen. Darüber hinaus bieten die Typen den Schüler*innen eine Identifikation, sowie die Möglichkeit sich über Vor- und Nachteile des Wählens und Nichtwählens bewusst zu werden. Material: Arbeitsbogen A8 Zeitaufwand: 1 Schulstunde Arbeitsanweisung: Zu Beginn der Übung werden Arbeitsgruppen gebildet. Die Lehrkraft teilt die Übungszettel aus, die von den Schüler*innen bearbeitet werden sollen. Die erste Übung (ca. 10 Minuten) wird einzeln bearbeitet, Aufgabe 2 (ca. 15 Minuten) und 3 (ca. 20 Minuten) erfolgen in Gruppenarbeit. Falls anschließend noch Zeit ist, kann im Plenum über die Vor- und Nachteile des Wählens und Nichtwählens diskutiert werden. Die Pro- und Kontra-Argumente sollen hierbei von der Lehrkraft an der Tafel festgehalten werden. Mögliche Ergebnisse: Neun fiktive Personen Tim: Nichtwähler aus Desinteresse Lara: Nichtwählerin aus Unzufriedenheit Hildegard: Traditionswählerin Bernd: Personenorientierter Wähler Said: Programmorientierter Wähler Sophie: Programmorientierte Wählerin Bo: ungültig Wählender Elin: Stimmungswählerin Knut: Taktischer Wechselwähler 14 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE
BLOCK B
WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE
„Reden ist unser Privileg. Wenn wir ein Problem haben,
das wir nicht durch Reden lösen können, dann hat alles keinen Sinn.“
Rosa Luxemburg, polnisch-deutsche Politikerin
Die Räume für das Primat des Politischen werden immer enger. Vorgebliche Sachzwänge, mächtige Wirtschafts-
interessen und andere, lobbyrepräsentierte Gruppenbelange grenzen politische Spielräume ein. Europäisierung
und globale Vernetzungen führen zur Verlagerung politischer Entscheidungen auf höhere Ebenen und entfernen
sie damit weiter vom Souverän. Repräsentative Politik verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit und bereitet
damit das Feld für Formen direkter Demokratie mit all ihren Möglichkeiten und Chancen, aber auch ihren be-
kannten Problemen. Und in Teilen der Gesellschaft wächst nicht nur Intoleranz und Fremdenhass, auch der Ruf
nach einfachen Lösungen und autoritärer Führung wird immer lauter.
Gleichzeitig befinden sich die Parteien, die zentralen Akteurinnen der Meinungsbildung und der politischen
Entscheidung, ganz offensichtlich in einer schwierigen Situation. Auch ihnen wird zunehmend Vertrauen ent-
zogen. Die soziokulturellen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte haben politische Lager verflüssigt; gesell-
schaftliche Großorganisationen und damit die ihnen nahestehenden Parteien haben ihre Bindungswirkung
verloren. Die Schnelligkeit der Veränderungen, auch in globaler Perspektive, eine enorme Vielfalt herkömm-
licher und digitaler Medien und Diskursorte (fragmentierte Öffentlichkeit) und die zunehmende Komplexität
von Problemstellungen und Lösungen haben die Anforderungen an das politische Personal erheblich erhöht.
Das alles macht die zentralen Aufgaben der Parteien, politische Auffassungen und Interessen zusammenzu-
führen, zu fokussieren, in parlamentarische Debatten zu bringen und in Gesetze münden zu lassen, immer
schwieriger. Die aktuelle Situation der Parteien stellt sich gleichermaßen als Glaubwürdigkeits-, Legitimations-
und Funktionskrise dar.
Die Parteien reagieren auf diese Situation mit nur zaghaften Öffnungen der eigenen Strukturen, politischer
Fixierung auf die Mitte der Gesellschaft und einer für die Demokratie bedrohlichen Abkehr von grundlegenden
Fragen und Debatten. Sie verlieren an Diskursfähigkeit und Profil. Alternative und konkurrierende Gesell-
schaftsentwürfe und gesellschaftliche Prägungen werden immer weniger kenntlich.
Um Schüler*innen zu helfen, ein Grundverständnis von den Parteien, ihrer aktuellen Situation, ihren Aufgaben,
Weltsichten und politischen Zielen zu entwickeln, sollten sie mit diesen grundlegenden Punkten und der pro-
grammatischen Verortung der jeweiligen Partei vertraut gemacht werden. Das ist die Grundlage, um beurteilen
zu können, was sich konkret hinter welcher Politik verbirgt und welche Konsequenzen das Kreuzchen auf dem
Stimmzettel haben kann.
www.ich-wähl-mir-die-welt.de 15BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE B1 WOFÜR STEHEN SIE? – PARTEIEN UND IHR GRUNDVERSTÄNDNIS Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Die Informationstexte zu den Parteien sind der Versuch, das Wesentliche der Programmatik der Parteien zu erfassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler*innen keine klaren Vorstellungen von Parteien und ihrer grundlegenden Ausrichtung haben. Darum werden hier charakteristische Merkmale der Parteien über die aktuelle Wahl hinaus abgebildet. Jede Partei wird dabei in der Tendenz positiv, das bedeutet im Sinne ihrer Selbstdarstellung vorgestellt. Dies geschieht auch über wörtliche Äußerungen der Landesparteien. Aufgenommen sind, gemäß Erlass zur politischen Bildung in Schulen (http://www.schulrecht-sh.de/texte/p/ politische_bildung.htm), die zurzeit im Landtag repräsentierten Parteien, sowie die mit hoher Wahrschein- lichkeit zukünftig im Landtag repräsentierten Parteien. Materialien: Arbeitsbögen B1a – i Zeitaufwand: 1 Doppelstunde Arbeitsanweisung: Die Schüler*innen werden zunächst per Zufall einer Partei zugelost. 1) In Gruppenarbeit sollen sie die Infotexte zu den Parteien lesen und ihre wichtigsten Ziele herausarbeiten. 2) Anschließend sollen sie sich unter den Etiketten drei aussuchen, die sie für besonders wichtig für die ihnen zugeloste Partei halten. Diese Auswahl ist entscheidend, denn die meisten Parteien vertreten Anteile aller Schwerpunkte; die Gewichtung macht den Unterschied unter den Parteien aus. 3) Sie sollen die Ziele der Partei in einen griffigen Wahlkampfslogan verwandeln. 4) Anschließend sollen sie in einer Wahlkampfansprache deutlich machen, wofür ihre Partei steht und warum man sie wählen sollte. In dieser Wahlkampfansprache sollten sie den Slogan verwenden. Tipp: Vereinfachte Versionen der Parteibeschreibung lassen sich unter http://modul.tivi.de/logo-parteienmodul/ finden. 16 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE
B2 WAS MACHEN SIE? – PARTEIEN UND IHR PROGRAMM
Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. II
Die zitierten Auszüge aus den Parteiprogrammen zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl 2017 sollen den
Schüler*innen die Möglichkeit geben, sich inhaltlich mit einer bestimmten Parteiposition auseinanderzusetzen.
Die Wahl fiel auf das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik, da es ein gutes Beispiel darstellt für eine gesellschaft-
lich wie politisch kontrovers geführte Debatte mit dringendem Lösungsbedarf, welches auch durch seine mediale
Präsenz den Schüler*innen nicht unbekannt ist. Es wird eine gewisse Grundkenntnis der jeweiligen Parteiaus-
richtung sowie zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik vorausgesetzt. Eine mögliche Schwierigkeit könnte die
Zuteilung der AfD-Position sein. Es wird zwar vermutet, dass Schüler*innen damit umgehen können, dennoch
wäre es womöglich sinnvoll, in der Nachbereitung die AfD-Position aufzufangen, damit die Schüler*innen diese
reflektieren können.
Material: Arbeitsbögen B2a – j
Zeitaufwand: 1 Doppelstunde
Arbeitsanweisung:
Die Schüler*innen werden zunächst per Zufall einer Partei zugelost.
1) In Gruppenarbeit sollen sie die Programmauszüge lesen und die wichtigsten Aussagen der Partei sowie ihre
Haltung zum Thema Zuwanderung, Asyl und Integration herausarbeiten. Zusätzlich kann Art. 16a GG ausge-
geben werden (B2a). Hier würde sich auch ein einfaches Achsenmodell anbieten, das eine politische Verortung
der Parteien erlaubt (B2b).
2) Anschließend sollen sie in der Rolle von Vertreter*innen der jeweiligen Partei eine politische Debatte über
Asyl- und Flüchtlingspolitik führen, in der die Lehrkraft die Moderation übernimmt. Die Schüler*innen werden
feststellen, dass die Parteihaltungen zum Teil identisch sind, was ihnen die Möglichkeit gibt, zu koalieren.
Die Moderation wirft dabei folgende mögliche Fragestellungen ein:
• Welches Bild von Flucht und Geflüchteten wird von der Partei bedient?
• Bedeutung von Fluchtursachen und gefährlichen Fluchtwegen
• Eigene Verantwortung für Fluchtursachen und deren Bekämpfung
• „Offene Gesellschaft“ oder „Abschottung“ ?
• Wie kann Integration gelingen?
• Welche Rolle spielen Integrationsangebote und welche Erwartungen sind damit verbunden?
In welcher Weise ist der Staat hier in der Verantwortung?
• Welche Bedeutung wird einer Willkommenskultur beigemessen?
• Wer hat Anspruch auf Asyl?
• Welche Rolle spielt der Schutz von eingewanderten Menschen bei uns?
• Welche Rollen spielen die besonderen Situationen von Frauen und Minderjährigen?
Für den Ablauf der politischen Debatte gibt es mehrere Varianten:
Variante 1): Plenum
Die Gruppen bleiben im Parteiverbund und führen die Debatte im Plenum.
Variante 2): Gruppendiskussion
Die Gruppen im Parteiverbund werden aufgelöst und neu zusammengesetzt, sodass in jeder Gruppe jede Partei
einmal vertreten ist. Die Debatte findet innerhalb dieser neuen Gruppe statt. Da die Lehrkraft hier nicht mode-
rieren kann, sollten die Diskussionsfragen den Schüler*innen vorgelegt werden.
www.ich-wähl-mir-die-welt.de 17BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE Variante 3): Fishbowl Die Klasse teilt sich in eine kleine und eine große Gruppe. Erstere ist der Debattenkreis (inner circle), in der jede Partei genau einmal vertreten ist. Die zweite Gruppe entspricht dem Rest der Klasse und bildet den Beobachtungs- kreis (outer circle), dient aber auch ihrer Partei als Auswechseldiskutant*innen. Ein Wechsel findet entweder nach einer bestimmten Zeit statt oder wenn die Argumente ausgehen. 3) Nach Abschluss der Debatte soll im Plenum eine Nachbereitung erfolgen, um das Gesagte und Gehörte einzuordnen und zu reflektieren. Welche Argumente waren besonders stark/schwach und warum? Welche Parteien passen inhaltlich zusammen, welche nicht? (Mögliche Koalition) Wie stehen die Schüler*innen zu den vorgebrachten Argumenten? Tipp: Die kompletten Wahlprogramme sind auf der Website www.ich-wähl-mir-die-welt.de verlinkt. Mögliche Ergebnisse/Inhalte der Parteien: Es handelt sich um Zusammenfassungen unter Verwendung der Sprache der jeweiligen Partei. AfD • Reform des Asylrechts, Fokussierung auf „Missbrauchsbekämpfung“ • Asyl als Hilfe auf Zeit, starke Begrenzung von Zuwanderung • Trennung zwischen „Asylsuchenden und Einwanderungswilligen“ und zwischen „politischer Verfolgung, Armutsmigration und Flucht vor Kriegen“ • Verfahrensbeschleunigung, „abgelehnte, kriminelle und extremistische Asylbewerber“ umgehend abschieben, Asylberechtigte auf ganz Europa verteilen • Kein Asyl für Personen aus einem Mitgliedstaat der EU oder einem sicheren Drittstaat • Asylantrag nur in deutschen Botschaften der Herkunftsländer oder Auffangzentren • Asylanträge ohne urkundlichen Nachweis von Staatsangehörigkeit und Identität sollen als unbegründet oder unzulässig abgelehnt werden • Grenzschutz gegen „illegale Einwanderung“, Schaffung von Registrierungsstellen für Asylsuchende • Integration, Willkommenskultur und „offene Gesellschaft“ als Negativbeispiele CDU: • Schutz von geflohenen Menschen als humanitäre Verantwortung • Unterscheidung zwischen (Kriegs)verfolgten und denjenigen, die bessere Lebensperspektive wollen, bzw. zwischen Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive (Feststellung ihrer Kompetenzen und Bedürfnisse, Erstorientierung) und Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive (Abschiebung) • Schaffung von Landeskompetenzzentren zur Zentralisierung von institutioneller Zusammenarbeit, Einführung Landesintegrationsgesetz (Regelung von Fördermaßnahmen und Sanktionen) • Bekenntnis zu Toleranz, Fokussierung auf „Integration als Holschuld“ • Sprachkurse vom ersten Tag • Integration von Flüchtlingskindern in Kindertagesstätten • Ausbildung der Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), auch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund • Klärung berufliche/schulische Qualifikationen der Flüchtlinge vor Verteilung in Kommunen • Flüchtlinge bis 25 Jahre Zugang zur Berufsschule, Schulabschluss ermöglichen • Eingliederungskonzept in den Arbeitsmarkt • Anerkennung im Ausland erworbener Ausbildungs-/Studienleistungen ermöglichen 18 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE
Piraten:
• Solidaritätserklärung an alle Menschen, die aufgrund ihrer Abstammung, Religion, Hautfarbe oder Behinderung
ausgegrenzt oder angegriffen werden
• Bekenntnis zu weltoffenem Schleswig-Holstein und gegen Rechtsextremismus
• Förderung einer solidarischen Gemeinschaft (Zivilcourage)
• Europa als ein friedensförderndes föderalistisches Projekt, keine Renationalisierung einzelner Staaten,
keine Grenzkontrollen (Schleswig-Holstein im Ostseeraum als Schlüsselrolle)
• Entlastung von bestehenden Bildungseinrichtungen (DaZ) durch Online-Lernplattform (unabhängig von
personellen und räumlichen Ressourcen)
SPD:
• Weiterentwicklung vorhandener Koordinierungsstellen/ Integrationsbeauftragte, Stärkung der gesellschaft-
lichen Integration durch Haupt- und Ehrenamt
• Erfolgreiche Integration durch Erlernen der deutschen Sprache
• Bedarf an ausreichenden und zielgruppengerechten Angeboten für Zugewanderte unabhängig von ihrer
Bleibeperspektive, besondere Förderung von Frauen
• Integration als gesellschaftliche Teilhabe und Querschnittsaufgabe
• Stärkung von Migrationssozialberatungsstellen
• Finanzierung von Migrantenselbstorganisation, türkischer Gemeinde und Flüchtlingsrat
• Schaffung einer Diversitätsschnittstelle in der Landesregierung für interkulturelle Öffnung im öffentlichen
Dienst (Chancengleichheit, moderne, vielfältige und vielsprachige Verwaltung)
• Bekämpfung von Flucht(ursachen) und Vertreibung durch Unterstützung einer Partnerregion
SSW:
• Integration als Kernaufgabe, Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen in einem Landesintegrations-
ministerium
• Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, unbürokratische und erleichterte Arbeitsvermittlung
• freier Zugang zu Bildungsangeboten, bedarfsgerechter Ausbau und kontinuierliche Förderung des DaZ
• schneller Erwerb der deutschen Sprache, Anzahl der Deutsch-Kurse für Flüchtlinge erhöhen
• Weiterentwickelung von aktiver Integrationspolitik in Kommunen (Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter)
• politische Mitgestaltung: feste kommunale Ausländerbeiräte
• keine Aushöhlung des Asylrechts, humanitäres Bleiberecht (Stichtagsunabhängigkeit, Ausübung einer
Erwerbstätigkeit, verlässliche Perspektiven für Kinder, rechtmäßige Aufenthaltserlaubnis)
• Niederschwellige Hilfen: Migrationssozialberatung, psychologische Hilfen
• Kulturinitiative starten, um den interkulturellen Dialog zu fördern.
Bündnis 90/ Die Grünen:
• Bekenntnis zur weltoffenen Gesellschaft, Zuwanderung als Bereicherung
• Menschenrechtsbasierte Asylpolitik: Schutz bieten vor Krieg, Verfolgung und existenzieller Not, Schaffung
sicherer und legaler Fluchtwege, Ablehnung des Konzepts sicherer Herkunftsstaaten
• Fluchtursachen bekämpfen durch verantwortungsvolle Politik auch im Agrar-, Energie- und Handelsbereich
(Klimawandel)
• Asylverfahren nach rechtsstaatlichen Standards (unabhängige Verfahrensberatung, Dolmetscher*innen,
rechtliche Unterstützung)
• Verbesserung in den Unterkünften für Geflüchtete (Geflüchtetenbeiräte, nicht länger als drei Monate Erst-
aufnahme, keine Trennung nach Bleibeperspektive, Zeit nutzen für Beratung, Anhörung, Willkommenskurse)
• Einwanderungsgesetz für Arbeitsmigrant*innen (menschenrechtliche Verantwortung)
• Freiwillige Ausreise vor Abschiebung (unabhängig beraten, finanziell unterstützen), gegen nächtliche
Abschiebungen und Abschiebehaft
• Integration durch Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt (selbstbestimmt Leben): Kontakt auf Augenhöhe,
Peer-to-Peer Projekte, Zugang zu Sprach- und Integrationsangeboten von Anfang an
• Kompetenzbündelung in einem bestehenden Ministerium
• Wahlrecht und Partizipation auch ohne Staatsbürgerschaft
• Nach gelungener Integration deutsche Staatsbürgerschaft, mehrere Staatsbürgerschaften möglich
www.ich-wähl-mir-die-welt.de 19BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE Die LINKE: • Schleswig-Holstein als Einwanderungsgesellschaft, verschiedene kulturelle Prägungen sind gesellschaftliche Normalität, Solidarität mit geflüchteten Menschen • Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl, gegen weitere Verschärfungen, Sondergesetze zulasten von Flüchtlingen (sechs Monate in Sammelunterkünften, Arbeitsverbot) aufheben, Abschiebestopp • Aufnahme unabhängig von Bleiberechtsperspektive, Integrationsförderung statt Rückkehrmanagement, für alle aufgenommenen Schutzsuchenden gleiche Regelungen • schnelle dezentrale Unterbringung in Wohnungen, Not- und Massenunterkünfte schließen • Mehr finanzielle Mittel, Personal für Städte/Gemeinden, mögliche Übernahme von Ehrenamtlichen in Öffent- lichen Dienst • Weiterentwicklung der Willkommenskultur, gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten (Zugang zu Bildung und Arbeit, Gesundheitsversorgung), Selbstbestimmung • Qualifizierungsmaßnahmen zur beruflichen Integration (Angebote bei beruflicher Teilanerkennung), Beschleunigung der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes • Schneller und unbeschränkter Zugang zu Sprach- und Integrationskursen für alle Geflüchteten, Begleitung von Erstberatung bis zu Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag • Kita-Plätze für alle geflüchteten Kinder in regulären Kitas, Schulbesuch in regulären Schulen • Weltoffenheit und Willkommenskultur, demokratischer Wertekanon, Eingewanderte sollen kulturelle Unterschiede zu ihren Herkunftsländern akzeptieren • Politische Beteiligungsrechte für Eingewanderte, Geflüchtete und Asylsuchende • Strategie zur Bekämpfung der Fluchtursachen, nicht der Geflüchteten (Diplomatie) FDP: • Anspruch auf Integration: Menschen mit begründetem Asylantrag oder Aufenthaltserlaubnis in Deutschland • Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, kurze Abhängigkeit von staatlichen Hilfen • Für Flüchtlinge und Zuwanderer mit Bleibeperspektive verpflichtender Zugang zu Sprachkursen, schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt • Betriebe bei Einstellung von Flüchtlingen unterstützen, Ablegen von schriftlichen Leistungen in Schulen/ Berufsschulen auch in englischer Sprache • Unterstützung für Kindertagesstätten, Schulen und Kommunen (Integrationsauftrag) • Integration: Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen (Rahmenbedingungen) und Zivilgesellschaft (Kommunen, Initiativen, Vereine, Engagierte) • Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern in einer Gesellschaft ohne Parallelstrukturen oder Wertekonflikte (hilfreich Sportvereine, offene Jugendarbeit, Freiwillige Feuerwehren, Kultureinrichtungen und Religionsgemeinschaften) • Werte des Grundgesetzes als nicht verhandelbare Grundlage für das Zusammenleben • Ursachen und Auswirkungen von Flucht und Migration benennen und gesellschaftliche Diskussion ermöglichen • Gebot der Rechtsstaatlichkeit beachten, rechtskräftig vollziehbar ausreisepflichtige Menschen in ihre Heimatländer zurückzuführen, hierfür Mittel und Personal • Kontrollsystem an den EU-Außengrenzen (legal einreisende Flüchtlinge erfassen und verteilen, illegale Einreisen unterbinden) 20 www.ich-wähl-mir-die-welt.de
BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE B3 WIE SEHEN SIE AUS? – PARTEIEN UND IHRE PLAKATE Dass sich die Parteien im Wahlkampf befinden, merkt man spätestens dann, wenn auf der Straße sämtliche Plakatwände, Bäume und Laternenpfähle mit Plakaten tapeziert wurden. Es bräuchte schon eine besondere Scheuklappenvorrichtung, um dieser Allgegenwärtigkeit nicht ansichtig zu werden, sie drängt sich förmlich auf. Das Ziel der Parteien ist klar: Gewählt werden! Ein Wahlkampf ohne Plakate war und ist undenkbar. Durch sie können die Parteien die Wahrnehmung der Be- trachter*innen beeinflussen: Ein auffällig gestaltetes Plakat schafft Aufmerksamkeit und vermag es womöglich so, Diskussionen anzuregen, während ein gesetzt wirkendes den Stammwähler*innen versichert, dass alles beim Alten bleibt. Selbst ein unglücklich oder fehlerhaft gestaltetes Plakat(-element) kann dadurch zum Gesprächsstoff werden. Didaktische Vorbemerkung: Geeignet für Sek. I und II Die Schüler*innen sollen sich hier mit der Erzeugung von bestimmten Wirkungen anhand von Wahlplakaten der Parteien (Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012) auseinandersetzen. Material: Arbeitsbögen B3a – g Zeitaufwand: 1 – 2 Schulstunden Arbeitsanweisung: 1) Die Wahlplakate werden in der Klasse aufgehängt. Die Schüler*innen sollen sich eines aussuchen, dass ihnen gefällt und eines, dass sie nicht mögen. Es geht dabei um das reine Gefühl/den persönlichen Geschmack. Sie sollen ihre Auswahl begründen. 2) Die Schüler*innen werden per Zufall einer Partei zugelost, deren Wahlplakate sie in Gruppenarbeit analysieren sollen. Hierbei sollen sie auch die Gesamtwirkung, Farb- und Motivwahl berücksichtigen. • Wie stellt sich die Partei dar? • Spricht mich das an? • Warum spricht mich das an? • Wie wird die Wirkung erzeugt? 3) Dann werden die Ergebnisse im Plenum der Klasse präsentiert und die Plakate untereinander verglichen. Hierfür sollen die Wahlplakate für alle sichtbar aufgehängt werden und auf ihre jeweilige Wirkungsweise und Ansprechbarkeit überprüft werden. 4) Variante 1: Anschließend sollen sich die Schüler*innen überlegen, wie für sie die ideale, perfekte Partei aus- sehen soll und für diese dann ein Wahlplakat nach persönlicher Ansprechbarkeit konzipieren. Dieses werden sie dann wiederum der Klasse unter Begründung ihrer Gestaltungswahl präsentieren. Variante 2: Die Schüler*innen können hier kreativ werden. Sie sollen in ihren bestehenden Gruppen eine andere oder neue Variante der Plakate erstellen. Dabei können zum Beispiel der Hintergrund, der Titel oder die Person auf dem Plakat verändert werden. Auch eine satirische Interpretation ist möglich. Mögliche Ergebnisse für die Analyse der Plakate: CDU: • Gesamtwirkung: Überschaubar, ordentlich, gestellt, förmlich, offiziell • Spitzenkandidat Jost de Jager immer im Vordergrund als personalisiertes Aushängeschild • seriöses, förmliches Auftreten im Anzug • engagierte Mimik und Gestik bekräftigen Forderungen www.ich-wähl-mir-die-welt.de 21
BLOCK B WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE
• Verschiedenfarbige Hintergründe, die keinen thematischen Zusammenhang aufweisen (z. B. Energiepolitik
ist orange nicht grün)
• Farben wirken poppig und dynamisch, werten offizielles Auftreten auf, „Verjüngung“
• Politische Forderungen als knappe Slogans formuliert, immer mit der Aussage „Mit der CDU“ und
Jost des Jager verbunden
• Wenig Abwechslung, dafür einprägsam
SPD:
• Gesamtwirkung: Dynamisch, freundlich, aktiv, nahbar, überzogen
• Spitzenkandidat Torsten Albig immer im Vordergrund als personalisiertes Aushängeschild
• seriöses Auftreten im Anzug
• freundliche Mimik, tatkräftig in verschiedenen Situationen
• unscharfe, wechselnde Hintergründe
• „mitten aus dem (politischen) Alltag“, dynamische Wirkung
• politische Forderungen als knappe Slogans formuliert, immer mit der Aussage „Mein Lieblingsland braucht
[…] Torsten Albig“ verbunden
• sehr personalisiert
• weniger Forderung, eher Wunschformulierung
• zusätzlich ein Herz-Logo, dass Heimatverbundenheit und Nähe ausdrücken soll
Bündnis 90/ Die Grünen:
• Gesamtwirkung: jung, hip, frech, natürlich, informell, elitär
• Spitzenkandidat Robert Habeck immer im Vordergrund als personalisiertes Aushängeschild, aber namentlich
nicht genannt
• lockeres, natürliches Auftreten in Alltagskleidung
• im Hintergrund verschiedene Situationen als Selfies inszeniert („ich nehme euch mit“)
• informell, mitten aus dem Leben, privat, alltäglich, heimatlich, aktiv
• politische Forderungen nicht klar, sondern als ironische Wortspiele formuliert, immer mit der Aussage
„Für hier mit dir“ in grüner Farbe verbunden
• informelle Sprache, Aussagen nicht immer verständlich, um die Ecke gedacht (z. B. Bankenkrise =
Bildungspolitik), setzt Vorwissen voraus bzw. den Willen, verstehen zu wollen, was sie meinen
Die Piraten:
• Gesamtwirkung: Wild, chaotisch, rebellisch, unorthodox
• Kein personalisiertes Aushängeschild, sondern wild wechselnde Motive, Farben und Hintergründe
• wirkt überzeichnet, „selbst gemacht“ und schrill
• Eine Vielzahl an politischen Forderungen, formuliert als Wortspiele, ironische Witze oder Provokation
• kein einheitliches Thema oder politische Agenda
• Verbindendes Element: Orange als Schrift- und Balkenfarbe, das Logo und der Aufruf, Piraten zu wählen
• Schrift immer in einem Balken, wirkt plakativ
Die Linke:
• Gesamtwirkung: Plakativ, kämpferisch, laut, aggressiv, reduziert
• keinerlei Personalisierung, sondern ausschließlich Text
• einheitliche Darstellung: Roter Hintergrund (Parteifarbe) mit gut leserlicher weißer Schrift und „Frei“-
Schablonen im Graffiti-Stil
• Ausnahme: Sozial-Graffito, was eher der Partei entspricht, da der Begriff „frei“ eher mit der FDP assoziiert
wird
• politische Forderungen werden als Missstände formuliert, die durch die Linke beendet werden sollen („frei von“)
• klar verständlich, gut lesbar
22 www.ich-wähl-mir-die-welt.deSie können auch lesen