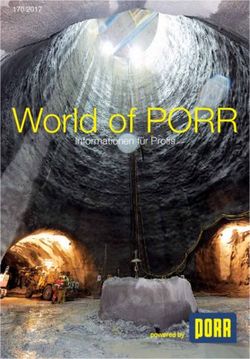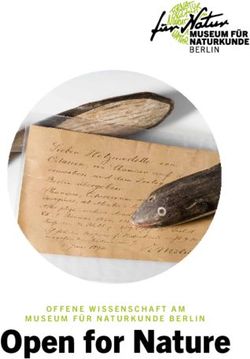Chemikalieneintrag in Gewässer vermindern - Trifluoracetat (TFA) als persistente und mobile Substanz mit vielen Quellen - hintergrund // ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
hintergrund // november 2021 Chemikalieneintrag in Gewässer vermindern – Trifluoracetat (TFA) als persistente und mobile Substanz mit vielen Quellen
Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutzmittel Postfach 14 06 06813 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 buergerservice@uba.de Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt /umweltbundesamt /umweltbundesamt Autorinnen und Autoren: Kirsten Adlunger, Julia M. Anke, Gunnar Bachem, Helena Banning, Annegret Biegel-Engler, Katrin Blondzik, Ulrike Braun, Alexander Eckhardt, Daniela Gildemeister, Falk Hilliges, Gabriele Hoffmann, Franziska Jentzsch, Sondra Klitzke, Jochen Kuckelkorn, Kerstin Martens, Alexandra Müller, Christina Pickl, Ulrike Pirntke, Jörg Rechenberg, Daniel Sättler, Uwe Schmidt, Gunther Speichert, Ingo Warnke, Jeannine Wehner, Ronny Wischer Redaktion: Kirsten Adlunger, Helena Banning, Franziska Jentzsch Satz und Layout: Atelier Hauer & Dörfler GmbH, Berlin Publikationen als pdf: www.umweltbundesamt.de/publikationen Bildquellen: Titel: artegorov3@gmail/stock.adobe.com S. 9, 23, 26, 29, 35, 36: shutterstock.com Stand: November 2021 ISSN 2363-829X
hintergrund // november 2021 Chemikalieneintrag in Gewässer vermindern – Trifluoracetat (TFA) als persistente und mobile Substanz mit vielen Quellen Quellen, Eintragspfade, U mweltkonzentrationen von TFA und regulatorische Ansätze
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Struktur des Hintergrundpapiers S. 7
Abbildung 2 Maximal mögliche TFA-Emission aus Pflanzenschutzmitteln in Deutschland, S. 12
differenziert nach den 28 Wirkstoffen, die theoretisch TFA bilden können
Abbildung 3 Anstieg der Emissionen von Kälte- und Treibmitteln (HFKW und ungesättigte HFKW) S. 16
wichtiger Branchen von 1990 bis 2019 in Deutschland in Tonnen
Abbildung 4 Abgeschätzte maximale TFA-Emissionen in t/a für die relevanten S. 18
Chemikalienbereiche
Abbildung 5 Die wichtigsten Quellen und Eintragspfade, die zu Belastungen von TFA S. 19
in Oberflächengewässer und dem Grundwasser führen
Abbildung 6 Vergleich abgeschätzter lokaler TFA-Einträge durch verschiedene S. 21
Pflanzenschutzmittel, Gülle, Klärschlamm und Niederschläge
Abbildung 7 Monatliche Trifluoracetat-Einträge über den Niederschlag von Februar 2018 (02/18) S. 22
bis Februar 2020 (02/2020) in Deutschland
Abbildung 8 Zusammenspiel von Quellen, Eintragspfaden und Belastungen S. 24
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Zusammenfassung der Toxizität von TFA S. 31
4Inhalt
Inhalt
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Motivation und Ziel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Stoffeigenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Quellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Eintragspfade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1 Punktueller Eintrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 Diffuser Eintrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Belastungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Meere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Fließgewässer, Seen und Ästuare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Grundwasser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4 Trinkwasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5 Boden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.6 Biosphäre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 Auswirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1 Menschliche Gesundheit und Ö kosysteme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2 Grenzen der Risikobetrachtung und der Umgang mit Unsicherheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.3 Wasserversorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6 Maßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.1 Gesetzliche Regulation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2 Politische Strategien und kooperative Ansätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.3 Lokale Kooperationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7 Ausblick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5Motivation und Ziel Motivation und Ziel Trifluoracetat (TFA) ist eine Chemikalie, die seit Minimierungsstrategie. Die diversen Quellen und Ein- einigen Jahren vermehrt in deutschen Gewässern tragspfade erfordern eine Querschnittsbetrachtung nachgewiesen wird. Sie wird aus vielen Stoffen gebil- und integrierte Zusammenarbeit, um TFA effektiv det, unterliegt aber selbst keinen Abbauprozessen. zu regulieren und die Einträge zu mindern. Dieses Die Vielzahl möglicher Vorläufersubstanzen ist eine Papier adressiert daher sowohl politische Akteure der Ursachen für den flächendeckenden Eintrag des wie die Bundesregierung als Gesetzgebungsinstanz, Stoffes in die Umwelt. TFA gelangt aufgrund seiner Regulierungsbehörden, Länder- und kommunale physikalisch-chemischen Eigenschaften – als sehr Behörden als auch Betroffene aus der Praxis wie Was- persistenter und sehr mobiler Stoff – leicht in den serversorger, die Landwirtschaft sowie Umwelt- und Wasserkreislauf, wo es sich mit der Zeit anreichert. Wasserverbände. Unser Ziel ist es, die unterschiedli- Praktikable und wirtschaftliche Möglichkeiten zur chen Stakeholder zu befähigen, eine koordinierte und nachträglichen Entfernung gibt es bisher nicht. effektive Minimierungsstrategie zu gestalten und um- Daher sollten die Einträge von TFA reduziert wer- zusetzen. Es dient darüber hinaus als Ausgangspunkt den. Das Ziel des Papiers ist es, eine Informations für die Entwicklung geeigneter Regulierungsoptionen sammlung zu TFA bereitzustellen, als Grundlage im Zuständigkeitsbereich des UBA. für die Entwicklung einer vorsorgeorientierten Zusammenfassung Trifluoracetat (TFA) ist ein für die Umwelt besorg- Eintragspfad werden die TFA-Vorläufersubstanzen in niserregender Stoff: Aufgrund seiner sehr hohen verschiedenen Umweltkompartimenten (Luft, Boden, Wasserlöslichkeit und Mobilität gelangt TFA leicht in Wasser) abgebaut. Bei den Eintragspfaden wird den Wasserkreislauf und verbreitet sich primär durch zwischen punktuellen, lokal begrenzten und diffu- diesen in der Umwelt. Weil TFA nicht abbaubar, d. h. sen, flächendeckenden TFA-Einträgen in die Umwelt sehr persistent, ist, verbleibt es nach seinem Eintrag unterschieden. Auf lokaler Ebene können die Ein- in der Umwelt. Deshalb können seine langfristigen tragspfade jeweils eine unterschiedliche Rolle für die Auswirkungen auf die Umwelt nicht vollständig TFA-Belastung spielen. Um die potenziellen Einträge vorhergesehen werden. Eine effektive, nachträgliche quantitativ abzuschätzen, wird in diesem Papier Entfernung von TFA aus Wasserkörpern ist besonders die deutschlandweit maximal mögliche Emission bei der Trinkwassergewinnung mit den etablierten von TFA anhand von Verkaufszahlen und anderer und flächendeckend eingesetzten Techniken nicht Daten zur Verwendung der jeweiligen Chemikalien realisierbar. TFA wird aus verschiedenen Quellen und berechnet. Für die Ermittlung der derzeitigen TFA- über unterschiedliche Wege in Gewässer eingetragen. Belastung von Oberflächengewässern, Grundwasser Das Wissen, woher TFA kommen kann und welche und Trinkwasser in Deutschland werden Monitoring Quellen zu erhöhten Konzentrationen führen, ist der- daten herangezogen. Anhand dieser Daten werden zeit noch begrenzt. Das vorliegende Hintergrundpapier die bisherigen und zu erwartenden Auswirkungen gibt einen Überblick zum derzeitigen Wissensstand, diskutiert. Zudem werden bestehende gesetzliche und insbesondere zu den Quellen, Eintragspfaden, Umwelt- untergesetzliche Regelungen, politische Strategien belastungen und Maßnahmen zu deren Verringerung. und lokale Minimierungsmaßnahmen dargestellt. TFA wird als Grundchemikalie für die Produktion Abbildung 1 illustriert die betrachteten Bereiche und fluorierter Stoffe verwendet. Darüber hinaus ist TFA die Struktur des Hintergrundpapiers. ein Abbauprodukt zahlreicher Fluorchemikalien, die in verschiedenen Bereichen Anwendung finden, wie halogenierte Kälte- und Treibmittel, Pflanzenschutz- mittel, Arzneimittel und Biozide. Abhängig vom 6
Zusammenfassung
Abbildung 1
Struktur des Hintergrundpapiers
STOFFEIGENSCHAFTEN
(Kapitel 1)
QUELLEN
(Kapitel 2)
EINTRAGSPFADE
(Kapitel 3)
BELASTUNGEN
(Kapitel 4)
AUSWIRKUNGEN
(Kapitel 5)
MASSNAHMEN AUSBLICK
(Kapitel 6) (Kapitel 7)
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt
Kernaussagen ▸ Die Verbreitung in der Umwelt erfolgt über die
▸ TFA ist sehr mobil und sehr persistent in der Um- Haupteintragspfade Niederschlag (u. a. aus dem
welt. Nach derzeitigem Wissensstand können erst atmosphärischen Abbau von Kälte- und Treib-
bei sehr hohen Konzentrationen toxikologische mitteln), Versickerung auf landwirtschaftlichen
und ökotoxikologische Effekte festgetsellt werden. Flächen (durch Pflanzenschutzmittel und Dünger),
Die langfristigen Auswirkungen von TFA in der industrielle Einleitungen (durch die Fluorchemi-
Umwelt sind jedoch sehr unsicher. kalien produzierende und anwendende Industrie)
und kommunale Kläranlagen (durch Arzneimittel,
▸ Basierend auf den Verkaufs- und Anwendungs- Biozide und andere fluorierte Chemikalien).
mengen sind die Hauptquellen für TFA in der
Umwelt in Deutschland Kälte- und Treibmittel ▸ TFA ist bisher noch nicht flächendeckend in den
sowie Pflanzenschutzmittel, beide mit steigender bundesweiten Monitoringprogrammen verankert.
Tendenz. Arzneimittel haben einen vergleichswei- In vielen Gewässern und Grundwasserkörpern
se geringen Anteil. Unbekannt ist der Anteil durch wurde es aber schon nachgewiesen. Die Konzen
Tierarzneimittel und industrielle Produktion. trationen schwanken zwischen < 0,1 bis > 10 µg/L,
Nicht im Detail bekannt, aber mutmaßlich gering an Punktquellen liegen sie noch deutlich darüber.
sind die Beiträge von Bioziden und fluorierten
Chemikalien für den Endverbraucher. Die TFA- ▸ Auch in anderen Umweltkompartimenten und
Einträge aus natürlichen Quellen wie Tiefsee- Produkten wurde TFA in signifikanten Mengen ge-
schloten sind sehr gering. funden: Feldfrüchte, Lebensmittel, Bier, Tee, Wild-
pflanzen, Böden. Ein Anstieg der Belastungen ist
zu erwarten, z. B. durch deutliche Aufwärtstrends
der Verwendung von TFA-bildenden Kältemitteln
und Pflanzenschutzmitteln.
7Zusammenfassung
▸ TFA ist nur mit sehr großem Aufwand aus dem ▸ Erste Schritte, die zur Verringerung der TFA-
Wasser zu entfernen. Für die Trinkwasserauf- Einträge in die Umwelt führen, sind bereits ein-
bereitung gibt es hierfür kein praktikables und geleitet. Die Bundesrepublik Deutschland erstellt
wirtschaftliches Verfahren. Daher führen die zusammen mit vier weiteren Staaten (Niederlande,
hohen Belastungen zu Konflikten zwischen Dänemark, Schweden, Norwegen) unter der Euro-
Trinkwassergewinnung, Landwirtschaft und päischen Chemikalienverordnung (REACH) einen
anderen Wirtschaftszweigen. Für die Reinigung Beschränkungsvorschlag für die Regulierung der
von industriellen Abwässern kann Umkehrosmose Herstellung und Anwendung der großen Gruppe
eingesetzt werden, um die TFA-Belastungen vor der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen
der Einleitung in die Umwelt auf ein Minimum zu (PFAS), unter deren Definition auch TFA fällt. Der-
reduzieren. Dies ist bisher kaum etabliert. zeit wird mit Blick auf die EU-Strategie zur nach-
haltigen Chemikaliennutzung geprüft, inwieweit
▸ Derzeit werden TFA und die Vielzahl potenziel- fluorierte Kältemittel und die Herstellung und An-
ler Vorläufer in kaum einem Bereich reguliert, wendung von TFA-bildenden Pflanzenschutz- und
und dort, wo reguliert wird, geschieht dies nicht Arzneimitteln sowie Bioziden über die REACH-
konsistent. Im Sinne des nachhaltigen Gewässer- Beschränkung adressiert werden kann.
und Trinkwasserschutzes ist eine Regulierung von
TFA-Einträgen notwendig. Dazu können aufgrund
der unterschiedlichsten Quellen sowohl sektor-
bzw. anwendungsspezifische Ansätze (Stoffrecht)
als auch medienbezogene Regelungen (Wasser-
recht) greifen. Das UBA prüft derzeit in einem Gut-
achten die Möglichkeiten einer Regulierung der
verschiedenen Eintragsquellen mit den Regulie-
rungsinstrumenten im Zuständigkeitsbereich des
Umweltbundesamtes (UBA). Das Problem vollstän-
dig an das Ende der Eintragskette (v. a. Wasser-
versorger) zu verschieben, ist schon aufgrund der
Stoffeigenschaften von TFA nicht zielführend.
8Stoffeigenschaften
1 Stoffeigenschaften
TFA steht für Trifluoressigsäure (CF3-COOH; EC-Nr. Durch die starke Kohlenstoff-Fluor-Bindung und die
200-929-3; CAS-Nr. 76-05-1) sowie für dessen Anion schlechte Oxidierbarkeit ist TFA sehr stabil. Selbst
Trifluoracetat (CF3-COO-). Durch Abbauprozesse wird Mikroorganismen, die mithilfe des Enzymes Fluoro
TFA aus einer Vielzahl fluorierter Stoffe gebildet, die acetatdehalogenase Kohlenstoff-Fluor-Bindungen
eine oder mehrere Trifluormethylgruppen (C-CF3) aufbrechen können, gelingt dies nur bei einfach
enthalten. Im umweltrelevanten pH-Bereich liegt fluorierten Verbindungen wie Monofluoracetat. Zwei-
das Molekül als Trifluoracetat vor. Da TFA sehr gut fach- und dreifachfluoriertes Acetat hingegen kann
wasserlöslich ist, schlecht adsorbiert und daher sehr aufgrund seiner hohen relativen Stabilität durch die-
mobil ist, wird es sehr schnell aus der Atmosphäre, ses Enzym nicht abgebaut werden (Boutonnet et al.,
den Böden und über Abwässer in den natürlichen 1999). Daher sind bisher keine Umweltverhältnisse
Wasserkreislauf eingetragen und verbreitet sich da bekannt, unter denen TFA abgebaut wird. TFA gehört
rüber in der Umwelt. TFA ist daher auch in Gewässern damit zu den sehr persistenten Stoffen.1
nachzuweisen, die weiter von den Eintragsquellen
entfernt liegen.
1 Gemäß der Kriterien des Anhangs XIII der Chemikalienverordnung REACH ist TFA eindeutig als persistenter Stoff zu klassifizieren, da in standardisierten Tests in verschiedenen Böden
und Sedimenten kein Abbau festzustellen war. Allerdings gibt es Hinweise auf ein gewisses Abbaupotenzial durch bestimmte Mikroorganismen unter speziellen Laborbedingungen.
In einer Studie von Visscher et al. (1994) zeigte sich ein mikrobieller Abbau von TFA sowohl unter aeroben als auch anaeroben Bedingungen im Sediment. Unter aeroben Bedingungen
wurde beim Abbau von TFA die Bildung des potenten Treibhausgases Fluoroform (CHF3) beobachtet (Visscher et al., 1994; Castro et al., 2014). Diese Studien wurden jedoch unter
spezifischen Laborbedingungen durchgeführt und konnten bisher nicht reproduziert werden. Sie bilden somit lediglich Hinweise, dass eine Transformation von TFA unter bestimmten
Bedingungen möglich sein könnte. Unter Umweltbedingungen wurde dies bisher nicht beobachtet.
9Quellen
2 Quellen
Im Folgenden werden die Quellen, die TFA-Einträge in nationaler Ebene möglich (bspw. beim Eintrag von
den Wasserkreislauf verursachen können, näher be- TFA durch hydrothermale Schlote), sodass dort auf
schrieben. Basierend auf diesen Quellen wird – soweit eine globale Abschätzung zurückgegriffen wird.
ausreichend Daten vorhanden – eine Abschätzung
vorgenommen, welche TFA-Emission deutschlandweit TFA als Grundchemikalie
maximal von welcher Quelle ausgehen kann. Jede Chemikalie, die in der EU von Einzelunterneh-
men in Mengen > 1 t/a hergestellt oder importiert
Neben der Emission als Grundchemikalie kann TFA wird, muss grundsätzlich gemäß Verordnung (EG)
aus allen Chemikalien gebildet werden, deren Mole- 1907/2006 (REACH-Verordnung) registriert werden.
külstruktur eine C-CF3-Gruppe beinhaltet. Aus volati- Erst nach erfolgter Registrierung kann der Stoff EU-
len Vorläufersubstanzen kann TFA in der Atmosphäre weit vermarktet werden. Dafür liefern die registrie
mittels photochemischer Oxidation entstehen. In renden Unternehmen – neben S toffeigenschaften –
Boden, Wasser und Sedimenten können Chemikalien eine allgemeine Beschreibung der geplanten
biologisch und photolytisch zu TFA abgebaut werden Verwendungen des Stoffes und die verwendete Stoff-
(Solomon et al., 2016; Sun et al., 2020). Derzeit sind menge pro Jahr (firmeneigene Berechnungsgrund
knapp 2.000 potenzielle Vorläufersubstanzen be- lage). Gemäß den Angaben im öffentlich zugängli-
kannt. Besonders relevant sind hierbei Chemikalien, chen Bereich der ECHA-Registrierungsdatenbank ist
die bei ihrer Anwendung in signifikanten Mengen TFA als Stoff in der EU unter REACH mit einer Stoff-
in die Umwelt freigesetzt werden und dort Abbau- menge von 100–1.000 t/a registriert (ECHA, 2020a).
prozessen unterliegen. Dazu gehören insbesondere Zudem bestehen noch Registrierungen als isoliertes
Pflanzenschutzmittel, Kälte- und Treibmittel, Biozide Zwischenprodukt für die Chemikaliensynthese ohne
sowie Tier- und Humanarzneimittel. Nach derzeitigem weitere Tonnagenangabe. Bei dieser spezifischen Art
Wissensstand tragen diese Stoffgruppen mit insge- der Registrierung bestehen verringerte Anforderun-
samt ca. 150 TFA-bildenden Chemikalien besonders gen an die übermittelten Daten zu Stoffeigenschaften.
zur TFA-Belastung in der Umwelt bei, da von ihnen Gleichzeitig bestehen für die Inanspruchnahme
und ihren Anwendungen eine hohe Umweltexposi dieses Registrierungsprivilegs spezifische Anforde
tion ausgeht (siehe auch Kapitel 3). rungen an die Geschlossenheit der technischen
Einrichtungen und die Minimierung von potenziell
Über den Eintrag von TFA aus der Verwendung als auftretenden Emissionen.
Grundchemikalie, über die real gebildeten TFA-
Mengen aus verschiedenen Chemikalien und über TFA wird vor allem in Syntheseprozessen als Aus-
den Beitrag einzelner Quellen zu den in der Umwelt gangsstoff bzw. als Lösemittel eingesetzt. Weitere An-
nachgewiesenen Konzentrationen gibt es bisher kei- wendungsbereiche sind die Oberflächenbehandlung
nen umfassenden Überblick. Empirische Daten zum von Glas im industriellen Maßstab sowie der Einsatz
TFA-Bildungspotenzial gibt es für einzelne Pflanzen- als Laborchemikalie (ECHA, 2021). Spezifische An-
schutzmittel und für den atmosphärischen Abbau gaben zu Herstellungs- und Anwendungsmengen für
einiger Kältemittel. Deutschland sind vor dem Hintergrund der EU-weiten
Gültigkeit der Stoffregistrierung nicht möglich. Da
Im Folgenden wird die jährliche Menge von TFA, TFA als Grundchemikalie nicht im Freiland verwen-
die aus verschiedenen Quellen in Deutschland in die det wird, dürften sich dessen Emissionen auf Abwäs-
Umwelt gelangt, anhand der Absatz- bzw. Einsatz- ser aus industriellen Anwendungen beschränken.
mengen berechnet. Diese Berechnung basiert auf der Diese (potenzielle) Emissionsmenge kann derzeit
konservativen Annahme, dass die Vorläufersubstanz nicht deutschlandweit quantifiziert werden, kann je-
die potenzielle TFA-Menge vollständig (wenn nicht doch lokal eine große Rolle spielen (siehe Kapitel 3.1).
anders angegeben) und schnell (innerhalb eines
Jahres) freisetzt. Dies wird für verschiedene Chemi-
kaliengruppen durchgeführt. An manchen Stellen
ist dabei die Abschätzung der TFA-Mengen nicht auf
10Quellen
Biozide der C-CF3-Gruppe, allerdings konnte auch hier TFA
Insgesamt sind sechs Biozid-Wirkstoffe, die eine mangels einer eigenen radioaktiven Markierung des
C-CF3-Gruppe enthalten, auf EU-Ebene genehmigt: C-Atoms analytisch nicht als Abbauprodukt (Metabo-
Chlorfenapyr, Tralopyril, Bifenthrin, Lambda- lit) nachgewiesen werden. Da Metaboliten nur unter
Cyhalothrin, Flocoumafen und Fipronil. In Deutsch- bestimmten Rahmenbedingungen mit in die Umwelt-
land wiederum dürfen nur Biozidprodukte mit diesen risikobewertung einbezogen werden (bspw. Nachweis
auf EU-Ebene genehmigten Wirkstoffen in Verkehr des Metaboliten von > 10 % des Wirkstoffs zu einem
gebracht werden. Derzeit sind keine Biozidprodukte beliebigen Messzeitpunkt im Studienverlauf; Hinweis
mit den bereits genehmigten Wirkstoffen Chlorfenapyr auf die (öko-)toxikologische Relevanz eines nachge-
(nur für Produkttyp (PT) 8: Holzschutzmittel; in PT 18: wiesenen Metaboliten), wurde TFA bisher nicht in der
Insektizide ist der Wirkstoff zwar ebenfalls notifiziert, Umweltexpositions- und Umweltrisikobewertung von
die Wirkstoffgenehmigung steht jedoch noch aus) Bioziden und deren Metaboliten mit berücksichtigt.
und Tralopyril (PT 21: Antifouling-Beschichtungen)
in Deutschland zugelassen (ECHA, 2020). Zudem Die Absatzmengen von Biozidprodukten und -wirkstof-
ist inzwischen die Zulassung für das bisher einzige fen werden in Deutschland bisher nicht zentral erfasst.
Bifenthrin-haltige Produkt (PT 8) in Deutschland (und Deshalb kann bisher keine Abschätzung des theore
anderen EU-Mitgliedsstaaten) ausgelaufen. Die ver- tischen maximalen TFA-Emissionspotenzials erfolgen.
bleibenden drei genehmigten Biozidwirkstoffe sind in
Deutschland in insgesamt 12 zugelassenen Produkten Pflanzenschutzmittel
enthalten. Diese zwölf Produkte mit den Wirkstoffen Derzeit sind 45 Wirkstoffe, die eine C-CF3-Gruppe
Lambda-Cyhalothrin (PT 18: Insektizide), Fipronil enthalten, zur Anwendung als Pflanzenschutzmittel
(ebenfalls PT 18) und Flocoumafen (PT 14: Rodentizi- in der EU genehmigt. 26 davon werden in Pflanzen-
de) werden im Innen- und Außenbereich eingesetzt, schutzmitteln, die in Deutschland zugelassen sind,
weshalb eine Freisetzung in die Umwelt erfolgen kann. verwendet. Für die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe
Flurtamone und Flufenacet wurden Abbaustudien im
Neben den über das EU-Prüfverfahren zugelassenen Rahmen der Genehmigungsverfahren vorgelegt, wel-
Produkten gibt es laut Melderegister der Bundesan- che die Bildung von TFA anzeigen. Zudem wurde für
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 41 weitere Wirkstoffe TFA in verschiedenen Feldstudien
weitere Produkte, die einen der sechs im Rahmen der nachgewiesen – ohne jedoch den genauen Abbauweg
Biozidverordnung relevanten Wirkstoffe enthalten, die zu kennen (EFSA, 2014; EFSA, 2017; EFSA, 2017a).
sich jedoch in einer Übergangsregelung bis 2024 be- Bei der Ozonung – einem Prozess, der bei der Abwas-
finden (BAuA, 2020). Für diese Produkte wurde bisher serbehandlung und Trinkwasseraufbereitung zum
keine Umweltexpositionsbewertung vorgenommen. Einsatz kommt – konnte eine Bildung von TFA aus
den Wirkstoffen Tembotrione, Flufenacet, Flurtamone
Für einen weiteren ursprünglich notifizierten Wirk- und Fluopyram beobachtet werden. Jedoch war die
stoff ist die Genehmigung bereits 2017 ausgelaufen quantitative Ableitung der Bildungsrate nicht möglich
(Flufenoxuron, PT 8) und bisher wurde keine Verlän- (Scheurer et al., 2017).
gerung für diesen Wirkstoff beantragt. Mit Ausnahme
von drei Produkten, deren Verkehrsfähigkeit 2024 Jedes dieser Mittel ist primär für die Verwendung auf
endet, befinden sich laut BAuA-Melderegister auch Ackerflächen vorgesehen, sodass von einer grund-
keine Produkte mehr mit diesem Wirkstoff auf dem sätzlich hohen Umweltexposition ausgegangen
deutschen Markt. Für diese Produkte wurde ebenfalls werden kann. Der Fokus dieses Kapitels gilt den 26
keine Umweltexpositionsbewertung vorgenommen. Wirkstoffen, für die es in Deutschland zugelassene
Pflanzenschutzmittel gibt. Zusätzlich werden Flurta-
Durch die der Produktzulassung vorangehenden mone und Flutolanil, obwohl diese Wirkstoffe in der
Wirkstoffgenehmigung liegen Abbaudaten für die EU keine Genehmigung mehr haben, aufgrund ihrer
einzelnen Wirkstoffe vor. In den eingereichten hoher Anwendungsmengen in den letzten Jahren in
Simulationsstudien konnten aufgrund der komple- die Analyse einbezogen und somit 28 Wirkstoffe be-
xen Struktur der Ausgangssubstanzen höchstens trachtet (Abbildung 2). Die Anwendungsmengen die-
potenzielle TFA-Vorläufersubstanzen identifiziert ser Wirkstoffe reichen von 0,8 bis 629 t/a (BVL, 2019:
werden. In einem Fall kam es zu einer Abspaltung Durchschnittswerte 2016–2018). Über die letzten 10
11Quellen
Jahre sind keine klaren Trends bei den Absatzzahlen Flufenacet ist somit der bedeutendste Pflanzenschutz-
erkennbar – sie stagnieren oder schwanken um einen mittelwirkstoff – bezogen auf die deutschlandweite
konstanten Mittelwert. Die Ausnahme bildet der Emission von TFA. Zudem ist Flufenacet einer der
Wirkstoff Flufenacet, der die mit Abstand höchsten wenigen Stoffe, für den eine TFA-Bildung nicht nur
Absatztonnagen aufweist. Sowohl die Absatzmengen theoretisch angenommen, sondern durch Labor
als auch die Zahl der Pflanzenschutzmittelanträge studien belegt wurde. Die Regulierung von Flufenacet
mit diesem Wirkstoff steigen in Deutschland seit ei- ist somit ein sehr wichtiger Hebel, um TFA-Emissionen
nigen Jahren stetig. Allein im Zeitraum von 2008 bis in die Umwelt zu managen (siehe Infokasten 6).
2018 erhöhten sich die Absatzmengen um ca. 80 %
(BVL, 2019). Derzeit sind 31 Pflanzenschutzmittel Tierarzneimittel
mit diesem Wirkstoff zugelassen und einige weitere Insgesamt acht Wirkstoffe für Tierarzneimittel enthal-
beantragt (BVL, 2021; Stand Juli 2021). ten eine C-CF3-Gruppe, von denen sieben in Deutsch-
land zugelassen sind. Im Einzelnen sind dies das
Ausgehend von den Absatzzahlen und unter Einbezug Analgetikum Flunixin und dessen Megluminsalz, das
aller 28 Wirkstoffe können in Deutschland pro Jahr Inhalationsanästhetikum Isofluran sowie die Anti-
maximal 504 t TFA über Pflanzenschutzmittelan- parasitika Fipronil, Pyriprole, Metaflumizone (nicht
wendungen emittiert werden (ohne Flurtamone und mehr zugelassen), Fluralaner und Esafoxolaner.
Flutolanil max. 457 t/a TFA). Die drei Wirkstoffe, die Aufgrund des hohen Dampfdruckes und der Art der
im Hinblick auf TFA die wichtigsten Quellen sind, Anwendung wird Isofluran hauptsächlich über den
können dabei jeweils maximal 197 t (Flufenacet), 84 t Luftpfad in die Atmosphäre eingetragen (siehe auch
(Diflufenican) und 78 t (Fluazinam) TFA emittieren. Humanarzneimittel). Alle fünf Antiparasitika werden
Abbildung 2
Maximal mögliche TFA-Emission aus Pflanzenschutzmitteln in Deutschland,
differenziert nach den 28 W
irkstoffen, die theoretisch TFA bilden können
Als Basis dient die Absatzmenge der jeweiligen Wirkstoffe als Mittelwert der drei Jahre 2016, 2017 und 2018.
200 197,5
max. deutschlandweite TFA-Emission [t/a]
180
160
140
120
100
83,7
78,0
80
60
40,0
40
28,0
20
6,9 6,8 6,9 2,1 6,4 8,8 5,8 10,7
3,3 2,2 0,2 4,2 0,1 2,3 0,2 0,0 0,7 1,1 1,1 2,4 0,0 3,2 0,8
0
o le
zi d
fe id
as an
id
os en
Tr Tri bot n
e
bd lox rin
*
ic n
n
ua P
Su xs n
*
Fl inam
lo mm -Flu il **
m
m
e
m
t
xs *
su yl
at oxa rin
n- bin
pi et
ha -R)
yh na
Te **
us lox ion
no **
m hri
i
Fl furo
ro
Fl op-
Fl olid
o
ut ne
pi luto
ito th
Fl am
flu m
Di nam
ur yra
a
Pi ula
c
Pr inaf
c
Py lfur
h
Ox Is oth
p
lfo ul
Fl ena
lfu
fo a-C vali
fu tro
i
r
Cy uta
Pe lin
Tr me
n
Te lut
la (Ha lot
o
Fl fen
a- yfo
r
flo
f
z
p
c
a
ul
m
f
u
l
ul ys
l
uo
l
on
f
a
uf
co
b
ua
o
xa
ta
o
flu
pr
uo
flu
r
ro
Cy
az
Fl
u
Be
Fl
f
ha
t a
P
p-
m
Ha ga
ifl
xy
maximale deutschlandweite TFA-Emission, berechnet aus: Absatzmengen in Deutschland [t/a] – Mittelwert 2016–2018
* keine Genehmigung auf EU-Ebene (Aufbrauchfrist 2020) Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt (Daten aus BVL, 2019 und BVL, 2021)
** derzeit keine Produktzulassungen in Deutschland (Knollenbehandlung vor Saat)
*** Produkte mit dem Wirkstoff zugelassen, aber kein Absatz
12Quellen
für Haustiere (u. a. Hund, Katze) eingesetzt, womit auszugehen ist. Durch Einführung einer oxidativen
ein diffuser Eintrag v. a. über Oberflächenabflüsse zu vierten Reinigungsstufe kann sich die Freisetzung
erwarten ist. Fluralaner ist auch für die Behandlung von TFA aus Humanarzneimitteln jedoch in Richtung
von Hühnern zugelassen, wodurch ein Eintrag nach Kläranlagenabfluss verschieben. So konnte – wie
Dungapplikation (Gülle) auf Felder erfolgen kann. weiter oben bereits erwähnt – gezeigt werden, dass
Flunixin, bzw. dessen Megluminsalz, ist für den sich aus Wirkstoffen mit C-CF3 Gruppe nach Ozonung
Einsatz bei Pferden, Schweinen und Rindern zugelas- TFA bilden kann (Scheurer et al., 2017).
sen, somit erfolgt der Eintrag direkt auf Weiden und
indirekt nach Dungapplikation auf Felder. Von den sich maximal bildenden TFA-Mengen gehen
ca. 23 % auf die halogenierten Inhalationsanästhe-
Da in Deutschland nur der Verbrauch von Antibiotika tika (Narkosegase) Isofluran, Sevofluran und Desflu-
systematisch erfasst wird, die genannten Wirkstoffe ran zurück. Ihr Haupteintragspfad verläuft über die
jedoch nicht dieser Klasse angehören, ist eine Abschät- Abluft in die Atmosphäre, wo TFA aus den Narkose-
zung des potenziellen TFA-Eintrags in die Umwelt gasen über verschiedene Abbauprozesse gebildet und
durch Tierarzneimittel zur Zeit nicht möglich. Aller- mit dem Niederschlag in die Gewässer transportiert
dings ist davon auszugehen, dass der Verbrauch des wird. In Deutschland werden jährlich insgesamt
Narkosegases Isofluran als Tierarzneimittelwirkstoff ca. 180 t dieser Gase eingesetzt, von denen 176 t in
seit Januar 2021 stark ansteigt. Ab diesem Zeitpunkt die Atmosphäre gelangen (Durchschnitt 2011 bis
ist eine betäubungslose Kastration von männlichen 2018; ZSE, 2020). Unter Berücksichtigung der TFA-
Ferkeln zur Vermeidung des Ebergeruches verbo- Bildungsraten – Isofluran 95 %, Sevofluran 7 % und
ten, weshalb vermehrt Betäubungsmittel gebraucht Desfluran 3 % – entstehen daraus maximal ca. 7 t/a
werden. Es gibt Förderprogramme für Schweinezüch- TFA (Behringer et al., 2021). Alle drei Narkosegase
ter zur Anschaffung von Kastrationsgeräten, die mit haben relativ lange Verweilzeiten in der Atmosphäre:
Isofluran arbeiten (BLE, o.J.). Hierdurch ist mit einer Isofluran 3,2 Jahre, Sevofluran 14 Jahre und Desflu-
maximalen zusätzlichen TFA-Emission von 2,5 t/a zu ran 1,4 Jahre (Vollmer et al., 2015). Dadurch verteilen
rechnen (BT-Drs. 19/9723). Bei den anderen Wirkstof- sich die Narkosegase global, sodass eine genaue
fen ist mit konstanten Verbräuchen zu rechnen. Quantifizierung der spezifischen TFA-Einträge aus
Narkosegasen in Deutschland äußerst schwierig und
Humanarzneimittel unzuverlässig ist.
Eine Recherche in der DrugBank (Version 5.1.1)
ergab, dass 51 Humanarzneimittelwirkstoffe C-CF3 Weitere ca. 73 % des TFAs gehen auf sechs Wirk-
Gruppen enthalten, von denen 39 in Deutschland zu- stoffe zurück: das Diabetesmedikament Sitagliptin,
gelassen sind. Ein Abgleich mit den Verbrauchsmen- das Schmerzmittel Celecoxib, das Herzmedikament
gen aus 2020 ergibt, dass diese maximal ca. 29 t/a Flecainid, das Antidepressivum Fluoxetin, das Krebs-
TFA freisetzen könnten (Daten des Unternehmens medikament Bicalutamide und das HIV-Medikament
IQVIA2, nicht veröffentlicht). Hierbei wird eine unre- Efavirenz. Die verbleibenden Arzneimittelwirkstoffe
alistisch hohe Bildungsrate von 100 % für die über tragen jeweils zu weniger als 0,5 % und in der Summe
Kläranlagen eingeleiteten Wirkstoffe angenommen. zu gut vier Prozent bei. Humanarzneimittel und ihre
Es gibt zwar Hinweise darauf, dass sich TFA zu gerin- Abbauprodukte gelangen über Toiletten in Kläranla-
gen Anteilen aus Humanarzneimittel in Kläranlagen gen und über deren Abfluss in Oberflächengewässer –
bilden kann (Scheurer et al., 2017), es ist aber davon wo sie tendenziell eher langsam abgebaut werden.
auszugehen, dass der Großteil der Humanarzneimit- Über den Klärschlamm können sie in begrenztem
tel unverändert in die Oberflächengewässer einge- Umfang als Düngemittel über landwirtschaftliche
tragen wird. Die Wirkstoffe werden in Oberflächen- Flächen ausgetragen werden (siehe Kapitel 3.2).
gewässern nur langsam abgebaut, weshalb von einer
stark verzögerten und eher geringen TFA-Freisetzung
2 Um die Daten öffentlich nutzen zu können, bittet IQVIA um die Veröffentlichung des folgenden vorformulierten Textes. Dieser muss nicht unbedingt die Meinung des UBA wider-
spiegeln: „IQVIA MIDAS-Daten kombinieren Daten auf Länderebene, Fachwissen im Gesundheitswesen und therapeutisches Wissen in mehr als 90 Ländern, um Daten in globalen
standardisierten Formen zu liefern, die länderübergreifende Analysen erleichtern und eine führende Quelle für Einblicke in die internationale Marktdynamik in Bezug auf den Vertrieb
und die Verwendung von Medikamenten darstellen. IQVIA MIDAS-Daten sind so konzipiert, dass sie länderübergreifende Analysen von Trends, Mustern und ähnlichen Arten von Analy-
sen unterstützen. Alle Berechnungen, Algorithmen und Methoden, die zur Erstellung dieser Schätzungen der realen Aktivität verwendet werden, machen die Daten für diese Zwecke
äußerst zuverlässig.“
13Quellen
Der Arzneimittelverbrauch ist aufgrund der demo- HFKW-134a, insbesondere in Pkw-Klimaanlagen und
grafischen Entwicklung tendenziell steigend. Dies ferner in Kältemittelmischungen. Relativ neu ist auch
betrifft im Besonderen Diabetes-, Krebs- und Herz das fluorierte Gas HFKW-1234ze(E) (1,3,3,3-Tetra
medikamente. Des Weiteren gibt es eine Tendenz fluorpropen, CF3CH=CHF), das zunehmend als Kälte-
zum Einsatz von Halogenen in der Medikamente- mittel sowie als Treibmittel für XPS-Dämmstoffe und
nentwicklung. So kann durch geschickte Substitution Treibgas für Aerosole eingesetzt wird.
mit Halogenen beispielsweise die Pharmakokinetik
(Aufnahme) und der Metabolismus eines Wirkstoffes Die atmosphärischen Lebensdauern fluorierter Gase
im Körper vorteilhaft beeinflusst werden (Wei Zhu können wenige Tage bei den ungesättigten HFKW
et al., 2014). Von daher ist davon auszugehen, dass (wie R1234ze(E) und R1234yf) bis hin zu mehreren
zukünftig weitere Medikamente, aus denen sich TFA tausend Jahren bei den perfluorierten Gasen betra-
bilden kann, auf den Markt kommen werden. Zusam- gen. Die TFA-Bildungsraten sind ebenfalls unter-
menfassend zeigen jedoch die geringen Einträge der schiedlich hoch. So ist HFKW-134a in der Atmosphä-
Wirkstoffe und die langsame Bildung von TFA aus re sehr stabil und wird nur sehr langsam über viele
Humanarzneimitteln, dass diese eine eher vernach- Jahre zu etwa 7 bis 20 % in TFA umgesetzt, während
lässigbare Quelle darstellen. HFKW-1234yf innerhalb weniger Tage zu über 99 %
zu TFA abgebaut wird.
Halogenierte Kälte- und Treibmittel
Ein bedeutender Einsatzbereich halogenierter Gase In einer Studie von Behringer et al. (2021) wurde
ist die Verwendung als Kältemittel in stationären und für Deutschland in einem Maximalszenario ein TFA-
mobilen Kälte- und Klimaanlagen, sowie als Treibgas Bildungspotenzial aus den projizierten Kälte- und
zum Schäumen von Kunststoffen und in Aerosol Treibmittelemissionen von ca. 2.300 t für das Jahr
dosen. Halogenierte Gase werden heute noch in ho- 2020 berechnet, das sich bis zum Jahr 2050 – ab-
hen Tonnagen verwendet: Laut Behringer et al. (2021) hängig von der weiteren Kältemittelwahl – noch
waren es im Jahr 2018 fast 8.000 t in Deutschland. verdreifachen könnte. Hauptursache der Erhöhung
der zukünftigen TFA-Mengen ist der Umstieg von
Bei Produktion, Anwendung und Entsorgung emit- HFKW-134a auf HFKW-1234yf.
tieren diese Gase in unterschiedlichem Maße. Daten
zu den in Deutschland verwendeten Mengen und Da die emittierten Gase in der Atmosphäre schnell
Emissionen von halogenierten Kälte- und Treibmit- weiträumig bis über die Meere verteilt werden, wird
teln liefern die nationalen Datenerhebungen nach der in Deutschland nur ein Anteil ihrer Abbauprodukte
Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Einen Überblick (wie TFA) eingetragen. Neben der atmosphärischen
über die Emissionen gibt Abbildung 3. Aus einigen Lebensdauer der Gase beeinflussen weitere Faktoren
dieser halogenierten Gase wird beim atmosphäri- wie Jahreszeit, Luftmassenströmungen, geografi-
schen Abbau TFA gebildet, das aufgrund seiner sehr sche Lage und Niederschlagsmenge den örtlichen
guten Wasserlöslichkeit mit den Niederschlägen in TFA-Eintrag. Bilanzierungen von Einträgen dieser
Böden und Gewässer gelangt. Gase werden daher zutreffender durch globale oder
europaweite Modelle abgebildet.
Im Jahr 2018 betrug die Verwendungsmenge an
Kälte- und Treibmitteln, die ein TFA-Bildungspo- Auf der Basis von Modellierungen, die reale Atmo-
tenzial haben, etwa 5.800 t (ZSE, 2020). Das derzeit sphärenkonzentrationen von Kälte- und Treibmitteln
häufigste Kältemittel, besonders für stationäre und verwendeten, schätzt Behringer et al. (2021), dass
mobile Kälte- und Klimaanlagen, ist HFKW-134a im Jahr 2018 etwa 50 % des niederschlagsbedingten
(1,1,1,2-Tetrafluorethan, CH2FCF3). Auch weitere TFA-Eintrags auf bekannte Kälte- und Treibmittel,
Gase wie HFKW-143a (1,1,1-Trifluorethan, C2H3F3) insbesondere HFKW134a, zurückgehen. Durch
und HFKW227ea (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, europäische Verbote und Einschränkungen halo-
C3HF7), die häufig Bestandteil von Kältemittelgemi- genierter Gase mit hohem Treibhauspotenzial wer-
schen sind, bilden TFA, wobei HFKW-227ea auch ein den viele langlebige fluorierte Gase langsam durch
Schaumtreibmittel und Treibgas ist. Seit dem Jahr Stoffe abgelöst, die nur eine geringe atmosphärische
2013 wird vermehrt HFKW-1234yf (2,2,2,3-Tetrafluor Lebensdauer haben. Bei vermehrtem Einsatz von
propen, CF3CF=CH2) verwendet, oftmals als Ersatz für HFKW-1234yf wird sich der absolute TFA-Eintrag
14Quellen
und voraussichtlich auch sein Anteil am Gesamtein- verwendeten Begriff per- und polyfluorierten Chemi-
trag bis 2050 weiter erhöhen. Ausführlichere Infor- kalien (PFC), umfasst mehr als 4.700 verschiedene
mationen zu den Messungen und Modellierungen Stoffe. Rund 2.000 dieser Stoffe haben das Potenzial,
zum Eintrag von TFA und Kälte- und Treibmitteln für TFA zu bilden. Eine Vielzahl dieser potenziellen
Deutschland und Europa finden sich in den Arbeiten TFA-Vorläufersubstanzen wird in Produkten für den
von Freeling et al. (2020) und Behringer et al. (2021). Endverbraucher eingesetzt. Aufgrund ihrer großen
Die Entwicklung des Einsatzes und der Umweltver- Stabilität und ihrer wasser-, öl- und schmutzabwei-
träglichkeit halogenierter Kältemittel wird in Info senden Eigenschaften finden sie sich in Lebensmittel-
kasten 1 zusammengefasst. kontaktmaterialien (z. B. Pappbechern, Pizzakartons,
Backpapier, antihaftbeschichteten Pfannen), Outdoor-
Fluorchemikalien in Produkten in Haushalten, und Arbeitskleidung, Teppichen und Löschmitteln.
Gewerbe und unterwegs Durch die Nutzung von Verbraucherprodukten, etwa
Die Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsub durch Waschen, können PFAS ins Abwasser und über
stanzen (PFAS), auch bekannt unter dem synonym die Kläranlagen später in die Umwelt gelangen (Lenka
INFOKASTEN 1: Umweltverträglichkeit halogenierter Kältemittel
Die Umweltverträglichkeit halogenierter Kälte- und das sichere natürliche Kältemittel Kohlendioxid im Jahr
Treibmittel steht seit den 1980er Jahren in Frage. In 2010 abrupt abgebrochen. Durch den HFKW-1234yf
Kühlschränken, Spraydosen und einigen Kunststoff- vervielfachen sich nun im Vergleich zum HFKW-134a die
schäumen sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), TFA-Einträge aus Kältemittelemissionen.
die die Ozonschicht schädigen, mittlerweile weltweit
durch halogenfreie Kohlenwasserstoffe ersetzt worden Dass Kohlendioxid-Klimaanlagen machbar sind, zeig-
(UBA, 2017). Bei anderen Anwendungen wurden für ten einige Pkw-Modelle aus Deutschland, die seit dem
FCKW vor allem teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) Jahr 2016 auf den Markt kamen. Sie waren entwickelt
eingeführt (Abbildung 3). Da diese klimaschädlich worden, weil es im Jahr 2012 bei Versuchen an einigen
sind, werden sie seit den 2010er Jahren oftmals durch Pkw-Klimaanlagen mit HFKW 1234yf zu Sicherheits-
ungesättigte HFKW mit geringerer Klimawirkung ersetzt, bedenken gekommen war (NTV, 2013). Erste Elektro-
die jedoch in der Atmosphäre in noch größerem Maße zu auto-Modelle werden seit dem Jahr 2020 optional mit
halogenierten Stoffen wie TFA abgebaut werden. Dabei Kohlendioxid-Klimaanlage mit Wärmepumpenfunk
gibt es bereits heute mit Stoffen wie Kohlendioxid, Am- tion zum Heizen angeboten (VW, 2020). TFA-Einträge
moniak und Kohlenwasserstoffen natürliche, halogen- können reduziert werden, wenn Hersteller von Pkw mit
freie Alternativen für die meisten Anwendungsfälle, wie neuen Antriebsformen bei der Klimatisierung mittel
Supermarkt- und Industriekälteanlagen, Klimaanlagen fristig auf natürliche Lösungen zur Kühlung setzen und
und Wärmepumpen (UBA, o.J.; Eckert, 2019). Förder für Batterie-Kühlsysteme keine halogenierten Flüssig-
programme wie die Kälte-Klima-Richtlinie unterstützen keiten verwenden.
die Umstellung (BAFA, 2020).
Für Elektrobusse gibt es schon Klimasysteme mit
Als Ersatz für den sehr klimaschädlichen HFKW-134a bei Kohlendioxid mit effizienten Wärmepumpen, die eine
Pkw-Klimaanlagen hatte die europäische Pkw-Industrie Dieselzuheizung im Winter ersetzen (Konvekta, 2020).
seit den späten 1990er Jahren innovative Anlagen zum Einige Züge werden zum Beispiel mit luftgestützten
Einsatz des unbrennbaren Kältemittels Kohlendioxid Anlagen sogar ganz ohne gesonderte Kältemittel gekühlt
entwickelt. Seit etwa 2006 wurden die Untersuchungen (UBA, 2019). Auch Klimaanlagen mit Kohlendioxid oder
für die Serieneinführung begonnen. Da sich die interna- Kohlenwasserstoffen werden für Züge getestet. Wei-
tionalen Pkw-Hersteller aber schließlich auf das brenn- tergehende Informationen zur mobilen Klimatisierung
bare und teurere halogenierte Kältemittel HFKW-1234yf mit dem Schwerpunkt Kältemittel finden sich auf der
einigten, wurde auch in Deutschland der Umstieg auf Webseite des UBA (UBA, o.J.a).
15Quellen
Abbildung 3
Anstieg der Emissionen von Kälte- und Treibmitteln (HFKW und ungesättigte HFKW)
wichtiger Branchen von 1990 bis 2019 in Deutschland in Tonnen
7000
6000
5000
Emissionen [t]
4000
3000
2000
1000
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Jahr
Aerosole Schäume Haushaltskälte Transportkälte Industriekälte
Stationäre Klimatisierung Gewerbekälte Mobile Klimatisierung
Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt,
(Daten aus: Emissionsdatenbank ZSE des Umweltbundesamtes,
Stand 11/2020; ZSE, 2020)
et al., 2021). Sie können aber auch direkt die Umwelt Fluorpolymere, z. B. Teflon als einer der bekanntesten
kontaminieren etwa durch den Einsatz PFAS-haltiger Vertreter aus dieser Gruppe, haben breite Anwendung
Löschmittel bei Feuerwehreinsätzen. gefunden als Isolierung für Kabel, Schutzschicht für
Textilien und Metalle, medizinische Schutzausrüstung,
In Deutschland sind bereits viele PFAS-Verunreini- chemisch inerte Abdichtungen und Membranfunktion
gungen in Boden als auch im Grundwasser festgestellt in Funktionskleidung. Den Hauptteil des Marktes
worden. In Nordrhein-Westfalen wurden Feuerlösch- stellen semikristalline fluorierte Polymere dar, mit
mittel als Hauptursache (73 % der Verunreinigungen) einem Handelsvolumen von ca. 220.000 t weltweit im
für PFAS-Belastungen in Boden und Trinkwasser Jahr 2012. Davon stellt Polytetrafluorethylen (PTFE)
ermittelt, gefolgt von Abwässern aus der Galvanik den größten Anteil mit 126.000 t/a. Einen bedeutend
(10 %) und belastetem Klärschlamm (6 %) (MULNV kleineren Anteil (< 1 t/a) bilden die amorphen Teflon
NRW, 2019). Bei diesen Schadensfällen ist jedoch varianten (z. B. Teflon AF), welche aufgrund ihrer
meist unbekannt, ob und in welcher Menge Böden hervorragenden optischen Eigenschaften und niedri-
und Grundwasser auch mit TFA verunreinigt sind, da gem Brechungsindex spezielle Anwendungen finden
in den meisten dieser Fälle nur PFAS mit einer länge- (Gardiner, 2015; Teng, 2012; Dams und Hintzer, 2016).
ren Kohlenstoffkette analysiert werden (≥ C4).
16Quellen
(aus: Ellis et al., 2001)
(aus: Blakey et al., 2007; Jackson et al., 2011)
Bereits 2001 berichtete Ellis et al. (2001), dass bei der PFAS sind folglich eine bedeutende Stoffgruppe mit ho-
Thermolyse von PTFE 8 % TFA entsteht. Die eingesetz- hen Verwendungsmengen. Doch sind diese unter Um-
ten Bedingungen ähnelten den Temperaturen, unter weltbedingungen normalerweise nur schwer abbaubar
denen PTFE verarbeitet wird (Sintern-Verfahren). Der und bilden TFA, wenn überhaupt, sehr langsam und in
vorgeschlagene Abbaumechanismus geht von einer geringen Mengen. Eine aktuelle Studie von Sun et al.
Zersetzung von PTFE zu Carbene-Radikalen aus, wo (2020) deutet darauf hin, dass zumindest kurzkettige
raus Hexafluorpropen (HFP) hervorgeht, das wiederum Fluortelomer-Alkohole (4:2 FTOH und 6:2 FTOH) von
zu TFA umgewandelt werden kann (Ellis et al., 2001). bestimmten Mikroorganismen unter speziellen Labor-
bedingungen zu TFA abgebaut werden können.
Bei dem weniger stark verbreiteten amorphen Fluor
polymer wurde der photochemische Abbau durch Blakey Natürliche Quellen
et al. (2007) festgestellt. Dabei wurde Hexafluoraceton Geologische und biologische Quellen scheinen im
(HFA) als ein Hauptabbauprodukt von Teflon AF Meer für geringe, aber kontinuierliche Freisetzungen
nachgewiesen. HFA ist eine volatile Verbindung, die von TFA verantwortlich zu sein (Frank et al., 2002).
durch Photolyse zu TFA umgesetzt werden kann, z. B. Besonders in der Nähe von Tiefseeschloten wurden er-
in der Atmosphäre. Zusätzlich lässt sich HFA auch unter höhte Konzentrationen von TFA gemessen (Scott et al.,
basischen Bedingungen (z. B. durch Kontakt mit basi- 2005). Nach Scott et al. (2005) werden global ca. 6 t/a
schen Reinigungsmittelen) zu TFA umsetzen (Haloform- TFA durch hydrothermale Schlote im Meer gebildet.
Reaktion) (Blakey et al., 2007; Jackson et al., 2011).
Durch Vergleich mit dem Chloridaustrag aus den
Folglich ist ein Abbau von Fluorpolymeren zu TFA Meeren zeigen Nödler et al. (2019) und Behringer et
nachweisbar. Der photolytische Abbau der amorphen al. (2021), dass TFA sehr wahrscheinlich nur in sehr
Polymere erscheint erstmal relevanter, da dieser be- geringen Mengen aus dem Meer auf das Festland
reits durch UV-Strahlung eintreten kann. Allerdings transportiert wird.
ist dieser Vorgang aufgrund der geringeren herge-
stellten Menge von Teflon AF (und anderen amorphen Überblick über die TFA-Quellen
Fluorpolymere) vermutlich für die TFA Menge in der Abbildung 4 fasst die Ergebnisse von Kapitel 2 zusam-
Umwelt weniger bedeutend. Die Entstehung von TFA men, indem die abgeschätzten maximalen TFA-Emis-
aus PTFE (und anderen semikristallinen Fluorpoly- sionen pro Chemikalienbereich aufgeführt werden.
mere) ist zwar nur unter sehr hohen Temperaturen
nachgewiesen und damit in der Umwelt weniger
relevant. Doch bieten die hohen Produktionsmengen
ein gewisses TFA-Emissionspotenzial.
17Quellen
Abbildung 4
Abgeschätzte maximale TFA-Emissionen in t/a für die relevanten Chemikalienbereiche*
2500
Abschätzung 141 Abschätzung
für Deutschland global
2000
maximale TFA-Emission [t/a]
1170
1500
1000
98
500 1050
? ? ? ?
78
84
22
197 7 6
0
TFA als Biozide PSM TAM HAM Kälte- und Fluorchemikalien Hydrothermale
Grundchemikalie Treibmittel in Produkten Schlote
* berechnet aus den jeweiligen Absatzmengen, den Emissionen (Kälte- und Treibmittel) bzw. Quelle: eigene Darstellung, Umweltbundesamt
übernommen aus publizierten modellbasierten Abschätzungen (Hydrothermale Schlote) (Datenbasis: siehe Erläuterungen zu Abb. 4)
Erläuterungen zu Abbildung 4
Deutschland (grau). Das TFA-Bildungspotenzial 2021). Für die nächsten Jahre ist ein
aller anderen 23 potenziellen TFA- weiterer Anstieg zu erwarten, da ins-
TFA als Grundchemikalie: hierzu
bildenden Stoffe ist in Summe in besondere der Anteil des Kältemit-
gibt es die Tonnagenangabe 100-
Gelb dargestellt. tels R1234yf zunimmt, das zu fast
1.000 t/a als auf EU-Ebene (REACH)
100 % in TFA umgesetzt wird (blau:
in Verkehr gebrachter Stoffmenge; Tierarzneimittel (TAM): Absatzzah-
TFA aus Kältemittel R134a, orange:
eine Aussage für Deutschland ist len für Tierarzneimittel sind nicht
TFA aus Kältemittel R1234yf, grau:
daraus nicht möglich, auch nicht, bekannt, daher ist eine quantitative
TFA aus anderen Kältemitteln).
wieviel TFA in die Umwelt emit- Abschätzung nicht möglich.
tiert wird. Die Nutzung von TFA als Fluorchemikalien in Produkten:
Humanarzneimittel (HAM): Bei
Grundchemikalie findet vermutlich Hierzu ist keine Abschätzung
Humanarzneimitteln kann zwischen
größtenteils im Labor- bzw. Syn- möglich, jedoch ist die Emission
Medikamenten unterschieden
thesebetrieb in geschlossenen mutmaßlich vernachlässigbar.
werden, die über das Abwasser
Räumen/Behältern statt, sodass
in den Wasserkreislauf gelangen
TFA im Regelfall nicht direkt bei der global
können (orange; hauptsächlich die
Verwendung in die Umwelt emittiert
Medikamente Sitagliptin, Celecoxib, Da für natürliche Quellen (hydro-
wird, sondern als Punkteintrag über
Flecainid, Fluoxetin, Bicalutamide, thermale Schlote) keine Daten für
Abwasserbehandlungsanlagen.
Efavirenz), und solchen, die als Deutschland oder Europa vorliegen,
Biozide: Absatzzahlen für Biozid- Narkosegas über die Atmosphäre in wird hier ersatzweise auf Abschät-
produkte sind nicht bekannt, daher die Umwelt emittiert werden (blau; zungen der globalen TFA-Emissionen
ist eine quantitative Abschätzung Isofluran, Sevofluran, Desfluran). aus den Quellen zurückgegriffen.
nicht möglich.
Kälte- und Treibmittel: Abschät- Hydrothermale Schlote: Abschät-
Pflanzenschutzmittel (PSM): Der zung der potenziellen TFA-Menge zung der globalen TFA-Emission aus
Großteil der maximalen TFA-Emis- aus Kälte- und Treibmitteln für das hydrothermalen Schloten pro Jahr
sionen geht auf drei zugelassene Jahr 2020 anhand von erwarteten von Scott et al. (2005).
Wirkstoffe zurück: Flufenacet (blau), Emissionen in Deutschland und
Diflufenican (orange) und Fluazinam TFA-Bildungsraten (Behringer et al.,
18Eintragspfade
3 Eintragspfade
Kapitel 3 untersucht die Eintragspfade und nimmt Industrielle Einleitungen bedürfen in Deutschland
somit – je nach Pfad – eine lokale Perspektive ein. einer Genehmigung, die auf lokaler Ebene anhand
Bei den Eintragspfaden wird zwischen punktuellem, der lokalen Umweltbedingungen und deren Aufnah-
lokal begrenztem und diffusem, eher flächendecken- mekapazitäten vergeben wird – unter Berücksichti-
dem Eintrag unterschieden. Die einzelnen Eintrags- gung der Pflicht zur Nutzung der Besten Verfügbaren
pfade werden im Folgenden näher ausgeführt. Technik (BVT), der Regelwerke aus dem Immissions-
schutzrecht (z. B. BImSchG/TA Luft) und dem media-
Abbildung 5 illustriert die wichtigsten Eintragspfade len Umweltrecht (z. B. Abwasserverordnung (AbwV),
in den Wasserkreislauf und ihr Zusammenspiel. Umweltqualitätsnorm (UQN), siehe Infokasten 5).
Hierbei werden meist bekannte Schadstoffe und übli-
3.1 Punktueller Eintrag che Summenparameter herangezogen. Bei den rund
Der punktuelle Eintrag geschieht durch Einleitungen 2.000 potenziellen Vorläufern von TFA mit der nicht
von Abwässern aus Industrie und Gemeinden in Ober- greifbaren Zahl von Anwendungen ist eine Aussage
flächengewässer – häufig größere Flüsse. Dessen Ein- über die Höhe von punktuellen Einträgen von TFA
fluss auf lokale Konzentrationen kann sehr hoch sein. aus Industrie- und Kläranlagen nicht möglich – auch
Abbildung 5
Die wichtigsten Quellen und Eintragspfade, die zu Belastungen von TFA in Oberflächengewässer
und dem Grundwasser führen
Quelle: eigene Darstellung, Anika Lehmann
19Sie können auch lesen