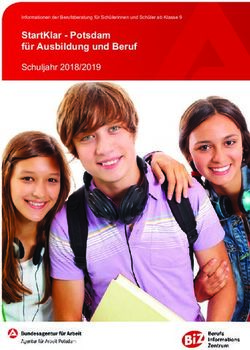Das Eherecht - FAMILIE UND GESELLSCHAFT - Bundesministerium der Justiz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vorwort
Den Kulturpessimisten sei es zugerufen: nierenden Ehe erscheinen Rechtsfragen
Nicht alles wird immer schlechter. So er auf den ersten Blick von geringerer Be
freut sich etwa die freiwillige mensch deutung, sie können aber insbesonde
liche Bindung in der Ehe in Deutschland re auf dem Gebiet des Vermögensrechts
wieder zunehmender Beliebtheit. Knapp sehr wichtig sein.
die Hälfte der Bevölkerung ist verheira
tet, nach Tiefstständen in den Nuller Zwar heißt es im Bürgerlichen Gesetz
jahren steigt die Zahl der Eheschlie buch ausdrücklich: „Die Ehe wird auf
ßungen, jedes Jahr werden etwa 400.000 Lebenszeit geschlossen.“ Doch ist das
Ehen neu geschlossen. Seitdem auch ein Ideal. Viele Verheiratete entschei
gleichgeschlechtliche Paare heiraten den sich anders. Auch wenn die Zahl
dürfen, hat die Ehe noch einmal an der Ehescheidungen seit einigen Jahren
Bedeutung gewonnen. rückgängig ist, werden jedes Jahr immer
noch rund 150.000 Ehen geschieden.
Welche Rechte und Pflichten Eheleute Gerade für den Fall einer vorübergehen
haben, ist in den familienrechtlichen Be den oder dauernden Trennung oder der
stimmungen vor allem des Bürgerlichen Scheidung erlangt das Familienrecht
Gesetzbuches geregelt. In einer funktio besondere Bedeutung.5
Diese Broschüre gibt einen ersten Über Die vorliegende Broschüre bezieht sich
blick zu folgenden Themen: auf Ehen, die deutschem Recht unter
liegen. Bei Ehen mit Auslandsbezug
↗ Eheliche Lebensgemeinschaft kann die Rechtslage anders sein.
(Kapitel 1) Informationen hierzu enthält der vom
↗ Vorübergehendes oder dauerndes Bundesministerium der Justiz heraus
Getrenntleben der Eheleute gegebene Ratgeber zum Internationalen
(Kapitel 2) Privatrecht.
↗ Scheidungs- und Scheidungs
folgenrecht unter Berücksichti Diese Broschüre dient der ersten Hilfe
gung des Zugewinnausgleichs, stellung und Orientierung. Sie will und
des Unterhaltsrechts sowie des kann keine anwaltliche Beratung erset
Rechts des Versorgungsausgleichs zen. Wenn Sie eine individuelle recht
(Kapitel 3, 4 und 5) liche Beratung benötigen, sollten Sie
↗ Gerichtsverfahren bei einer sich an eine Rechtsanwältin oder an
Scheidung (Kapitel 6) einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens
wenden.
Fragen des Kindschaftsrechts (z. B. Um
gang, Sorgerecht) werden in dieser
Handreichung nicht behandelt; hierzu
hat das Bundesministerium der Justiz
eine separate Broschüre veröffentlicht Dr. Marco Buschmann, MdB
(www.bmj.de). Bundesminister der JustizInhalt
1.0 Die Ehe ............................................................................................................................. 10
1.1 Voraussetzungen für die Eheschließung .................................................................. 11
1.2 Die eheliche Lebensgemeinschaft ............................................................................. 11
1.3 Der Ehename .................................................................................................................. 12
1.4 Familienunterhalt und Haushaltsführung .............................................................. 14
1.5 Rechtliche Vertretung zwischen Ehegatten ............................................................ 15
1.5.1 Die Vertretung in Angelegenheiten der Gesundheitssorge
ab 1. Januar 2023
1.5.2 Die Vertretung in Angelegenheiten der Vermögenssorge
1.6 Vermögensrechtliche Auswirkungen der Ehe ......................................................... 20
1.6.1 Die Zugewinngemeinschaft
1.6.2 Die Gütertrennung
1.6.3 Die Gütergemeinschaft / Errungenschaftsgemeinschaft
1.6.4 Die Wahl-Zugewinngemeinschaft
(gemeinsamer deutsch-französischer Güterstand)
1.6.5 Besonderheiten zum Güterrecht für in der DDR geschlossene Ehen
1.7 Der Ehevertrag ............................................................................................................... 277
2.0 Die Trennung .................................................................................................................. 29
2.1 Nutzung der gemeinsamen Wohnung und Verteilung
der Haushaltsgegenstände ......................................................................................... 30
2.2 Der Unterhalt bei Getrenntleben (Trennungsunterhalt) ...................................... 31
2.2.1 Voraussetzungen für den Trennungsunterhalt
2.2.2 Berechnung des Unterhalts
2.2.3 Einschränkung des Unterhaltsanspruchs
3.0 Die Scheidung ................................................................................................................ 34
3.1 Das Scheitern der Ehe .................................................................................................. 34
3.2 Die Trennungszeit als Voraussetzung für den Scheidungsantrag ..................... 35
3.3 Gemeinsame Wohnung und Haushaltsgegenstände ........................................... 36
3.3.1 Wohnung
3.3.2 Haushaltsgegenstände
3.4 Der Zugewinnausgleich ............................................................................................... 37
4.0 Der Unterhalt nach Scheidung (nachehelicher Unterhalt) .................................... 40
4.1 Unterhalt wegen Kindesbetreuung (§ 1570 BGB) .................................................. 41
4.2 Unterhalt wegen Alters, Unterhalt wegen Krankheit
oder Gebrechen (§§ 1571, 1572 BGB) ....................................................................... 42
4.3 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 Absatz 1 BGB) ................................. 42
4.4 Aufstockungsunterhalt (§ 1573 Absatz 2 BGB) ...................................................... 43
4.5 Unterhalt für die Zeit der Ausbildung, Fortbildung
oder Umschulung (§ 1575 BGB) ................................................................................. 43
4.6 Unterhalt aus Billigkeitsgründen (§ 1576 BGB) ..................................................... 448
4.7 Höhe des Unterhalts, Leistungsfähigkeit .............................................................. 44
4.8 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts,
Ende des Unterhaltsanspruchs ................................................................................ 45
4.9 Härteklausel ................................................................................................................. 46
4.10 Rangfolge der Unterhaltsansprüche ...................................................................... 48
4.11 Unterhalt für die Vergangenheit ............................................................................. 50
4.12 Verjährung von Unterhaltsforderungen ................................................................ 50
4.13 Verpflichtung zur Auskunft ....................................................................................... 50
4.14 Unterhalt nach dem Familiengesetzbuch der DDR............................................ 51
5.0 Der Versorgungsausgleich .......................................................................................... 52
5.1 Überblick ......................................................................................................................... 52
5.1.1 Aufgabe des Versorgungsausgleichs
5.1.2 Durchführung des Versorgungsausgleichs
5.2 Vereinbarungen der Eheleute zum Versorgungsausgleich .................................. 54
5.2.1 Vereinbarungsmöglichkeiten
5.2.2 Wirksamkeitsvoraussetzungen
5.3 Wertausgleich bei der Scheidung .............................................................................. 54
5.3.1 Interne Teilung
5.3.2 Externe Teilung
5.3.3 Ausnahmen von der Teilung
5.4 Versorgungskürzung ..................................................................................................... 58
5.5 Ausgleichsansprüche nach der Scheidung .............................................................. 59
5.5.1 Schuldrechtliche Ausgleichsrente
5.5.2 Abfindung
5.5.3 Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung9
5.6 Abänderung der Entscheidung .................................................................................. 59
5.7 Übergangsrecht ............................................................................................................. 60
6.0 Vor dem Familiengericht ............................................................................................ 61
6.1 Das Verfahren vor dem Familiengericht .................................................................. 61
6.1.1 Sachliche Zuständigkeit des Familiengerichts
6.1.2 Örtliche Zuständigkeit des Familiengerichts
6.1.3 Anwaltliche Vertretung
6.1.4 Verfahrenskostenhilfe
6.1.5 Einstweilige Anordnung
6.1.6 Anhörung der Eheleute und der Kinder
6.2 Besonderheiten des Scheidungsverfahrens ............................................................. 66
6.2.1 Inhalt des Scheidungsantrags
6.2.2 Verfahrensverbund
6.2.3 Abtrennung von Folgesachen
6.2.4 Kosten
6.2.5 Familienmediation
7.0 Weiterführende Informationen ................................................................................ 691. Die Ehe
Wer miteinander die Ehe eingeht, „Ehe und Familie stehen unter
verspricht sich nicht nur gegenseitig dem besonderen Schutze der staatlichen
Treue, Achtung, Rücksicht und Beistand Ordnung.“
in allen Lebenslagen. Die künftigen
Eheleute wählen mit der Ehe auch eine Dieser Grundsatz verwirklicht sich in
verbindliche, rechtlich abgesicherte einer Vielzahl von rechtlichen
Form des Zusammenlebens, die von Regelungen, die für Eheleute geschaffen
unserer Verfassung besonders geschützt wurden.
wird. Artikel 6 Absatz 1 des Grund
gesetzes legt fest:11
Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht vor, 1.2 Die eheliche Lebensgemeinschaft
dass die Eheschließung vor einer
Standesbeamtin oder einem Standes- Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen
beamten vorgenommen werden muss. (§ 1353 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
Viele Paare entscheiden sich außer Mit der Eheschließung verpflichten sich
dem dazu, auch kirchlich zu heiraten, die Eheleute zur ehelichen Lebensge
oder sie wählen eine andere religiöse meinschaft und tragen füreinander Ver
Form der Eheschließung. Solche zusätz antwortung. Darunter wird verstanden,
lichen Zeremonien können für die Ehe dass beide voneinander Treue, Achtung,
leute und ihre Angehörigen sehr wichtig Rücksicht, Beistand und häusliche Ge
sein. Rechtliche Folgen hat jedoch allein meinschaft verlangen können.
die standesamtliche Trauung. Nur dann
handelt es sich aus rechtlicher Sicht um Die konkrete Ausgestaltung der Ehe ist
eine gültige Ehe mit den gegenseitigen allein Sache der Eheleute. Das Gesetz gibt
Rechten und Pflichten, die in dieser jedoch einige Grundregeln vor. So werden
Broschüre beschrieben werden. im Eherecht unter Berücksichtigung der
Gleichberechtigung der Ehegatten unter
1.1 Voraussetzungen für die anderem folgende Bereiche geregelt:
Eheschließung
↗ Ehename,
Beide Personen müssen bei der Ehe ↗ Familienunterhalt und Haushalts
schließung volljährig sein. Eine Ehe führung,
darf nicht geschlossen werden, wenn ↗ Eheliches Güterrecht.
↗ eine der betroffenen Personen ver Nach einer Eheschließung gelten also
heiratet ist oder mit einer anderen für die Eheleute automatisch bestimmte
Person als dem künftigen Ehegatten rechtliche Regelungen, auch wenn die
in einer eingetragenen Lebenspart Eheleute keinen Ehevertrag geschlos
nerschaft lebt, sen haben.
↗ die betroffenen Personen in gerader
Linie miteinander verwandt sind
(z. B. Mutter und Sohn) oder wenn
sie Geschwister sind.12
1.3 Der Ehename
Beispiel 1
Eheleute sind nicht verpflichtet, sich Frau Engel und Herr Weiß hei
für einen gemeinsamen Familiennamen raten. Beide führten bis zur Ehe
(Ehenamen) zu entscheiden. Sie sollen schließung ihre Geburtsnamen.
aber nach § 1355 BGB einen Ehenamen Sie können nun bestimmen, ob
bestimmen, denn damit legen sie ins „Engel“ oder „Weiß“ ihr gemein
besondere auch den Familiennamen samer Familienname werden soll.
eventueller gemeinsamer Kinder fest.
Entscheiden sie sich für den Ehe
Ehename kann namen „Weiß“, also den Geburts
namen des Mannes, hat die Frau
↗ der von einem der Ehegatten bei der zusätzlich die Möglichkeit, dem
Bestimmung des Ehenamens ge Ehenamen ihren Geburtsnamen
führte Name sein oder voranzustellen oder anzufügen.
↗ ein hiervon abweichender Geburts Demzufolge kann sie nun Frau
name eines der Ehegatten. „Engel-Weiß“ oder Frau „Weiß-
Engel“ heißen.
Neben dem Geburtsnamen kann also
auch der Name zum Ehenamen Wird der Geburtsname der Ehefrau,
bestimmt werden, den einer der Part also „Engel“, zum Ehenamen be
ner bislang aufgrund einer früheren stimmt, kann Herr Weiß zwischen
Ehe geführt hat, also ein „erheirate- den gleichen Optionen wählen.
ter“ Name.
Es besteht keine Möglichkeit, sich
Diejenige Person, deren Name nicht für den gemeinsamen Doppel
Ehename wird, kann ihren Geburts namen „Engel-Weiß“ oder „Weiß-
namen oder den bei der Bestimmung Engel“ zu entscheiden.
des Ehenamens geführten Namen
dem Ehenamen voranstellen oder
anfügen.
Ein gemeinsamer Doppelname kann
hingegen nicht gewählt werden.13
Wenn jemand dem Ehenamen den bis
Beispiel 2 herigen Namen hinzufügt, stellt sich
Wenn die Ehefrau von Herrn Weiß häufig die Frage, ob er zukünftig aus
zum Zeitpunkt der Eheschließung schließlich beide Namensteile benutzen
nicht mehr ihren Geburtsnamen darf. Dies ist jedoch nur in Ausnahme
„Engel“, sondern den Ehenamen fällen vorgeschrieben, nämlich dann,
aus ihrer ersten Ehe „Schön“ trägt, wenn sich die Identität der betreffenden
gilt Folgendes: Person von einer Behörde oder einem
anderen Amtsträger ansonsten nicht
Auch der Name „Schön“ kann zweifelsfrei feststellen ließe. Im privaten
als Ehename bestimmt werden. Bereich kann eine verheiratete Person
Ist dies der Fall, hat Herr Weiß ihren Namen hingegen beliebig führen,
die Möglichkeit, dem Ehenamen sofern dies nicht betrügerischen
seinen Geburtsnamen voranzu Zwecken dient.
stellen oder anzufügen. Somit kann
er Herr „Schön-Weiß“ oder Herr
„Weiß-Schön“ heißen.
Wird der Ehename „Weiß“ gewählt, Beispiel 3
kann die Ehefrau sowohl ihren Ge Herr Engel-Weiß kann im privaten
burtsnamen als auch den zur Zeit Schriftverkehr oder auf seinem
der Eheschließung geführten Na Bürozimmerschild weiter seinen
men voranstellen oder anfügen. Geburtsnamen „Weiß“ benutzen.
Sie kann damit „Engel-Weiß“ oder
„Weiß-Engel“ heißen, aber auch
„Schön-Weiß“ oder „Weiß-Schön“. Bestimmen die Eheleute keinen Ehe
namen, führen sie jeweils ihren bis
dahin geführten Namen auch nach
Die Eheleute sollen bei der Eheschlie der Eheschließung weiter.
ßung gegenüber der Standesbeamtin
oder dem Standesbeamten erklären,
welchen Ehenamen sie führen wollen.
Wird die Erklärung erst später abgege
ben, muss sie öffentlich beglaubigt
werden.14
1.4 Familienunterhalt und Haben sich die Eheleute einvernehm
Haushaltsführung lich dazu entschieden, dass einer der Ehe
gatten überwiegend den Haushalt führt,
Die Eheleute sind einander verpflich so erfüllt er seine Unterhaltspflicht meist
tet, durch ihre Arbeit und mit ihrem allein durch die Haushaltsführung; zu
Vermögen angemessen zum Unterhalt einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit ist er
der gemeinsamen Familie beizutragen. daher in aller Regel nicht verpflichtet. Eine
Grundsätzlich sind die Eheleute in ihrer Erwerbstätigkeit der haushaltsführenden
Rollenverteilung frei und können nach Person kann aber unter Umständen den
ihrem Belieben die einzelnen Bereiche noch erforderlich sein, etwa dann, wenn
(Haushaltsführung, Erwerbstätigkeit) das Einkommen des erwerbstätigen Ehe
aufteilen. gatten nicht ausreicht, um den Lebens
unterhalt der Familie zu sichern.
Der Familienunterhalt umfasst ins
besondere den gesamten Bedarf Der Person, die den Haushalt führt, muss
der Eheleute und ihrer Kinder für einen angemessenen Zeitraum im
(§ 1360a BGB): Voraus das sogenannte Wirtschaftsgeld
zur Verfügung gestellt werden. Das Wirt-
↗ Kosten für Lebensmittel, Miete, Aus schaftsgeld dient dazu, die notwendigen
stattung der Wohnung, Kleidung, und regelmäßigen Haushaltsausgaben
↗ Kosten zur Befriedigung persönlicher zu decken. Darüber hinaus hat sie, soweit
Bedürfnisse, z. B. für Freizeitgestal sie nicht selbst erwerbstätig ist, einen An
tung, für die Teilnahme am gesell spruch auf ein angemessenes Taschengeld.
schaftlichen und kulturellen Leben,
für Kranken- und Altersvorsorge, Leben die Eheleute getrennt, gelten Son-
↗ Geld zur freien Verfügung (Taschen derregelungen (siehe dazu Abschnitt 2.2).
geld) für den haushaltsführenden
und nicht erwerbstätigen Ehegatten
und für die gemeinsamen Kinder.15
1.5 Rechtliche Vertretung zwischen
Ehegatten Beispiel 5
Das Ehepaar Engel will in eine ge
Anders als vielfach angenommen kön meinsame Mietwohnung ziehen.
nen sich Ehegatten nicht ohne Weiteres Den Mietvertrag unterschreibt nur
gegenseitig umfassend vertreten, denn Herr Engel. Frau Engel hat aber
grundsätzlich ist jeder für die Wahrneh Herrn Engel zuvor bevollmächtigt,
mung seiner eigenen rechtlichen Ange für sie den Mietvertrag mit abzu
legenheiten selbst verantwortlich. Ohne schließen. Das tut Herr Engel.
eine besondere gesetzliche Regelung Damit ist Frau Engel ebenfalls
oder Bevollmächtigung kann niemand Mietvertragspartei geworden.
für eine andere Person rechtsverbind
liche Erklärungen abgeben. Die Ehe
schließung führt grundsätzlich nicht zu Von dem allgemeinen Grundsatz, dass
einer solchen Vertretungsbefugnis. Ehegatten sich nicht gegenseitig vertre
ten können, gibt es zwei Ausnahmen:
↗ Vertretung in Angelegenheiten der
Gesundheitssorge (ab 1. Januar 2023),
Beispiel 4 ↗ Geschäfte zur Deckung des Lebens
Das Ehepaar Engel will in eine ge bedarfs.
meinsame Mietwohnung ziehen.
Den Mietvertrag unterschreibt nur
Herr Engel. Frau Engel ist damit
nicht Mietvertragspartei geworden.
Der Vermieter kann die Miete daher
nur von Herrn Engel fordern; Frau
Engel kann gegenüber dem Vermie
ter neben Herrn Engel allerdings
auch keine Mieterrechte geltend
machen.16
1.5.1 Die Vertretung in Angelegen Anträge bei der Krankenkasse zu
heiten der Gesundheitssorge stellen und Ähnliches –, kann dies
ab 1. Januar 2023 für ihn nicht ohne Weiteres der an
dere Ehegatte erledigen.
Auch in ganz persönlichen Angele
genheiten gibt es kein allgemeines In solchen Fällen ist es häufig erfor
Vertretungsrecht bei Ehegatten, derlich, gerichtlich einen Betreuer zu
z. B. bei der Einwilligung in ärztliche bestellen, wobei das Gericht den Ehe
Behandlungen. gatten als Betreuer bestimmen wird,
soweit dieser geeignet und bereit ist,
dieses Amt zu übernehmen. Es bietet
sich allerdings an, frühzeitig selbst
vorzusorgen und sich gegenseitig
Beispiel 6 oder sich über eine andere angehö
Herr Engel ist in ärztlicher Behand- rige oder sonstige Vertrauensper
lung. Frau Engel ist sehr besorgt und son durch eine Vorsorgevollmacht
möchte vom Arzt wissen, woran entsprechend abzusichern. Genau
Herr Engel leidet und welche Me ere Informationen finden sich in der
dikamente er verschrieben bekom vom Bundesministerium der Justiz
men hat. Der Arzt ist grundsätzlich herausgegebenen Broschüre „Betreu
nicht dazu berechtigt, Frau Engel ungsrecht“ (www.bmj.de).
diese Auskünfte zu geben. Denn die
ärztliche Schweigepflicht gilt auch Ab dem 1. Januar 2023 gibt es in akuten
gegenüber der Person, die mit dem Krankheitssituationen ein auf höchs
Patienten verheiratet ist. Nur wenn tens sechs Monate befristetes gesetz
Herr Engel sein Einverständnis gibt, liches Ehegattennotvertretungsrecht:
kann Frau Engel die gewünschten Wenn ein Ehegatte selbst nicht mehr
Informationen erhalten. in der Lage ist, Entscheidungen in Ge
sundheitsangelegenheiten zu treffen,
darf dies für ihn der andere Ehegatte
Bis zum 31. Dezember 2022 gilt: Auch für einen Zeitraum von höchstens sechs
dann, wenn ein Ehegatte selbst nicht Monaten übernehmen. Eine Verpflich
mehr in der Lage ist, Entscheidun tung zur Vertretung besteht nicht – ist
gen zu treffen – etwa in eine ärzt der Ehegatte also aus gesundheitlichen
liche Behandlung einzuwilligen, oder sonstigen Gründen nicht dazu in17
der Lage oder aber nicht willens, die Ver oder ärztliche Eingriffe einwilligen oder
tretung des anderen Ehegatten zu über sie untersagen. Von der Vertretungs
nehmen, muss er dies nicht tun. befugnis erfasst sind nur Einwilligun
gen in Behandlungen oder Eingriffe, die
Voraussetzung des Vertretungsrechts ist, aus medizinischer Sicht notwendig sind.
dass ein Ehegatte bewusstlos oder krank Regelmäßig betrifft dies Fälle von akut
ist und aus diesem Grund seine Angele eingetretenen gesundheitlichen Beein
genheiten der Gesundheitssorge recht trächtigungen infolge eines Unfalls oder
lich nicht besorgen kann. einer Erkrankung, die eine ärztliche Ver
sorgung notwendig machen (z. B. eine
Operation oder lebenserhaltende Maß
nahmen während eines künstlichen
Komas). Daneben darf er auch Behand
Beispiel 7 lungsverträge, Krankenhausverträge oder
Herr Engel hat einen Herzinfarkt Verträge über eilige Maßnahmen der Re
erlitten. Die Ärztin Dr. Schlau hält habilitation und der Pflege abschließen.
eine Operation für angezeigt. Sie So kann beispielsweise die sich an einen
benötigt für die Behandlung die Krankenhausaufenthalt unmittelbar an
Einwilligung des Herrn Engel, der schließende unaufschiebbare Rehabili
aber nicht ansprechbar ist. Frau tationsmaßnahme auch dann vertrag
Engel lässt sich von Dr. Schlau lich organisiert werden, wenn die Kosten
aufklären. Anschließend willigt nicht durch die gesetzliche Krankenver
Frau Engel in Vertretung von sicherung abgedeckt sind.
Herrn Engel in die Operation ein.
Um dem vertretenden Ehegatten Über freiheitsentziehende Maßnahmen
die verantwortungsvolle Wahr (z. B. Bettgitter während eines postopera
nehmung des Vertretungsrechts zu tiven Delirs, die den Patienten oder die
ermöglichen, sind die behandeln Patientin zu seinem bzw. ihrem Schutz
den Ärzte ihm gegenüber von ihrer am Aufstehen hindern soll) darf der ver
Schweigepflicht entbunden. tretende Ehegatte entscheiden, sofern
die Dauer der Maßnahme im Einzelfall
sechs Wochen nicht überschreitet.
Der vertretende Ehegatte darf in unauf- Er benötigt dafür aber eine Genehmi
schiebbare Untersuchungen des Ge gung des Betreuungsgerichts.
sundheitszustandes, Heilbehandlungen18
Dabei hat sich der vertretende Ehegatte liches Vertretungsrecht. Eine Vorsor
stets von den Wünschen oder dem mut gevollmacht kann in dem Zentralen
maßlichen Willen des Patienten oder Vorsorgeregister registriert werden.
der Patientin leiten zu lassen. Es gilt, das Das Register wird von der Bundesno
Selbstbestimmungsrecht des Patienten tarkammer geführt und kann von Ge
oder der Patientin zu wahren und seinen richten und Ärzten eingesehen werden.
bzw. ihren Willen umzusetzen. Sollten
der aktuelle Wille oder die Behandlungs Hinweis:
wünsche nicht bekannt sein, hat sich der Überlegen Sie, ob eine individuelle
Ehegatte zu fragen, wie der Patient oder Vorsorgevollmacht für den Fall Ihrer
die Patientin entschieden hätte, wenn er Handlungsunfähigkeit nicht die bessere
bzw. sie noch selbst bestimmen könnte, Alternative ist. Genauere Informationen
und diesen mutmaßlichen Willen dann finden sich in der vom Bundesministe
umzusetzen. Dabei sind frühere Äuße rium der Justiz herausgegebenen Bro
rungen des Patienten oder der Patientin, schüre „Betreuungsrecht“ (www.bmj.de).
seine bzw. ihre ethischen oder religiösen
Überzeugungen oder persönlichen Wert Das gesetzliche Vertretungsrecht endet
vorstellungen zu berücksichtigen. jedenfalls spätestens sechs Monate
nach dem von dem behandelnden Arzt
Für die Ausübung des Vertretungs oder der behandelnden Ärztin festge
rechts nach der Erstbehandlung erhält stellten und bestätigten Eintritt der Be
der vertretende Ehegatte vom Arzt wusstlosigkeit oder Krankheit.
oder von der Ärztin ein Dokument.
Ausgeschlossen ist das Vertretungs
recht, wenn die Eheleute getrennt
leben. Lehnt der Ehegatte eine Ver Beispiel 8
tretung durch den anderen Ehegat Am 15. 3. erlitt Herr Engel seinen
ten ab (die Ablehnung kann er in das Herzinfarkt. Frau Dr. Schlau doku
Zentrale Vorsorgeregister bei der mentierte den Eintritt der Krankheit
Bundesnotarkammer eintragen las in dem Dokument, welches sie Frau
sen) oder hat er bereits jemanden mit Engel aushändigte: Spätestens mit
seiner Vertretung in Angelegenheiten Ablauf des 15. 9. endet das gesetzli
der Gesundheitssorge bevollmäch che Vertretungsrecht der Frau Engel.
tigt, besteht ebenfalls kein gesetz19
Sobald der Patient oder die Patientin kann der Ehegatte oder jede andere Per
wieder einwilligungs- und handlungs son jederzeit anregen.
fähig ist, endet das Vertretungsrecht des
Ehegatten automatisch.
Beispiel 10
Frau Engel hat einen schweren
Beispiel 9 Schlaganfall erlitten und wird beat
Herr Engel hat sich von seinem met. Ihr Ehemann will mit der Nach
Herzinfarkt erholt und ist wieder barin zügig ein neues Leben beginnen
ansprechbar. Er wünscht so schnell und möchte, dass das Beatmungsge
wie möglich, das Krankenhaus zu rät abgestellt wird. Der Krankenpfle
verlassen und eine Rehabilitations ger hat Zweifel, dass dies dem Wunsch
einrichtung zu besuchen. von Frau Engel entspricht. Er infor
miert das Betreuungsgericht.
Frau Engel ist nicht mehr berech
tigt, das gesetzliche Vertretungs Der Betreuungsrichter unterhält
recht auszuüben. Herr Engel be sich mit Herrn Engel, dem Kran
vollmächtigt sie aber ausdrücklich, kenpfleger und weiteren Angehöri
die erforderlichen Verträge für ihn gen. Danach bestellt er die Tochter
abzuschließen. der Frau Engel aus erster Ehe zur
Betreuerin. Herr Engel darf seine
Ehefrau nicht mehr vertreten.
Mit der Bestellung eines rechtlichen
Betreuers für den Patienten oder die Pa
tientin für die Angelegenheiten der Ge Wenn die Voraussetzungen des Ehe
sundheitssorge endet das Vertretungs gattenvertretungsrechts nicht vorliegen
recht ebenfalls. Auch wenn ein Betreuer oder der vertretende Ehegatte es nicht
nur für einzelne der Angelegenheiten ausüben kann oder will, ist es erfor-
bestellt wird, für die das Gesetz ein Ver derlich, gerichtlich einen rechtlichen
tretungsrecht von Ehegatten vorsieht, Betreuer zu bestellen, sofern ein Hand
ist das Vertretungsrecht des Ehegatten lungsbedarf in rechtlichen Angelegen
in diesem Umfang ausgeschlossen. Die heiten besteht.
Einleitung eines Betreuungsverfahrens20
Es bietet sich an, frühzeitig selbst vorzu fordern und ist verpflichtet, den Kauf
sorgen und sich z. B. als Ehegatten gegen preis zu zahlen – auch wenn der Kauf
seitig durch eine Vorsorgevollmacht ent vertrag von dem jeweils anderen Ehe
sprechend abzusichern. Auch andere gatten abgeschlossen wurde.
Vertrauenspersonen können bevollmäch
tigt werden. Genauere Informationen 1.6 Vermögensrechtliche
finden sich in der vom Bundesministe Auswirkungen der Ehe
rium der Justiz herausgegebenen Bro
schüre „Betreuungsrecht“ (www.bmj.de). Die Frage, wem während der Ehe
erworbenes Vermögen gehört und
1.5.2 Die Vertretung in Angelegen- wie dies nach Beendigung der Ehe
heiten der Vermögenssorge verteilt wird, richtet sich immer nach
dem jeweiligen familienrechtlichen
Eine weitere Ausnahme von dem Güterstand. Die vermögensrechtli
Grundsatz, dass Eheleute sich nicht chen Auswirkungen einer Eheschlie
ohne Weiteres gegenseitig vertreten ßung sind in den Vorschriften über
können, bilden die „Geschäfte zur an das eheliche Güterrecht im Bürgerli
gemessenen Deckung des Lebens chen Gesetzbuch geregelt. Das Gesetz
bedarfs der Familie“. Dies sind alle kennt folgende Güterstände:
Geschäfte, die erforderlich sind, um
den Haushalt zu führen und die per ↗ die Zugewinngemeinschaft,
sönlichen Bedürfnisse der Eheleute ↗ die Gütertrennung,
und ihrer unterhaltsberechtigten ↗ die Gütergemeinschaft,
Kinder zu befriedigen, wie z. B. der ↗ die Wahl-Zugewinngemeinschaft.
Kauf von Lebensmitteln, Haushalts
geräten, Bekleidung, Kosmetika, Spiel 1.6.1 Die Zugewinngemeinschaft
zeug für die Kinder.
Sofern die Eheleute nicht durch notariel
Durch derartige Geschäfte werden len Ehevertrag eine andere Vereinbarung
beide Eheleute berechtigt und ver treffen, gilt der gesetzliche Güterstand
pflichtet, unabhängig davon, wer der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 BGB).
das Geschäft abgeschlossen hat. Jeder Zugewinngemeinschaft bedeutet Güter
von ihnen kann also beispielsweise trennung während der Ehe und Ausgleich
die Lieferung einer gekauften Sache des Zugewinns nach Beendigung des21
Güterstandes. Das heißt: Was die Eheleu
te jeweils innerhalb der Ehe an Vermögen Beispiel 11
erwerben, gehört zwar jedem Ehegatten Frau Engel ist erwerbstätig. Ihr Ge
allein, wird aber bei Ende der Zugewinn halt, von dem die Familie lebt, wird
gemeinschaft (Auflösung der Ehe oder auf ein Girokonto gezahlt, das sie
Ehevertrag) untereinander ausgeglichen. auf ihren Namen eröffnet hat. Es
handelt sich nicht automatisch um
a) Die Eigentumsverhältnisse innerhalb ein „Familienkonto“. Herr Engel hat
der Zugewinngemeinschaft, Haftung auf dieses Konto nur dann Zugriff,
der Eheleute und Verwaltung des wenn Frau Engel ihm eine Konto
Vermögens vollmacht erteilt hat.
Die Eheschließung führt nicht automa
tisch dazu, dass das bereits vorhandene
und das während der Ehe neu erwor
bene Vermögen den Eheleuten nun ge
meinsam gehört. Vielmehr behält jeder
Ehegatte das, was er bereits vor der Ehe Beispiel 12
erworben hatte, und auch das, was er Frau und Herr Engel wollen in ein
während der Ehe erwirbt, als sein eige „Häuschen im Grünen“ ziehen, das
nes Vermögen. ihnen aber noch nicht gehört. Weil
Herr Engel sich mit Grundstücken
auskennt, schließt er das Geschäft
über den Hauskauf allein ab. Ob
wohl es sich um ein gemeinsames
Familienheim handelt, ist dennoch
nur Herr Engel Eigentümer von
Grundstück und Haus geworden.
Will Frau Engel Miteigentümerin
werden, muss sie mit Herrn Engel
gemeinsam das Grundstück er
werben.22
Eine verheiratete Person haftet in aller
Regel nur für die eigenen Schulden und Beispiel 14
nur mit dem eigenen Vermögen. Hier Frau Engel kann ihre Aktien ver
von ausgenommen sind Geschäfte zur kaufen, selbst wenn Herr Engel der
angemessenen Deckung des täglichen Meinung ist, dass sie diese zur bes
Lebensbedarfs der Familie (siehe Ab seren Altersvorsorge behalten solle,
schnitt 1.5.2). denn Frau Engel kann über ihr
eigenes Vermögen frei verfügen.
Allerdings gibt es Ausnahmen von dem
Beispiel 13 Grundsatz der Verfügungsfreiheit inner
Für den Erwerb des „Häuschens im halb der Zugewinngemeinschaft. Will
Grünen“ reicht das Ersparte von einer der Ehegatten über sein Vermögen
Herrn und Frau Engel nicht aus. im Ganzen oder nahezu das ganze Ver
Sie müssen ein Bankdarlehen auf mögen verfügen (verkaufen, verschen
nehmen. Schließt nur Herr Engel ken etc.), benötigt er die Zustimmung
den Darlehensvertrag ab, so haftet des anderen Ehegatten (§ 1365 BGB).
nur er und nicht auch Frau Engel
für die Darlehensverbindlichkeit,
und zwar selbst dann, wenn beide
Eheleute Eigentümer der Immobi
lie geworden sind. Umgekehrt gilt Beispiel 15
aber auch: Unterschreiben beide Frau Engel ist Alleineigentümerin
den Darlehensvertrag, haften beide eines Baugrundstücks und möchte
für die Rückzahlung des Darlehens, dieses an ihren Lieblingsneffen
selbst dann, wenn – wie im obigen verschenken, der eine Familie
Beispiel – Herr Engel der alleinige gründen und ein Haus bauen will.
Eigentümer der Immobilie wird. Das Grundstück macht allerdings
Frau Engels Vermögen im Ganzen
aus. Sie benötigt daher für die
Beide Eheleute können ihr eigenes Schenkung die Zustimmung von
Vermögen selbst verwalten und in aller Herrn Engel.
Regel auch frei darüber verfügen.23
Will eine verheiratete Person über Ge den Zugewinnausgleich oder einen Aus
genstände verfügen, die zwar in ihrem schluss des Ausgleichs im Ehevertrag
Alleineigentum stehen, aber zum eheli über den neuen Güterstand zu regeln.
chen Haushalt gehören, benötigt
sie ebenfalls die Zustimmung ihres Beim Zugewinnausgleich wird das Ver
Ehegatten (§ 1369 BGB). mögen beider Eheleute bei Beginn und
zum Ende des Güterstandes miteinan
der verglichen. Der Ehegatte, der wäh
rend der Ehe mehr Vermögen hinzuer
worben hat als der andere, hat die Hälfte
Beispiel 16 der Differenz zum Vermögenszuwachs
Die Wohnzimmereinrichtung der des anderen Ehegatten an diesen auszu
Familie Engel gehört Herrn Engel; gleichen. Der Ausgleich erfolgt grund
er hat sie von seiner verstorbenen sätzlich durch Geldzahlung, nicht durch
Großmutter geerbt. Er möchte die Austausch oder Teilung von Vermögens
alten Möbel verkaufen, um Platz gegenständen. Der Zugewinnausgleich
für eine moderne Einrichtung zu erfolgt nicht automatisch bei der Been
schaffen. Da die Möbel zum ehe digung des Güterstandes, sondern muss
lichen Haushalt gehören, kann er geltend gemacht werden (siehe Ab
dies aber nur mit Zustimmung von schnitt 3.4).
Frau Engel tun.
Beim Tod eines Ehegatten erfolgt der
Zugewinnausgleich pauschal durch
b) Ausgleich des Zugewinns nach Erhöhung des gesetzlichen Erbteils um
Beendigung des Güterstandes ein Viertel, unabhängig davon, ob der
verstorbene Ehegatte überhaupt einen
Ein Anspruch auf Zugewinnausgleich Zugewinn während der Ehe erzielt hat
kann bestehen, wenn dieser Güterstand (§ 1371 Absatz 1 BGB).
endet, zum Beispiel durch den Tod eines
Ehegatten, durch Scheidung der Ehe
oder durch den Abschluss eines Ehe
vertrages, in dem ein anderer als der
gesetzliche Güterstand vereinbart wird.
Im letzteren Fall wird es sich anbieten,24
Beispiel 17 Beispiel 18
Frau Engel, die kein Testament er Frau Engel stirbt und hinterlässt
richtet hat, stirbt und hinterlässt neben ihrem Ehemann Herrn
neben ihrem Ehemann Herrn Engel, mit dem sie in Zugewinn
Engel, mit dem sie in Zugewinnge gemeinschaft lebte, zwei Kinder.
meinschaft lebte, zwei Kinder. Herr In ihrem Testament hat sie die Kin
Engel erbt neben den beiden Kin der zu gleichen Teilen als Erben
dern ein Viertel (vgl. § 1931 Absatz 1 eingesetzt; diese erben also jeweils
BGB), dieser Erbteil wird noch um die Hälfte ihres Vermögens, Herr
ein Viertel als pauschalen Zuge Engel ist durch das Testament ent
winn erhöht. Damit erbt nach der erbt. Herr Engel hat aber einen An
gesetzlichen Erbfolge Herr Engel spruch gegen die Kinder auf Zah
die Hälfte und die beiden Kinder je lung seines Pflichtteils von einem
weils ein Viertel des Vermögens von Achtel des Nachlasswertes als der
Frau Engel. Hälfte seines gesetzlichen Erbteils
von einem Viertel (vgl. § 2303 Ab
satz 2 BGB). Daneben hat er gegen
Wenn der noch lebende Ehegatte nicht sie einen Anspruch auf Zahlung des
Erbe wird oder die Erbschaft ausge Zugewinnausgleichs, falls Frau
schlagen hat, kann er den Ausgleich Engel einen Zugewinn erzielt ha
des tatsächlich entstandenen Zuge ben sollte.
winns fordern und zusätzlich den so
genannten kleinen Pflichtteil geltend
machen. Der kleine Pflichtteil wird In folgenden Fällen steht dem noch
nach dem gesetzlichen Erbteil berech lebenden Ehegatten ausschließlich
net, allerdings ohne Berücksichtigung der güterrechtliche Zugewinnaus
des pauschalen Viertels aus dem Zuge gleich zu:
winnausgleich.
↗ bei einem Verzicht auf das Erbe oder
auf den Pflichtteil,
↗ bei Verlust des Erbrechts (sogenannte
Erbunwürdigkeit),
↗ bei der Entziehung des Pflichtteils.25
Genauere Informationen zum Gütertrennung kann auch ohne aus
Erbrecht finden sich in der vom drückliche vertragliche Regelung durch
Bundesministerium der Justiz her die Eheleute eintreten, zum Beispiel
ausgegebenen Broschüre „Erben und dann, wenn der gesetzliche Güterstand
Vererben“ (www.bmj.de). der Zugewinngemeinschaft durch Ehe
vertrag aufgehoben oder ausgeschlossen
1.6.2 Die Gütertrennung wird, ohne dass zugleich ein anderer
Güterstand vereinbart wurde.
Die Gütertrennung muss von den Ehe
leuten durch notariellen Vertrag ver 1.6.3 Die Gütergemeinschaft /
einbart werden (§ 1414 BGB). Durch die Errungenschaftsgemeinschaft
Gütertrennung erfolgt eine vollständige
Trennung des Vermögens beider Ehegat Auch die Gütergemeinschaft muss von
ten, ohne dass es nach dem Ende der Ehe den Eheleuten durch notariellen Ehe
zu einem etwaigen Zugewinnausgleich vertrag vereinbart werden (§ 1415 BGB).
kommt. Jeder Ehegatte behält das, was er
bereits vor der Ehe erworben hatte, und In der Gütergemeinschaft werden das
auch das, was er während der Ehe erwirbt, in die Ehe eingebrachte und das wäh
als sein eigenes Vermögen. Die Eheleute rend der Ehe erworbene Vermögen in
können ihr Vermögen unabhängig von der Regel zu gemeinsamem Vermögen
einander verwalten und – im Gegensatz der Eheleute (Gesamtgut, § 1416 BGB).
zur Zugewinngemeinschaft – ohne Ein
schränkungen frei darüber verfügen. Über seinen Anteil am Gesamtgut und
über einzelne Gegenstände, die zum
Während des Bestehens der Ehe gibt es zwi Gesamtgut gehören, kann ein Ehe
schen dem Güterstand der Zugewinnge gatte nicht frei verfügen und er ist
meinschaft und dem Güterstand der Güter auch nicht berechtigt, die Teilung zu
trennung kaum Unterschiede. Ein wichtiger verlangen (§ 1419 BGB).
Unterschied ist jedoch, dass bei der Güter
trennung – anders als bei der Zugewinn Daneben können die Eheleute Son
gemeinschaft – der jeweilige Ehegatte auch dergut (§ 1417 BGB) haben, welches
über sein Vermögen im Ganzen frei verfü nicht zum gemeinsamen Vermögen
gen darf und bei der Verfügung über Haus der Eheleute wird. Dies sind Gegen
haltsgegenstände nicht die Zustimmung des stände, die nicht durch Rechtsge
anderen Ehegatten erforderlich ist. schäfte übertragen werden können,26
wie zum Beispiel unpfändbare Forde Ehe getrennt. Erst bei Beendigung
rungen oder der Anteil an einer Perso des Güterstandes wird der erwirt
nengesellschaft. schaftete Zugewinn zwischen ihnen
ausgeglichen.
Außerdem können einem Ehegatten
bestimmte Vermögensgegenstände Trotz der inhaltlichen Nähe zur deut
als Alleineigentum vorbehalten sein. schen Zugewinngemeinschaft gibt
Zu diesem Vorbehaltsgut (§ 1418 BGB) es bei der Wahl-Zugewinngemein
gehört insbesondere das Vermögen, schaft aber eine Reihe französisch ge
das durch Ehevertrag zum Vorbehalts prägter Besonderheiten. So werden
gut erklärt worden ist oder das unter etwa Schmerzensgeld und zufällige
bestimmten Voraussetzungen von ei Wertsteigerungen von Immobilien
nem Ehegatten geerbt worden ist. (z. B. durch Erklärung von landwirt
schaftlichen Flächen zu Bauland)
Als Sonderform der Gütergemein nicht im Zugewinnausgleich berück
schaft können die Eheleute auch sichtigt. Dieser Güterstand kann auch
eine Errungenschaftsgemeinschaft nach französischem Recht als Wahl
begründen, die im deutschen Recht güterstand vereinbart werden. Er
nicht gesondert gesetzlich ausge bietet sich deshalb insbesondere für
staltet ist. Dazu müssen sie im Ehe deutsch-französische Paare an, die in
vertrag festlegen, dass das gesamte Deutschland und in Frankreich leben
vor der Eheschließung erworbene bzw. von einem Staat in den anderen
Vermögen Vorbehaltsgut sein soll. umziehen wollen.
1.6.4 Die Wahl-Zugewinn 1.6.5 Besonderheiten zum
gemeinschaft Güterrecht für in der
(gemeinsamer deutsch- DDR geschlossene Ehen
französischer Güterstand)
Das eheliche Güterrecht für Eheleute
Entscheiden sich Eheleute für den aus den neuen Bundesländern hat
deutsch-französischen Güterstand sich zum 3. Oktober 1990 grundlegend
der Wahl-Zugewinngemeinschaft geändert.
(§ 1519 BGB), so bleiben ihre Ver
mögen – wie bei der deutschen Zu Eheleute, die im gesetzlichen Güter
gewinngemeinschaft – während der stand der Eigentums- und Vermögens27
gemeinschaft des Familiengesetzbuches schaft entsprechend angewendet. Bei ei
der DDR (FGB) gelebt haben, sind zu ner Scheidung wird diese Gemeinschaft
diesem Datum ohne weiteres Zutun in jedoch nach den Vorschriften des Fami
den gesetzlichen Güterstand der Zuge liengesetzbuches der DDR aufgelöst.
winngemeinschaft des Bürgerlichen
Gesetzbuches eingetreten (Artikel 1.7 Der Ehevertrag
234 § 4 Absatz 1 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche – Der Abschluss eines Ehevertrags bietet
EGBGB). sich dann an, wenn die Eheleute
meinen, dass der gesetzlich vorgesehe
Die Grundzüge der Zugewinngemein ne Güterstand der Zugewinngemein
schaft sind in Abschnitt 1.6.1 erläu schaft für ihre Ehe nicht passt. So kön
tert. Soweit die Eheleute noch im alten nen sie stattdessen beispielsweise den
Güterstand des FGB gemeinschaftli Ausschluss der Zugewinngemeinschaft
ches Eigentum gebildet hatten, ist die oder auch Gütertrennung oder Güterge
ses Eigentum zu grundsätzlich glei meinschaft vereinbaren oder innerhalb
chen Bruchteilen geworden (Artikel eines bestimmten Güterstandes vom
234 § 4a EGBGB), d. h., jeder Ehegat Gesetz abweichende Bestimmungen
te kann nunmehr grundsätzlich allein treffen. Aber auch Regelungen zum Ver
über seinen Anteil verfügen. sorgungsausgleich oder zum Unterhalt
können vertraglich festgelegt werden.
Dem gesetzlichen Wechsel in den
Güterstand der Zugewinngemein
schaft konnte jede verheiratete Person
bis zum 2. Oktober 1992 durch notariell
beurkundete Erklärung gegenüber je Beispiel 19
dem Kreisgericht (heute Amtsgericht) Herr Engel ist Inhaber eines Unter
widersprechen (Artikel 234 § 4 EGBGB). nehmens. Da Herrn Engel bekannt
Eheleute, die eine solche Erklärung ab ist, dass die Ermittlung eines Unter
gegeben haben, leben also weiterhin nehmenswerts sehr aufwendig ist
im Güterstand der Eigentums- und Ver und oftmals sogar zu Streitigkeiten
mögensgemeinschaft des Familienge führt, vereinbart er mit seinem Ehe
setzbuches der DDR. Allerdings werden mann im Ehevertrag, das Unter
sowohl auf das bestehende als auch auf nehmen aus dem Zugewinnaus
das künftige gemeinschaftliche Eigen gleich auszuschließen.
tum die Vorschriften zur Gütergemein28
Allerdings sind nicht alle Regelungen, Wenn sich die tatsächliche Gestaltung
die in Eheverträgen vorgesehen werden, der ehelichen Lebensverhältnisse ganz
rechtlich wirksam. Kommt es beispiels erheblich von der Lebensplanung unter
weise zu einer einseitigen Benachteili scheidet, die dem Ehevertrag ursprüng
gung eines Ehegatten und treten noch lich zugrunde lag, und dies für einen
bestimmte weitere Umstände hinzu, der Ehegatten unzumutbare Folgen hat,
kann der Ehevertrag sittenwidrig und da kommt eine Anpassung des bestehen
mit nichtig sein. Dann gelten wieder die den Ehevertrags an die geänderten Um
gesetzlichen Bestimmungen, die der Ehe stände in Betracht.
vertrag eigentlich ausschließen sollte.
Die Rechtsprechung hierzu ist sehr viel
Solche Umstände können etwa dann fältig. Ob eine Regelung tatsächlich
vorliegen, wenn sich einer der Ehegatten sittenwidrig und damit nichtig ist oder
bei Abschluss des Ehevertrages die Un ob sie angepasst werden muss, lässt sich
erfahrenheit des anderen zunutze macht letztlich nur im Einzelfall beurteilen.
oder wenn sich einer der Ehegatten in
einer Zwangslage befindet und der an Ein Ehevertrag kann vor oder während
dere dies zu dessen Benachteiligung der Ehe geschlossen werden, § 1408 BGB.
ausnutzt. Aber auch der Verstoß gegen Er muss von beiden Eheleuten bei einer
die Interessen eines Kindes kann zur Notarin oder einem Notar unterschrie
Nichtigkeit des Ehevertrags führen, bei ben werden; beide Eheleute müssen
spielsweise dann, wenn auf zukünftigen gleichzeitig anwesend sein. Dies hat den
Unterhalt wegen der Betreuung gemein Vorteil, dass die Eheleute sich zugleich
samer Kinder verzichtet wird. über die vorgesehenen Bestimmungen
rechtlich beraten lassen können.29
2. Die Trennung
„Die Ehe wird auf Lebenszeit
geschlossen“,
… so heißt es in § 1353 des Bürgerlichen Trotz der Trennung sind die
Gesetzbuchs – BGB. Dennoch bleiben Eheleute noch in starkem Maße
Konflikte in einer Ehe nicht aus. Ent füreinander verantwortlich. Daran än
schließen sich die Eheleute zu einer vo dert auch ein eingeleitetes Scheidungs
rübergehenden oder dauerhaften Tren verfahren grundsätzlich nichts. Zudem
nung, müssen bestimmte Regelungen ist die Ehe bis zum Abschluss des Schei
getroffen werden. dungsverfahrens noch nicht aufgelöst
und eine Wiederherstellung der eheli
chen Lebensgemeinschaft ist denkbar.30
2.1 Nutzung der gemeinsamen
Wohnung und Verteilung der Beispiel
Haushaltsgegenstände Herr Engel betrinkt sich regelmäßig
schwer. Er zerstört dann Einrich
Bei der Trennung der Eheleute müs tungsgegenstände und beleidigt
sen sich diese häufig mit der Frage be Frau Engel sowie die gemeinsamen
fassen, wer von ihnen künftig die ehe Kinder. Frau Engel möchte sich
liche Wohnung nutzen darf und wie trennen und die Wohnung allein
die Haushaltsgegenstände (z. B. Einrich nutzen. Ist Herr Engel mit seinem
tungsgegenstände, Familienauto etc.) Auszug nicht einverstanden, kann
verteilt werden sollen. In der Praxis Frau Engel beim Familiengericht
regeln die Eheleute diese Frage meist eine Wohnungszuweisung an sich
einvernehmlich. beantragen, insbesondere dann,
wenn es für sie und die gemein
Kommt es jedoch nicht zu einer Eini samen Kinder keine andere Wohn
gung, gilt Folgendes: möglichkeit gibt. Auf die Eigen
tumsverhältnisse an der Wohnung
Wenn die Eheleute getrennt leben oder und auf Wohnrechte ist dabei
wenn einer von ihnen dies beabsichtigt, Rücksicht zu nehmen.
kann ein Ehegatte von dem anderen
verlangen, ihm die Ehewohnung oder
einen Teil hiervon zur alleinigen Be Hat einer der Ehegatten den anderen
nutzung zu überlassen (sogenannte körperlich misshandelt oder bedroht,
Wohnungszuweisung), soweit dies not ist die ganze Wohnung in der Regel
wendig ist, um eine unbillige Härte zu demjenigen Ehegatten zuzuweisen, der
vermeiden (§ 1361b BGB). verletzt oder bedroht worden ist (siehe
dazu auch die Broschüre „Mehr Schutz
bei häuslicher Gewalt“, die Sie auf der
Internetseite des Bundesministeriums
der Justiz unter www.bmj.de finden).
Die Wohnungszuweisung dient dazu, die
Nutzung der Wohnung vorübergehend
während des Getrenntlebens zu regeln.31
Sie soll nicht die Ehescheidung vorberei meinsamen Kinder. Diese haben einen
ten oder erleichtern. eigenen Unterhaltsanspruch.
Auch die Benutzung der Haushalts Der Unterhaltsbetrag wird monatlich im
gegenstände kann für die Zeit des Ge Voraus bezahlt.
trenntlebens geregelt werden (§ 1361a
BGB). Dabei können die Eheleute jeweils Der bis zur Trennung nicht erwerbstäti
voneinander die Herausgabe der ihnen ge Ehegatte muss in der Regel im ersten
gehörenden Haushaltsgegenstände ver Jahr nach der Trennung keine Erwerbs
langen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die tätigkeit aufnehmen, insbesondere dann
Person, von der die Herausgabe verlangt nicht, wenn er bereits längere Zeit nicht
wird, die Gegenstände für die Führung erwerbstätig war. Allerdings kann ein
des eigenen neuen Haushalts benötigt nicht erwerbstätiger Ehegatte darauf
und die Überlassung im Einzelfall verwiesen werden, den Unterhalt durch
der Billigkeit entspricht (z. B. die Über eigene Erwerbstätigkeit zu verdienen,
lassung der Waschmaschine an den Ehe wenn
gatten, bei dem die Kinder leben).
↗ dies von ihm angesichts seiner per
2.2 Der Unterhalt bei Getrenntleben sönlichen Verhältnisse und ange
(Trennungsunterhalt) sichts der wirtschaftlichen Verhält
nisse beider Eheleute erwartet
Leben die Eheleute getrennt, ohne dass werden kann (hierbei werden ins
die Ehe bereits geschieden ist, dann besondere eine frühere Erwerbs
können sie voneinander angemessenen tätigkeit sowie die Dauer der Ehe
Unterhalt verlangen (§ 1361 BGB). berücksichtigt) und
↗ die Ehe erst von kurzer Dauer ist
Dieser Anspruch auf Trennungsunter (in der Regel nicht länger als drei
halt besteht nur bis zu dem Zeitpunkt, Jahre).
an dem die Scheidung rechtskräftig wird.
Je länger die Trennungsphase dauert
Der Trennungsunterhalt umfasst – an und je geringer die Wahrscheinlich-
ders als der Familienunterhalt während keit einer Versöhnung der Eheleute
des Zusammenlebens – nur den Lebens wird, desto wahrscheinlicher wird
bedarf des unterhaltsberechtigten Ehe es, dass auch der bislang nicht erwerbs
gatten, nicht aber denjenigen der ge tätige Ehegatte darauf verwiesen32
werden kann, seinen Unterhalt selbst Düsseldorfer Tabelle, einem von Vertre
zu verdienen. tern aller Oberlandesgerichte erarbeite
ten Tabellenwerk, entnommen werden
2.2.1 Voraussetzungen für den (vgl. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/
Trennungsunterhalt infos/Duesseldorfer_Tabelle/).
Der Anspruch auf Trennungsunterhalt Die Leistungsfähigkeit der unterhalts
besteht, wie alle gesetzlichen Unter pflichtigen Person wird – wie bei der ge
haltsansprüche, nur unter folgenden samten Unterhaltsberechnung – nach
Voraussetzungen: dem sogenannten bereinigten Netto
einkommen beurteilt. Hierzu werden
↗ Die Person, die Unterhalt verlangt, folgende Posten vom Bruttoeinkommen
muss bedürftig sein. abgezogen:
Bedürftig ist, wer seinen grundlegenden ∙ Steuern,
Lebensunterhalt mit eigenen finanziel ∙ Sozialabgaben,
len Mitteln nicht decken kann. ∙ berufsbedingte Aufwendungen,
∙ Kosten für Krankheits- und
↗ Die Person, von der Unterhalt ver Altersvorsorge.
langt wird, muss leistungsfähig sein.
Im Einzelfall können unter bestimmten
Leistungsfähig ist, wer Unterhalt zahlen Voraussetzungen weitere Abzüge zuläs
kann, ohne seinen eigenen angemesse sig sein, etwa Schulden oder krankheits
nen Lebensunterhalt zu gefährden. bedingte Mehrkosten.
Welcher Betrag für den eigenen Unter
halt als angemessen gilt, hängt vom Die unterhaltspflichtige Person darf
Einzelfall ab. Der unterhaltspflichtigen sich der Unterhaltspflicht nicht dadurch
Person muss in jedem Fall mehr als der entziehen, dass sie beispielsweise ohne
sozialhilferechtliche Bedarf bleiben wichtigen Grund ihre Arbeit kündigt
(sogenannter Selbstbehalt). Der Selbst und so arbeitslos wird. Sollte sie dies
behalt ist beim Unterhalt an die Ehefrau dennoch tun, muss sie damit rechnen,
oder den Ehemann höher als bei Unter dass bei der Unterhaltsberechnung ein
haltsverpflichtungen gegenüber min fiktives Einkommen zugrunde gelegt
derjährigen unverheirateten Kindern wird, sie also so behandelt wird, als hätte
(Kindesunterhalt). Die Höhe des jeweili sie ihr vorheriges Einkommen noch.
gen Selbstbehalts kann der sogenanntenSie können auch lesen