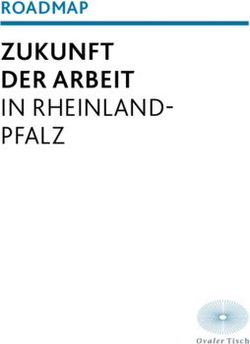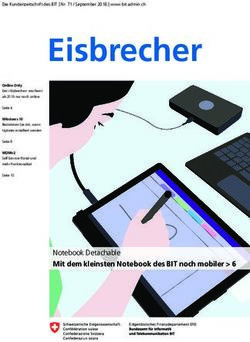Das große Energieeinsparkraftwerk Thüringen 2009plus Masterplan für eine Energiewende in Thüringen und zukunftsorien-tierte Arbeitsplätze durch ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Das große Energieeinsparkraftwerk Thüringen 2009plus
Masterplan für eine Energiewende in Thüringen und zukunftsorien-
tierte Arbeitsplätze durch die neue linke Landesregierung
Bodo Ramelow /
Wilfried Telkämper
Erfurt, den 6. August 2009
Die industriellen Staaten der Erde stehen bei der Energieproduktion vor einem Paradigmen-
wechsel. Die entscheidende Frage auch wird sein, ob eine ausreichende Energiesicherheit
zu bezahlbaren Preisen langfristig gesichert werden kann. Die derzeitige Struktur mit Mega-
Kraftwerken und großen Hochspannungsübertragungssystemen steht vor seinen Ausbau-
grenzen. Thüringen muss sich entscheiden, ob es in dieser Entwicklung Treiber oder Getrie-
bener ist, ob es den Stillstand oder die Zukunft wählen will.
Wir schlagen für das Land Thüringen ein neues Leitbild vor. Wir wollen das modernste Ener-
gieland Deutschlands werden. Die LINKE in Thüringen verbindet Ökonomie und Ökologie.
Mittels des Masterplanes wird in Thüringen Energieverschwendung reduziert, Energiever-
brauch optimiert und der Bedarf an Energie regenerativ produziert.
Mit dem Masterplan für eine Energiewende wollen wir aufzeigen, dass es nicht einfach nur
um ein Nein zur 380-KV-Leitung durch den Thüringer Wald geht, sondern um ein Ja für den
Produktions- und Forschungsstandort in Sachen regenerativer Energie in Thüringen.
Wir haben in Thüringen schon jetzt die höchste Produktion von Solarzellen, aber die gering-
ste Dichte von Solarkraftwerken auf öffentlichen Gebäuden. Thüringen ist das Bundesland
mit der höchsten Energieeinfuhr. Bisher war dies ein strategischer Nachteil. Wir wollen aus
der Umkehr des Prozesses mit modernen Konzepten der Energieeinsparung und Energieef-
fizienz (Großes Energieeinsparkraftwerk Thüringen) den Nachteil zu unserem entscheiden-
den Vorteil verwandeln. Hiermit entsteht regionale Energieproduktion, hiermit entsteht auch
Industrieproduktion für einen wachsenden solaren Weltmarkt. Hiermit entsteht eine Förde-
rung der mittelständischen Wirtschaft in Thüringen, die Sicherung der Existenz von Hand-
werksbetrieben und Schaffung zukunftsorientierter neuer und sicherer Arbeitsplätze.
Unser Schlüssel der Umsteuerung heißt: Energieeffizienz und Dezentralisierung. Die Strom-
produktion in Thüringen muss in Zukunft wärmegeleitet sein. Überall, wo Wärme ge- und
verbraucht wird, wollen wir gemeinsam mit der Industrie diese in Strom umwandeln. Wenn in
einem Glaswerk 600 Grad Abwärme zur Verfügung stehen, muss diese energetisch genutzt
werden. Wenn in einem Industriegebiet größere Strommengen benötigt werden, muss eine
eigene Kraft-Wärme-Kopplung ermöglicht werden. Wenn bei großen Gärtnereibetrieben
Wärme als kalkulierbarer Faktor gebraucht wird, muss über entsprechende Anlagen Abwär-
me genutzt werden.
Positive Beispiele wie die Tomatenzuchtanlage Alperstedt mit einer Biogasanlage, eine
Nahwärmeversorgung in der Gemeinde Schlöben oder eine Solargemeinde wie Viernau
müssen beispielgebend für diesen Prozess sein. Der Masterplan für die Energiewende wird
mit Leben erfüllt, wenn Städte und Gemeinden, wenn Stadtwerke, wenn Industrie- und
Landwirtschaftsbetriebe, wenn die öffentliche Hand und unsere Forschungsstätten, wenn
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, aber auch die gesamte Thüringer Wohnungswirt-
schaft gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern neue Wege gehen. Mit unserem Mas-
terplan wollen wir die Richtung aufzeigen und als neue Landesregierung zum Treiber dieser
Entwicklung werden.
1A: Einleitung
Die durch menschliches Handeln rasant voranschreitende Klimaveränderung, die zuneh-
menden Naturkatastrophen und die aktuell globale Krise der Weltwirtwirtschaft stellen uns
vor gewaltige Herausforderungen.
Im Juli diesen Jahres konstatierte der G 8-Gipfel in Italien, dass wir zu einem schnelleren
Umdenken hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs und einer besseren Nutzung neuer Tech-
nologien gezwungen werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren
und damit eine globale Umweltkatastrophe zu verhindern.
Die aktuelle Wirtschaftskrise bietet die große Chance, insbesondere in Maßnahmen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz und Möglichkeiten von Energieeinsparungen zu investieren.
Damit können neue Arbeitsplätze geschaffen und die mittelständische Wirtschaft sowie
Handwerksbetriebe erheblich gefördert werden. In Thüringen würde der Aufbau einer Ener-
giewirtschaft auf Basis erneuerbarer Energien die Chance bieten, eine ökologisch ausgerich-
tete Ökonomie zu befördern.
Die Folgen des Klimawandels und der weltweiten Verknappung der Energieressourcen er-
höhen zudem das Risiko bewaffneter Konflikte. Verschiedene Studien verweisen auf ein
Konfliktpotential und politische Instabilitäten durch Gewaltausbrüche und Kriege um die
Energieressourcen in über 50 Staaten mit etwa 4 Milliarden Menschen bis 2040.
Neue Formen der Energienutzung müssen schnellstens eingeführt und marktfähig gemacht
werden. Es gilt, unsere heimischen Potentiale umgehend zu nutzen. Die größte Energieres-
source, die wir gegenwärtig haben, ist die Energieeinsparung.
Dies ist Herausforderung und Chance zugleich. In Thüringen wollen wir sie nutzen, um neue
Produkte und Arbeitsplätze zu schaffen.
Deswegen steht im Zentrum dieses Masterplanes das „Große Energieeinsparkraftwerk Thü-
ringen 2009plus“.
Thüringen hat mit seinen natürlichen Potentialen und den langen Erfahrungen in der indust-
riellen Produktion und in der Wissenschaft gute Voraussetzungen, hier schnell zu reagieren.
Mit diesem Masterplan legen wir ein erstes Konzept vor, mit dem eine Weichenstellung für
die Entwicklung neuer Produkte und Arbeitsplätze schon in einer Legislaturperiode vorge-
nommen wird. Vor allem das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft werden davon
profitieren.
Unser Klima ist bedroht
Allein während der vergangenen Legislaturperiode sind in Thüringen durch klimabedingte
Unwetter Schäden in nie da gewesenem Maße entstanden. Ein Beispiel dafür ist der Orkan
„Kyrill“, der nach Experteneinschätzungen das stärkste flächendeckende Ereignis dieser Art
seit mehr als zwanzig Jahren darstellte und in Thüringen die schwersten Sturmschäden seit
mehr als 60 Jahren verursachte (Meteomedia, Forstbericht 2008). Erinnert sei aber auch an
das Elbehochwasser 2002 mit einer Gesamtschadensbilanz von 9,2 Mrd. Euro (Angaben:
Meteorologen der Unwetterzentrale Deutschland; Meteomedia, DWD). In Thüringen war der
Altenburger Raum besonders betroffen.
Wenn wir nicht in Umweltschutz investieren und unsere Lebens- und Produktionsweisen än-
dern, werden die zukünftig notwendigen Maßnahmen so teuer werden, dass wir sie nicht
mehr bezahlen können.
Die Ölreserven sind endlich
Im Sommer 2008 schoss der Erdölpreis auf neue Höchstwerte. 150
US-Dollar kostete auf den Rohstoffmärkten ein Barrel Erdöl (159 Liter). Der Preisanstieg des
Öls wirkte direkt auf die Konsumentenpreise: Lebensmittel, neue Autos, Industrie- und Kon-
sumgüter wurden schlagartig teurer, vor allem die Energiekosten stiegen in den letzten 5
Jahren um mehr als 100%. Hatte ein Haushalt mit einem jährlichen Energieverbrauch von
3.000 Litern Heizöl im Jahr 2003 noch eine Jahresrechnung von rund 1.000 Euro zu bezah-
len, so stiegen die Kosten für die Heizsaison 2008/2009 durchschnittlich auf etwa 2.400 Eu-
ro. Zudem ist mit einem weiteren Anstieg der Ölpreise zu rechnen, da die Fördergrenzen der
bestehenden Ölfelder weltweit spätestens in einigen Jahren erreicht sein werden.
2Die fossilen Energien sind endlich.
Die Energieversorgung der Bundesrepublik basiert derzeit zu etwa 85% auf fossilen Energie-
trägern. Öl liefert dabei mit 40% vom Gesamtverbrauch den größten Anteil; auf Stein- und
Braunkohle entfallen 25%, auf Gas 21%.
Bis zur Industrialisierung vor gut 200 Jahren beruhte unsere gesamte Energieversorgung auf
erneuerbaren Energien (Holz und Wind, Wasser- und Muskelkraft). Erst mit dem Beginn der
Industrialisierung wurden Kohle- und später Öl- und Gasvorräte in steigendem Maße ausge-
beutet. Heute besteht kein akuter Mangel an fossilen Energien, aber die Vorräte sind endlich.
Beim derzeitigen Verbrauch werden die bekannten Reserven in 40 Jahren (Erdöl) bis 260
Jahren (Braunkohle) erschöpft sein. Auch wenn neue Lagerstätten entdeckt werden, ändert
das nichts an der absehbaren Endlichkeit der fossilen Energien und ihrer relativen Knap-
pheit. Deshalb ist in Zukunft mit einem steigenden Preisniveau und in Abhängigkeit der welt-
weiten Wirtschaftslage auch mit stärkeren Preisschwankungen nach oben und unten zu
rechnen.
Die Atomenergie ist tödlich und unbezahlbar
Die Behauptung, Atomkraft sei sicher, wird allein schon durch die täglichen Berichte aus As-
se über die nicht mögliche Endlagerung des Atommülls Lügen gestraft. Das zeigt auch, dass
es kein Konzept zur Beherrschung dieser Technologie gibt.
Zudem ist nach den Unfällen in Harrisburg/USA und in Sellafield/Großbritannien, nach der
Katastrophe von Tschernobyl (1986), nach den Störfällen jüngst in Frankreichs Atomkraft-
werken und bei den Atomkraftwerken des Energieversorgers Vattenfall in Krümmel an der
Elbe sowie in Schweden eine neu aufgelegte Diskussion über eine verlängerte Nutzung der
Atomkraft unverantwortlich. Atomstrom ist in vielfacher Hinsicht ungeeignet, die Energiever-
sorgung der Zukunft zu sichern!
Die Atomenergie deckt derzeit bundesweit noch ca. 30% des Strombedarfs. Im Weltmaßstab
werden lediglich 6 Prozent des Primärenergieverbrauches der Menschen durch Kernenergie
gedeckt (Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Seite 168).
Neben den immensen Kosten der Kernenergienutzung verbieten das Risiko eines schweren
Reaktorunfalls sowie die ungelöste Entsorgungsfrage, die Atomtechnologie als Beitrag zu
einer nachhaltigen Energieversorgung zu zählen. Nicht beherrschbar ist das Risiko der mili-
tärischen Nutzung der für die Energieerzeugung entwickelten Kerntechnik.
Das Land Thüringen hatte viele Jahre lang die Folgen des Uranerzabbaus in den Wismutge-
bieten um Gera und Ronneburg zu tragen. Mit der Bundesgartenschau 2007 ist ein riesiges
Umweltsanierungsprojekt vollendet worden. Aus Abraumhalden wurden neue Landschaften.
Diese sollen auch künftig erhalten werden.
Aus all diesen Gründen will die LINKE eine Energieversorgung ohne Atomkraft. So schnell
als möglich sind deshalb die Potentiale zu nutzen, die uns die Sonne täglich frei Haus liefert.
Der Sonne gehört die Zukunft.
Das solare Angebot ist unbegrenzt
Die Sonne kann durch Solarthermie oder Solarstrom aus Photovoltaikanlagen direkt zur
Wärme- und Stromerzeugung genutzt werden. Indirekt wird sie durch Biomasse sowie Wind-
und Wasserkraft genutzt.
Die Solarstrahlung liefert mit hoher Zuverlässigkeit jährlich das 7.000fache des weltweiten
Energieverbrauchs. Allein in der Sahara fällt jährlich auf einem nur 200 km x 200 km-Quadrat
(also auf einer Fläche, die etwa doppelt so groß wie Thüringen ist) so viel Energie ein, wie
derzeit weltweit verbraucht wird. In der Bundesrepublik, wo die Sonneneinstrahlung etwa
halb so stark ist wie in der Sahara, beträgt die jährliche Sonneneinstrahlung aber immer
noch mehr als das 80fache des deutschen Jahresenergieverbrauchs. In Thüringen strahlt die
Sonne jährlich auf jeden Quadratmeter so viel Energie wie in 100 Litern Öl enthalten ist.
Wir wollen dieses Potential in Thüringen intensiver nutzen und deshalb sollen systematisch
Dachflächen öffentlicher Gebäude (Schulen, Verwaltungen, etc.) solartechnisch nutzbar ge-
macht werden. Mit heutiger Technik könnte auf diesen und privaten Dächern, verbunden mit
weiteren Flächen an Fassaden und technischen Bauten (Brücken, Lärmschutzwände, etc.)
etwa 20 Prozent des Strombedarfes in Thüringen solar erzeugt werden.
3Zusätzlich können die anderen regenerativen Energien (Wind, Wasser, Biomasse) ihre Bei-
träge für eine solare regenerative Energieversorgung unseres Bundeslandes leisten.
Für die LINKE stellt die Energiewirtschaft einen wichtigen Bestandteil öffentlicher Daseins-
vorsorge dar. Da Thüringen nicht über eigene Großkraftwerke verfügt, führt das Land etwa
zwei Drittel seiner notwendigen Elektroenergie ein. Die LINKE hält eine Verdopplung der Ei-
generzeugung bis zum Jahr 2020 für erforderlich und möglich.
Aus diesen Erwägungen heraus schlagen wir das dreidimensionale Maßnahmenpaket
für Thüringen vor
Die LINKE in Thüringen wird mit der Übernahme der Landesregierung nach der Landtags-
wahl im Herbst 2009 auf diese Situation mit einem dreidimensionalen Maßnahmenpaket
antworten:
1. dem Aufbau einer Energiewirtschaft auf Basis erneuerbarer Energieträger,
2. einem Großen Energieeinsparkraftwerk und
3. einer landesweiten Energiedienstleistungsstruktur, die einem Wirtschaftsförde-
rungsprogramm gleichkommt.
Integriert sind eine Landesenergieagentur, Beratungsservice zur Rekommunalisierung der
Energieversorgung, ein allgemeines Contracting sowie Projekte für eine Bürgerbeteiligung
beim Energiesparen.
Die Rekommunalisierung der Energieversorgung ist ein Markenzeichen der LINKEN.
B: Die solare Zukunft Thüringens 2030
Das Wuppertal-Institut legte 1998 ein solares Energieversorgungskonzept für Europa vor.
Danach gibt es keine prinzipiellen technischen oder finanziellen Hindernisse für eine solare
Vollversorgung (= 100% regenerativ).
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Fraunhofer Institut Solare
Energiesysteme (ISE) stellten 1997 ein solares Langfristszenario für Deutschland vor. Im Ok-
tober 2008 ist das neue BMU-Leitszenario von DLR u.a. veröffentlicht worden, das den lang-
fristigen Ausbau der regenerativen Energiequellen darlegt und die geplanten Effizienzsteige-
rungen berücksichtigt.
Analog zu diesen Szenarien sollen für Thüringen bis zum Jahr 2030 folgende Ziele erreicht
werden:
• Der Gesamt-Energiebedarf wird durch Einspartechnologien schrittweise um insgesamt
ca. 45 % gesenkt.
• Die erneuerbaren Energien werden deutlich ausgebaut und decken am Ende des Zeit-
raums 55 % des Bedarfs ab.
Der Ausbau der einzelnen erneuerbaren Energien erfolgt in unterschiedlicher Intensität:
Im Zeitraum bis zum Jahre 2015 werden Windenergie und Biomasse die höchsten Beiträge
erbringen. Thermische Kollektoren, Photovoltaik und Geothermie erreichen hohe Wach-
stumsraten, auch wenn ihr absoluter Beitrag noch gering bleibt.
Um das Jahr 2020 sollen nach diesem Szenario die Potentiale von Wasserkraft und Bio-
masse vollständig und die der Windenergie zu 50 % ausgeschöpft sein. Die direkte Nutzung
der Sonnenenergie (Kollektoren und Photovoltaik) erreicht erst 20 % des technischen Poten-
tials und wird daher erst nach diesem Zeitpunkt große Beiträge des Gesamtbedarfs abde-
cken. Insgesamt könnte zu diesem Zeitpunkt etwa ein Viertel des Primärenergiebedarfs
durch erneuerbare Energien abgedeckt werden.
Im Zeitraum von 2020 bis 2030 soll sich der Beitrag der erneuerbaren Energien etwa ver-
doppeln. Die wesentlichen Beiträge dazu liefern die Solarthermie, die Photovoltaik (PV) und
der Import solar erzeugten Stroms (aus PV- oder solarthermischen Kraftwerken).
Gerade die aktuelle Rezession eröffnet die Möglichkeit, mit großen Investitionen in eine
nachhaltige Energieversorgung einzusteigen, Klimaschutz zu betreiben, neue Arbeitsplätze
zu schaffen und die Belastung durch Energiekosten langfristig zu senken.
Thüringen hat bereits einen Spitzenplatz in der Solarproduktion. Solarkommunen, wie Vier-
nau und Kettmannshausen belegen, wie die Anwendung der Solartechnik funktionieren
kann. Unser Ziel ist, diese Modellprojekte zum Landesstandard werden zu lassen.
4Ziel der Energiepolitik einer neuen linken Landesregierung ist, mit diesem Masterplan die
Weichen dafür zu stellen, dass die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung über
die Produktion in den einzelnen Fertigungsschritten bis hin zur Nutzung in Thüringen reali-
siert wird.
1. Die eigene Energiewirtschaft auf Basis erneuerbarer Energieträger –
Handfeste , materielle Gründe verlangen erneuerbare Energieträger:
1.1. Szenario für eine Energiewende in Thüringen
Das Öko-Institut Freiburg zeigte schon 1980 in einer Energiewendestudie den Weg zu einer
Wirtschaftsweise, die durch erneuerbare Energien und die Nutzung von Energieeffizienz-
maßnahmen den Bedarf an Energiedienstleistung decken könnte. Später wurde dies durch
andere Studien bestätigt, wie z.B. durch den Bericht der Enquete-Kommission „Vorsorge
zum Schutz der Erdatmosphäre“ des 11. Deutschen Bundestages oder den Bericht „Faktor
Vier“ an den Club of Rome von E. U. v. Weizsäcker, A. Lovins und H. Lovins. Dieser Bericht
verheißt aufgrund der großen Effizienzpotentiale die Möglichkeit eines doppelten Wohlstan-
des bei einem halbierten Energieverbrauch.
Die hier vorgestellten Szenarien für den Einstieg in die solare Zukunft sollen 2010 durch eine
Sonnenenergiewirtschaftsstudie der Landesregierung speziell für Thüringen nochmals über-
prüft werden.
Sonnenenergie liefert Niedertemperaturwärme und Strom; der Ausbau von Wind- und Was-
serkraft deckt größere Anteile des Strombedarfs; Holz und landwirtschaftliche Abfälle liefern
Wärme und Strom. Hocheffiziente und damit umweltfreundliche Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen werden eingesetzt. Ziel ist der Umbau der Energieversorgung in Thürin-
gen bis zum Jahr 2030, um den Energiebedarf durch direkte Sonneneinstrahlung, Wind,
Wasser und Biomasse, verbunden mit den Einsparpotentialen decken zu können.
2. Großes Energieeinsparkraftwerk Thüringen 2009plus
Unsere kurzfristig größte und kostengünstigste Energieressource liegt im Energiesparen und
in Energieeffizienzmaßnahmen. Um eine erfolgreiche Solarstrategie zeitnah umzusetzen,
müssen genau diese Energieeinsparmaßnahmen ausgenutzt werden. Zwei einfache Beispie-
le verdeutlichen dies:
Der Stromverbrauch von Elektrogeräten in Büros und Haushalten durch Leerlauf bzw.
Standby-Betrieb beträgt bundesweit pro Jahr rund 20 Mrd. Kilowattstunden. Diese riesige
Menge entspricht ziemlich genau der Stromproduktion der vier Atomkraftwerke Obrigheim,
Stade, Biblis A und Brunsbüttel oder dem gesamten Stromverbrauch der Bundesländer
Saarland, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Schon heute ließe sich dieser Verbrauch
um über 80% senken, wenn die vorhandenen Geräte durch die marktbesten ersetzt würden.
Verzicht auf unnötiges Standby und neue technologische Entwicklungen könnten weitere
Reduzierungen bringen.
Deshalb werden bei der Beschaffung von Elektrogeräten der öffentlichen Hand nur Geräte
zum Zuge kommen, die minimale Standby-Verluste aufweisen. Zudem wird ein Programm
aufgelegt, um die Standby-Verluste in Haushalten und im gewerblichen Bereich bei den vor-
handenen Geräten zu minimieren.
Das zweite Beispiel betrachtet die Raumwärme:
Ein durchschnittliches Einfamilienhaus (mit 120 qm Wohnfläche) benötigt fürs Heizen und
Warmwasser ca. 30.000 kWh pro Jahr. Eine größere solare Warmwasseranlage (12 qm)
kann davon ca. 13 Prozent erzeugen. Um diesen Anteil deutlich zu steigern, sollte zunächst
durch eine gute Dämmung der Wärmebedarf abgesenkt werden: Bei einer Sanierung nach
KfW-40 Standard kommt das Haus mit ca. 5.000 kWh im Jahr aus. Eine 12qm-Solaranlage
deckt dann schon rund 50 Prozent des Bedarfs. Durch höhere Effizienz lässt sich also der
solare Anteil drastisch steigern. Eine solare Energiewirtschaft ist einfacher und kostengünsti-
ger umsetzbar, wenn die Energiesparpotentiale genutzt werden.
52.1. Solares Bauen
Ein Drittel vom Ganzen: Raumwärme
Dem Bereich Bauen und Wohnen kommt im Rahmen des Masterplanes besondere Bedeu-
tung zu, denn vom gesamten Endenergieverbrauch entfällt etwa ein Drittel auf den Bereich
der Raumwärme. Fürs Beheizen von Wohnungen, Büros, öffentlichen Gebäuden u. ä. wird
z.B. mehr Energie verbraucht als im gesamten Verkehrsbereich. Gleichzeitig gibt es vielfälti-
ge Techniken, die dafür benötigte Energie (Niedertemperaturwärme) durch eine bessere
Wärmedämmung und hocheffiziente Fenster sowie effiziente Heizungssysteme einzusparen
und einen größeren Teil des Restbedarfs solar zu erzeugen.
Altbaubestand energetisch optimieren
Angesichts der demografischen Entwicklung und leer stehender sowie unsanierter Altbauten
liegt unser vorrangiges Ziel bei der Verbesserung der Energieeffizienz vorhandener Ge-
bäude, weil hier die höchsten Einsparpotentiale bestehen.
Die Plattenbausiedlung in Leinefelde ist im Rahmen der EXPO 2000 zu Null-Energie-
Häusern umgebaut worden. Dieses Beispiel ist ein Muster, das wir gemeinsam mit der Thü-
ringer Wohnungswirtschaft und der Bauhaus-Universität Weimar zu einem Landeskonzept
weiterentwickeln werden.
Die LINKE wird Effizienztechnologien und die passive Solarenergienutzung durch spezielle
Komponenten wie z.B. Fenster, Glasvorbauten, Wärmedämmung sowie die transparente
Wärmedämmung nutzen und damit das lokale Handwerk besonders fördern.
Bei heutiger Wärmeschutzverglasung ergibt sich auf der Südseite eine positive Energiebi-
lanz. Die Solararchitektur nutzt dies, indem sie durch großflächige Südfenster den Energie-
bedarf der Häuser senkt.
Bei der transparenten Wärmedämmung (TWD) gelangt das Sonnenlicht relativ ungehindert
durch die Wärmedämmung hindurch auf eine Absorberschicht am Mauerkern. Dieser gibt die
Wärme mit einer gewissen Zeitverzögerung an den Innenraum ab. Durch die TWD wird die
Wand zu einer großflächigen Heizung.
Wir werden den Bau von hocheffizienten Häusern, die Passivhausstandard erlangen oder in
Plusenergiebauweise ausgeführt werden, systematisch fördern. Plusenergiehäuser liefern
mehr Energie (in Form von Solarstrom) als ihnen von außen (zum Heizen) zugeführt wird.
Für diese Haustypen und für die Altbausanierungen werden wir, wenn die Finanzkraft der
Eigentümer nicht ausreicht, Kredite oder Finanzmittel zur Verfügung stellen und zwar über
die Möglichkeiten eines Contractingmodells der neuen Landesenergieagentur, durch eine
Vorfinanzierung der Mehrinvestition durch Dritte und die Abzahlung der Investitionskosten
durch die eingesparten Energiekosten.
Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser sind durch bessere Wärmedämmung, dichtere
Fugen und kontrollierte Lüftung sparsam und verbrauchen etwa nur ein Viertel (Niedrigener-
giehäuser) bzw. ein Zehntel (Passivhäuser) dessen, was im statistischen Mittel für ein ent-
sprechend großes Haus benötigt wird.
In Thüringen soll energieeffizientes Bauen systematisch unterstützt werden Nullenergiehäu-
ser, Passivhäuser und sogar Plusenergiehäuser demonstrieren behagliches Wohnen nahezu
ohne konventionelle Heizung und finden heute zunehmend Anklang. Sie sollen beim Über-
gang ins Solarzeitalter durch den Masterplan zum Standard werden.
Solare Planung und Solararchitektur, wie z.B. Standortwahl und Orientierung des Gebäu-
des, Gebäudeform, Dachüberstand und Bepflanzung sollen Standard werden.
Das Beispiel des Dachüberstands über einem Südfenster erläutert einfache, kostengünstige
und wirksame Solararchitektur:
Dass sinnvolle Solarenergienutzung auch ohne viel kostspielige Technik möglich ist, zeigt
das Beispiel Dachüberstand: Im Winter gelangt die volle Sonne durch das Fenster in den
Wohnbereich und heizt diesen auf. Im Sommer wirkt der Dachüberstand als einfache, aber
effektive Regelung: Er sorgt dafür, dass die steile Sommersonne nicht ins Haus gelangt
6und verhindert so eine Überhitzung. Dies zeigt, wie traditionelle Bauformen der Architektur
die Sonne nutzen. Vieles davon geriet in Zeiten des billigen Öls in Vergessenheit. Für den
Einstieg ins Solarzeitalter ist es notwendig, diese Kenntnisse zu reaktivieren und im Zusam-
menhang mit neuen Materialien und Techniken zu nutzen.1
Solare Optimierung von Bebauungsplänen
Ein Bebauungsplan legt u. a. fest, welche Gebäude gebaut werden dürfen (freistehende Ein-
zelhäuser, Reihenhäuser, Geschosswohnungsbau,...), welche Abstände sie voneinander
haben müssen und wie sie ausgerichtet sein sollen (über Firstrichtung). Energetische Be-
trachtungen fanden bisher in den seltensten Fällen Eingang in diese Pläne. Heute ist es
möglich, schon im Planungsprozess den späteren Energieverbrauch und die passiv-solaren
Gewinne zu simulieren und damit die Pläne energetisch und solar zu optimieren.
Insbesondere drei Punkte sind dabei von Bedeutung:
Kompaktheit: Kompakte Gebäude verbrauchen grundsätzlich weniger Energie, weil sie bei
gleichem Volumen eine geringere Oberfläche und damit geringere Wärmeverluste haben.
Orientierung: Die Ausrichtung der Gebäude bestimmt, in welchem Umfang passive Solar-
energienutzung möglich ist. Bei Passivhäusern ist die optimale Südausrichtung noch bedeu-
tender.
Verschattung: In den Wintermonaten besteht der größte Heizwärmebedarf. Gleichzeitig
steht in dieser Zeit die Sonne tief, wodurch die gegenseitige Verschattung der Gebäude ans-
teigt, was wiederum die passive Solarnutzung vermindert.
Ob und in welchem Umfang aktive Solarsysteme eingesetzt werden können, hängt ebenfalls
vom Bebauungsplan ab. Insbesondere die Bestimmungen zur Ausrichtung von Dachflächen
legen wichtige Rahmenbedingungen fest. Auch die Option für eine ökologische Nahwärme-
versorgung (z.B.: Kraft-Wärme-Kopplung, Holzhackschnitzelheizung) wird durch Bestim-
mungen zu Einzel- vs. Sammelheizung im Bebauungsplan vorentschieden.
Solare und energieeffiziente Bauleitplanung steckt leider in vielen Kommunen noch in den
Kinderschuhen. Sehr oft werden Kostenfaktoren als Hemmnis angeführt. Darüber hinaus
werden die Festsetzungsmöglichkeiten, die das Baugesetzbuch bietet, zu wenig im Sinne
des Klimaschutzes genutzt. Daher wird die LINKE ein Rahmenkonzept für Kommunen als
Orientierungshilfe auf ihrem Weg hin zu klimagerechtem Bauen entwickeln.
Eine Gemeinde, die auf die energetische und solare Optimierung ihrer Bebauungspläne ver-
zichtet, handelt daher nicht nur unökonomisch, sondern verbaut auch eine wichtige Option
fürs Solarzeitalter. Hier wird landesweit ein Standard für solares Bauen gesetzt.
2.2. KWK mit der Industrie
Kraft-Wärme-Kopplung: Der unverzichtbare Baustein einer Energiewende
Die Stromerzeugung verursacht heute mehr als ein Drittel aller in der Bundesrepublik er-
zeugten Kohlendioxidemissionen. Hintergrund ist der geringe Wirkungsgrad, mit dem die
Brennstoffe in den Kraftwerken in Strom umgewandelt werden. Berücksichtigt man weiterhin
noch den Eigenstromverbrauch bei der Erzeugung sowie die Transportverluste im Strom-
netz, so kommt von der eingesetzten Primärenergie lediglich rund ein Drittel bei den
Kunden in der Steckdose an.
Die Alternative zu der herkömmlichen Stromerzeugung stellt die Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) dar. Bei diesem Stromerzeugungsverfahren wird die Abwärme genutzt, die bei der
herkömmlichen Stromerzeugung in Kondensationskraftwerken anfällt. Damit die Wärme-
energie für Heizzwecke in Wohngebäuden, Krankenhäusern oder auch Fabrikhallen genutzt
werden kann, ist eine kundennahe Erzeugung notwendig.
Der Gesamtwirkungsgrad einer KWK-Anlage liegt bei 85 bis 95 Prozent.
Die Kraft-Wärme-Kopplung ist aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades nicht nur unter ökologi-
schen Aspekten die deutlich bessere Lösung. Sie rechnet sich auch wirtschaftlich. Die LINKE
will den Anteil der KWK-Stromerzeugung in Thüringen weiter ausbauen. Bisher haben die
1
Beispiele dazu finden sich z.B. in den Internetportalen www.solarbau.de und www.energie-
projekte.de
7großen Verbundunternehmen in der Regel versucht, die Kraft-Wärme-Kopplung in den
kommunalen oder industriellen Kraftwerken zu verhindern, um ihre eigenen Absatzmöglich-
keiten auszudehnen.
Wir wollen die Abwärme dort, wo sie anfällt, nutzen wie beispielsweise bei den Glaswerken
oder dem größten regenerativen Stromkraftwerk, der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal in
Blankenstein (ZPR).
Zudem können sich regionale Netzwerke und Wertschöpfungsketten entwickeln. Beispiels-
weise wollen wir den Plan umsetzen, die Abwärme der Gärtnereisiedlung Erfurt für den
Gärtnereibetrieb zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit für eine konkrete Umsetzung bietet sich
im Industriegebiet Erfurter Kreuz an. Hier könnten die Betriebe gemeinsam mit den Stadt-
werken Arnstadt die Kraft-Wärme-Kopplung nutzen, statt eine neue Starkstromleitung zu
bauen.
Die Stromerzeugung wird zunächst nicht ohne fossile Kraftwerke auskommen. Gerade des-
halb ist es von besonderer Bedeutung, dass diese Kraftwerke möglichst effizient sind und
geringe Klimaschädigungen hervorrufen.
2.3. Der Landwirt als Energiewirt
Thüringen ist in weiten Teilen ländlich geprägt, Mehr als 80 Prozent seiner Flächen sind
Wald oder werden landwirtschaftlich genutzt. Die Entwicklung zu Bioenergieregionen ist
auch in Thüringen längst keine Vision mehr, sondern gelebte Realität. Dies soll andere zum
Nachahmen motivieren. Deshalb wird die Thüringer LINKE ein Programm auflegen, mit dem
die großen Potentiale ländlicher Regionen rund um die Bioenergie genutzt werden können.
Der Landwirt kann zunehmend zum Energiewirt werden: durch Bereitstellung und intelligente
Nutzung von Biomasse und anderer solarer Energien, verbunden mit der Einspeisung in
kommunale Netze. Damit werden zwangsläufig Arbeitsplätze im Handwerk, der Industrie und
in den Dienstleistungsbranchen geschaffen..
Biogas-Blockheizkraftwerk
Dem Landwirt als Betreiber von Biogasanlagen eröffnen sich interessante Perspektiven.
Wird nämlich mit dem Biogas ein Blockheizkraftwerk (BHKW, also ein Motor mit angeschlos-
senem Generator) betrieben, so dient die Abwärme des Motors zum Beheizen des Fermen-
ters sowie zusätzlich als Raumwärme zur Eigennutzung oder für eine Nahwärmeversorgung.
Durch den Betrieb eines biogasbetriebenen BHKWs kann ein Landwirt insgesamt deutlich
mehr Einnahmen bzw. Ersparnisse erzielen, als wenn er das Biogas nur zu Heizzwecken
nutzt. Ist im Umfeld nicht genügend Wärmebedarf vorhanden, so kann das Biogas auch in
das Gasnetz eingespeist werden und an anderer Stelle für die gekoppelte Strom- und Wär-
meerzeugung in einem BHKW genutzt werden.
Damit steigt auch das Interesse, weitere eigene landwirtschaftliche Reststoffe oder auch or-
ganische Abfälle von außen der Biogasanlage zuzuführen und so die Gas- und damit die
Stromproduktion zu steigern. Das wollen wir befördern.
Biogasbetriebene BHKWs weisen auch eine hervorragende CO2-Bilanz auf, weil Biogas
selbst CO2-neutral ist. Bei der Biomassenutzung wird das Klimagas Methan verbrannt, das
ansonsten bei der Verrottung der Biostoffe in die Atmosphäre abgegeben wird. Dies verbes-
sert die Klimabilanz des Biogas-BHKWs zusätzlich erheblich. Ein biogasbetriebenes BHKW
ist im Betrieb also nicht nur CO2-neutral, sondern es senkt die Emissionen von Treibhausga-
sen sogar absolut.
Zum zweiten kommt dem Biogas-BHKW im Rahmen einer solaren Energiewirtschaft beson-
dere Bedeutung zu: weil sich Biogas gut speichern lässt, kann der Betrieb eines Biogas-
BHKWs an den aktuellen Strombedarf gekoppelt werden und damit die Schwankungen
von Solar- und Windstrom in gewissem Umfang kompensieren.
Nahwärmesysteme mit Holzhackschnitzelanlagen
Große Chancen für eine rasche Ausweitung von Holz im Wärmemarkt bieten Nahwärmesys-
teme mit einem Holz-Heizkessel beispielsweise den Forstwirten. Gerade in dem Gebiet des
8Thüringer Waldes können hier einerseits die kurzen Wege kostensenkend wirken und ande-
rerseits einen Anreiz zu einer nachhaltigen Waldnutzung bieten.
In einem Neubaugebiet mit z.B. 100 Einfamilienhäusern wird ein Heizzentrum errichtet. Über
gut isolierte Rohrleitungen (Nahwärmenetz) gelangt die Wärme vom Heizzentrum zu den
Häusern, wo sie über Wärmetauscher an die Heizung oder Brauchwasseranlage abgegeben
wird. Eine solche Wärmeversorgung mit Holz ist heute die preisgünstigere Variante zu Öl-
oder Gas und produziert so gut wie keine CO2 – Emissionen.
2.4. Öffentliche Gebäude
Schulen, Freibäder, Finanz- und Polizeiämter, alle öffentlichen Gebäude und Anlagen wer-
den energieeffizient optimiert. Nach Angaben des Thüringer Liegenschaftsmanagements
(Energiebericht des Freistaats Thüringen 2005/6) befinden sich etwa 600 Immobilien in Lan-
deseigentum. Für diese wurde eine Bruttogrundfläche von rund 2 Mio. Quadratmetern ermit-
telt. Diese Zahl kann sicher nur als grobe Orientierung dienen, um festzustellen, über wel-
ches Potential an öffentlichen Gebäudeflächen, die energetisch zu sanieren sind, Thüringen
verfügt.
Die LINKE wird ein Landessanierungsprogramm entwickeln. Zur finanziellen Absicherung
der Energieeinsparmaßnahmen wird ein Landesfonds aus Mitteln des Landes, der Kommu-
nen und der Kreise eingerichtet. Auch alternative Finanzierungsformen, wie z.B. über Stif-
tungen, werden wir prüfen.
Schulen:
In den Schulen gilt es nicht nur die wirtschaftlichen Energieeinsparpotentiale und die Dach-
flächen solar zu nutzen, sondern neben den Lehrinhalten auch eine bewusste Haltung zum
sparsamen Energieumgang für die nächste Generation zu schulen.
Sogenannte "Solarfüchse", Schüler mit Wissen und Spürsinn für Energieverschwendungen
und Nutzung von regenerativen Energiequellen, werden als Multiplikatoren für eine effiziente
Energienutzung ausgebildet. Dies dient einer breiten Bewusstseinsbildung in der Bevölke-
rung für einen rationellen Umgang mit Energie, wirbt gleichzeitig für die erneuerbaren Ener-
gien und ist eine Investition in die Entscheidungsträger der Zukunft.
Jede Schule soll aus wirtschaftlichen, Klima schonenden und pädagogischen Gründen eine
Solaranlage erhalten, die über die Stromeinsparpotentiale und mit Hilfe des Contractingmo-
dells finanziert werden.
Jede Schule, die SchülerInnen wie auch die LehrerInnen werden mit nachhaltiger Klimapoli-
tik und Energieeffizienzpotentialen vertraut gemacht; schonende Klima- und Energiepolitik
werden Teil des Unterrichtsstoffs und der Ausbildungsprogramme.
Die 5 Millionen Watt-Schulsolar-Initiative
Die Grundidee der "5 Millionen Watt-Solar-Initiative" besteht darin, dass an 50 ausgesuch-
ten thüringischen Schulen pro Schüler 50 Watt solare Stromerzeugung installiert und 50 Watt
an der Beleuchtungsleistung eingespart werden soll. Pro Schüler entfallen damit insgesamt
100 Watt Leistung an herkömmlicher Stromerzeugung. Allein eine Schule mit ca. 1.000
Schülerinnen und Schülern kann so ein 100.000 Watt-Solar-Einsparkraftwerk errichten.
Das Wuppertal Institut in Kooperation mit dem Büro Ö-Quadrat in Freiburg hatte dieses Kon-
zept entwickelt und an Pilotschulen in NRW erfolgreich getestet.
Darüber hinaus wurde in den Projekten die Kooperation mit dem jeweiligen Energieversorger
gesucht und gefunden, wodurch die Wirkung der Projekte noch verstärkt werden konnte.
Die Realisierung dieser Projekte beruht auf der guten Wirtschaftlichkeit von Effizienzmaß-
nahmen sowie durch die günstigen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen: durch die
Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, sowie durch das Kraft-Wärme-Kopplung-
Modernisierungsgesetz. Zudem trägt die ökologische Steuerreform über höhere Strompreise
und eine Befreiung der Gassteuer für KWK-Anlagen zu einer besseren Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals bei.
9Die 10 Millionen Watt Thüringer Landes-Solarinitiative
Entsprechend der Schulsolarinitiative wird ein ähnliches Modell an 100 ausgesuchten öffent-
lichen Gebäuden (Finanz- und Polizeiämter, Kindergärten, Hochschulen, Krankenhäuser,
Altenheime, Rathäuser etc.) in Thüringen umgesetzt.
Das Große Energieeinsparkraftwerk Thüringen 2009plus ist die Kombination all dieser
Energieeffizienz und –einsparmaßnahmen. Nach Realisierung all dieser Projekte spätestens
zum Ende der Legislaturperiode, werden in Thürigen jährlich rund 1.000 Millionen Kilowatt-
stunden Strom sowie eine noch größere Menge an Wärmeenergie eingespart.
3. Die Landes-Energiedienstleistungsstruktur
3.1. Landesenergieagentur
Gesteuert wird die Effizienz- und Solarstrategie in Thüringen durch eine Landesenergieagen-
tur. Über sie und in Kooperation mit kommunalen Energieagenturen wird eine landesweite
Beratung stattfinden.
Die Landesenergieagentur unterstützt die effiziente Energienutzung im Wohnungsbau, för-
dert Energieeffizienzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und treibt Energieeffizienzmaß-
nahmen in den Kommunen voran.
Zusammen mit der Industrie und anderen geeigneten Akteuren soll die Kraft-Wärme-
Kopplung ausgebaut werden. Energiekonzepte und Fördermaßnahmen für die Kommunen
werden entwickelt. Insbesondere sollen BHKW- Anlagen gefördert werden.
Demonstrationsprojekte wie Plusenergiehäuser, Beleuchtungseffizienz im gewerblichen Be-
reich, effiziente Straßenbeleuchtung sowie der Einsatz modernster Technologien werden
durch die Landesenergieagentur gefördert.
In mehreren Kreisen und Kommunen Thüringens wurden bisher Energiekonzepte erarbeitet.
In weiten Teilen des Landes fehlt es aber an einer sinnvollen Abstimmung von Bedarf, Er-
zeugung und Verbrauch von Energie. Deshalb soll ein Energiekonzept für Thüringen Bedarf,
Erzeugung und Verbrauch optimal zusammenführen. Als ein sinnvolles Instrument wird dafür
ein Energiekataster für das Land erarbeitet.
Über die Landesenergieagentur sollen verstärkt Eignungsräume für die Erzeugung regenera-
tiver Energien und den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ausgewiesen werden.
Eine eigene Beratungsstruktur für die Wirtschaft, öffentliche Institutionen und einzelne Indivi-
duen wird eingerichtet. Die Landesenergieagentur wird über Energieeffizienzmaßahmen,
einzelne Produkte und Finanzierungsmodelle beraten. Für Unternehmen sollen abhängig
von ihrem Energiebedarf optimale Gewerbe- und Industrieflächen ausgewiesen werden kön-
nen. Das gesamte Potential wird sich an den Emissionsminderungszielen des Landes Thü-
ringen und eines neuen Energieeinsparungsgesetzes orientieren.
3.2. Wirtschaftsförderung und Finanzierungen
Die Stadtwerke und Sparkassen werden angehalten, einen eigenen Kapitalstock für Projekte
der Erneuerbaren Energien zu bilden. Durch die Thüringer Aufbaubank wird ein Fonds für
Kredite in Höhe von mehreren Millionen Euro aufgelegt werden.
Existenzgründerprogramme sollen in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgelegt werden.
Viele Projekte und Maßnahmen, die auch wirtschaftlich interessant sind, werden aber über
Bürgerbeteiligungs- oder Contracting-Modelle finanziert werden können. Genossenschaftli-
ches Eigentum wird künftig eine größere Rolle spielen.
Mit Vertretern der Wohnungswirtschaft, also mit den Kommunalen Wohnungsgesellschaften
und den Wohnungsgenossenschaften sowie den Mietern wollen wir Solargemeinschaften in
Bürgerhand ermöglichen.
Die Kommunen sollen bei den anstehenden Neuverhandlungen der Energie-
Konzessionsverträge mit dem Ziel unterstützt werden, dass eine Re-Regionalisierung der
Energiepolitik umgesetzt werden kann.
Wir wollen die Stadtwerkebeteiligung der Kommunen an der Energieversorgung sichern und
wenn möglich verstärken. Die LINKE steht für die Rekommunalisierung der Energieversor-
gung. Gerade im Zusammenhang mit den Klimarisiken wurde offenbar, dass die Kommunen
der geeignete Ort sind, um über eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik vor Ort zu entscheiden.
Konzeptionell wird dies über die Landesenergieagentur vorbereitet und gesteuert.
1Contracting: Klimaschutz als Kapitalanlage
Contracting – was ist das?
Contracting ist ein Dienstleistungskonzept und Drittfinanzierungsmodell, das auf die Effi-
zienzsteigerung von Energieerzeugungs- und Energienutzungsanlagen abzielt. Wie funktio-
niert so ein Contracting-Modell? Will zum Beispiel eine Gemeinde aufgrund eines leeren
Kommunalhaushaltes anstehende Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz eines
Gebäudes nicht in eigener Regie durchführen, so kann die Gemeinde einen Dienstleister,
den Contractor, einbinden. Dieser liefert die Energiedienstleistungen, (z.B. die Wärmever-
sorgung der Schule, die solare Warmwasseranlage für Turnhalle, die Lüftung, die Beleuch-
tung und andere mit der Energieversorgung zusammenhängende Dienstleistungen) aus ei-
ner Hand. Hierzu plant er zunächst alle relevanten technischen Anlagen in einer Weise, dass
sie im späteren Betrieb möglichst wenig Energie- und sonstige Betriebskosten verursachen:
Die Leistungen des Contractors (Planung, Ausführung, Finanzierung der Anlagen, Betreuung
der Anlage während des Betriebs) finanzieren sich aus den eingesparten Energie- und Was-
serkosten. Die Gemeinde hat demnach keine zusätzlichen Kosten zu tragen.
Im Juli 1999 konnte das erste, über Bürgercontracting finanzierte Einsparkraftwerk in der
Bundesrepublik eingeweiht werden.
Das vom Öko-Institut initiierte und in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme (ISE) entwickelte Projekt „ECO- Watt“ basiert auf der Erkenntnis, dass ra-
tionelle Energienutzung in einem weiten Bereich wirtschaftlich ist.
Pilotprojekt war die Staudinger Gesamtschule in Freiburg. Rund 100 Investoren, darunter
viele Eltern und Lehrer der Staudinger Gesamtschule, waren an dem Projekt beteiligt.
Die Investitionen in Höhe von rund 280.000 Euro, die u. a. eine neue Beleuchtungsanlage,
geregelte Umwälzpumpen, eine effizientere Heizungs- und Lüftungssteuerung sowie zwei
Solaranlagen, ein modernes Lastmanagement und Wassersparmaßnahmen umfassten,
wurden von der eigens hierzu gegründeten Gesellschaft ECO-Watt GmbH&CoKG (Staudin-
ger Gesamtschule) in Kooperation mit dem örtlichen Handwerk durchgeführt. Als Entlohnung
für die Investition erhielt die Gesellschaft von der Stadt Freiburg über einen Zeitraum von
acht Jahren die durch die Maßnahmen eingesparten Energiekosten.2
Das Projekt zeigt, dass Klimaschutz nicht teuer sein muss, sondern sogar eine ordent-
liche Rendite erbringt.
Nach acht Jahren Projektlaufzeit zieht der Geschäftsführer der ECO-Watt GmbH eine run-
dum positive Bilanz: Das erste Bürgerbeteiligungs-Einsparkraftwerk, das ECO-Watt Projekt
an der Staudinger Gesamtschule, hat sich für alle gelohnt: Für die Umwelt, für die Kapital-
geber, für die Schule und für die Stadt. In den acht Jahren konnten durch die Investitionen
der Bürger rund 5,4 Mio. Kilowattstunden Wärme eingespart werden, das entspricht einer
halben Million Liter Heizöl oder einer Treibstoffmenge, die ein durchschnittlicher Pkw benö-
tigt, um rund 200 mal um die Erde zu fahren.
Der Stromverbrauch wurde um über 1,4 Mio. Kilowattstunden reduziert. Auch beim Wasser-
sparen war das Projekt erfolgreich: Gegenüber dem Verbrauch vor Projektbeginn konnten
insgesamt 77 Mio. Liter Wasser eingespart werden. Um sich unter dieser Zahl etwas vorstel-
len zu können, haben die Schüler der Staudinger Gesamtschule ausgerechnet, dass ein 20 x
50 m großes Schwimmbecken 77 m tief sein müsste, um diese Wassermenge zu fassen.
Diese eingesparte Wassermenge würde auch ausreichen, um 500.000 Badewannen zu fül-
len.
Neben dieser positiven Umweltbilanz haben sich Schule und Kapitalbeteiligte an dem wirt-
schaftlichen Ergebnis des Projektes erfreut: Das eingesetzte Kapital konnte mit 6% ver-
zinst und an die Kapitalgeber zurückbezahlt werden.
Die Schule hat gleichfalls von dem Einsparerfolg profitiert. Insgesamt konnten aus den Erträ-
gen des Einsparkraftwerkes der Staudinger Gesamtschule 79.000 Euro zur freien Verfügung
gestellt werden. Von diesen Mitteln konnte die Schule beispielsweise eine Theaterausrüs-
2
Nähere Informationen: www.eco-watt.de
1tung, Lautsprecher für die Schülerband, eine Schnursense für die Garten-AG, Ausstattungen
für das Werkspielhaus und eine weitere Photovoltaik-Anlage anschaffen.
Klimaschutz ist also keineswegs teuer oder unbezahlbar. Im Gegenteil: es lohnt sich, Geld
in effizientere Heizungs- oder Beleuchtungstechnik zu stecken.
3.3. Rekommunalisierung der Energieversorgung
Die LINKE will die Stadtwerkebeteiligung für die Kommunen sichern! Ziel eines möglichen
Verkaufs von E.on-Anteilen ist, diese für die Rekommunalisierung der Energieversorgung zu
nutzen. Die LINKE im Thüringer Landtag hat bereits die alte Landesregierung aufgefordert,
die Stadtwerkebeteiligungen zu sichern. Einzelne Stadtwerke haben Interesse signalisiert,
solche Anteile zurückzukaufen. Diese Beteiligungen könnten z.B. auf die kommunale Ener-
giebeteiligungsgesellschaft (KEBT) übertragen werden. Die neue linke Landesregierung Thü-
ringens wird die dazu notwendige Finanzierung über die Thüringer Aufbaubank sicherstellen.
3.4. Die Stromnetze
Die Stromnetze stellen monopolistische Machtfaktoren in den Händen der Energieversorger
dar und müssen öffentlich kontrolliert werden. Die Landesenergieagentur wird einen Plan zur
Re-Regionalisierung der Stromnetze in Thüringen vorlegen.
Wir beabsichtigen die Gründung einer Landesgesellschaft zur einheitlichen Netzbewirtschaf-
tung unterhalb der Höchstspannungsnetze. Voraussetzung ist die Entflechtung der gegen-
wärtigen Netzstrukturen. Voraussetzung ist die Kooperation der Gemeinden, Städte und Be-
teiligten. Ziel ist eine einheitliche moderne Netzbewirtschaftung.
Durch die Rekommunalisierung und Dezentralisierung der Stromproduktion wird der Ausbau
der großen Überlandtrassen vermieden. Insofern sind die Initiativen des Widerstands (Vie-
selbach-Altenfeld) gegen den Ausbau weiterer Stromtrassen wie der 380-kV-Leitung im thü-
ringisch-bayrischen Grenzgebiet berechtigt und werden von uns unterstützt.
Marktmacht der großen Stromversorgungsunternehmen aufbrechen
Die Liberalisierung des Strommarktes führte zu einer weiteren Konzentration bei den Ener-
gieversorgern. VEBA und VIAG (Preussen Elektra) fusionierten1999 zur E.ON. RWE schloss
sich mit VEW zusammen. Im Jahr 2000 wurden (neben anderen Fusionen) aus EnBW und
den Neckarwerken Stuttgart Partnerunternehmen.
Eine Politik der Energiewende setzt dagegen auf Nutzung der lokalen Ressourcen und auf
dezentrale Kraftwerksstrukturen. Das erfordert mehr Verantwortung vor Ort und bietet
somit auch Raum für mehr Mitbestimmung. Die vorliegenden Daten für 2008 zeigen erfreuli-
cherweise, dass zunehmend Regenerativ-Kraftwerke in Thüringen von kleinen Firmen oder
Privatpersonen betrieben werden. Dies verdeutlicht auf der einen Seite das hohe Engage-
ment vieler Privater für den Einstieg ins Solarzeitalter und auf der anderen Seite die Blocka-
dehaltung, die bei manchen Energieversorgungsunternehmen (EVUs) nach wie vor besteht.
Von privater Seite wurde in den letzten Jahren vorrangig der Bau von Wind-, Solar- und
Biomasseanlagen vorangetrieben.
In Anbetracht der Pläne von e.on, seine Thüga-Anteile zu veräußern, muss das Land zu-
sammen mit Gemeinden und Stadtwerken kurzfristig ein Finanzkonsortium zum Erwerb der
Anteile gründen. Hier einzubeziehen sind die thüringischen Anteile der Stadtwerke (VUB) an
der Leipziger Gasversorgungsgesellschaft VNG. Mit Thüga und VNG gemeinsam könnten
wir ein mitteldeutsches Energiecluster in kommunaler Hand voranbringen. Daneben werden
wir Modelle wie „Energie in Bürgerhand“ sinnvoll auf Thüringen übertragen.
Unterstützung der Kommunen
In den Kommunen gilt es grundsätzlich, Energieeffizienzmaßnahmen voranzutreiben. Die
Landesenergieagentur soll hier beratend und unterstützend wirken.
Anschubfinanzierung und Förderkontinuität sind notwendig
Da einige Formen der erneuerbaren Energien bei den heutigen Energiepreisen wirtschaftlich
noch nicht konkurrenzfähig sind, ist für den Einstieg ins Solarzeitalter eine gezielte Förderpo-
1litik unumgänglich. Nur durch eine breite Anwendung der neuen Techniken werden Kosten-
senkungspotentiale erschlossen und Impulse für die Weiterentwicklung gesetzt.
Der Kontinuität der Förderung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn nur wenn
diese gesichert ist, sind Hersteller zu langfristigen Investitionen bereit, werden günstige Ver-
triebswege aufgebaut, schulen Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter und senken so Montage-
zeiten, entstehen Rationalisierungseffekte bei der Fertigung und fließen die praktischen Er-
fahrungen aus breiter Nutzung in die Weiterentwicklung ein.
Eine derartige selbsttragende Entwicklung wurde in den 90er Jahren nur bei der Wind- und
Solarenergie erreicht. Es muss das Ziel einer Förderpolitik sein, dieses auch bei den ande-
ren erneuerbaren Energien sowie bei der Energieeffizienz einzuleiten und zu sichern.
Hierfür wird ein eigenes Landesförderprogramm aufgelegt werden.
3.5. Unterstützung von Einzelmaßnahmen
Energieeffizienz und Solarenergie im Mietwohnungsbau
Große und kostengünstig zu erschließende Potentiale für Energieeffizienz und Solarwärme
liegen bei den Mehrfamilienhäusern und im Mietwohnungsbau.
Größere Mehrfamilienbauten bieten günstige wirtschaftliche Ausgangsbedingungen für eine
Sanierung durch optimale Wärmedämmung, effiziente Fenster und kontrollierte Lüftung mit
Wärmerückgewinnung.
Größere Kollektorflächen führen zu geringeren Kosten pro kWh Solarenergie, viele Nutzer
sorgen für einen kontinuierlicheren Bedarf, der die Anlagen besser auslastet und somit den
nutzbaren Energieertrag pro m2 Kollektorfläche steigert.
Über die bereits erwähnten Existenzgründerprogramme können hier Gründungen von So-
larwärme-Service-Gesellschaften unterstützt werden.
Die Landesenergieagentur wird hier beraten und unterstützen, aber auch weitere Maßnah-
men wie eine Novellierung des Ordnungsrechtes vorschlagen, indem Bauherren Auflagen
unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Berliner oder anderen Solaranlagenverord-
nung in puncto Solarnutzung gemacht werden.
Solarstrom-Gemeinschaftsanlagen
Mit dem Geld vieler interessierter Anteilseigner werden an guten Standorten große Solar-
stromanlagen errichtet und finanziert.
Die Landesenergieagentur unterstützt hierbei die interessierten AnteilseignerInnen, Solarfir-
men oder treuhänderische VerwalterInnen. Durch neue Solarstrom-Gemeinschaftsanlagen
sollen zusätzliche Investitionen nach Thüringen geholt werden.
3.6. Weitere Programme in Kommunen und beim Land Thüringen
Ein ganzes Bündel weiterer Programme zur Solar- und Wirtschaftsförderung durch die neue
linke Landesregierung mit kommunaler oder landesweiter Wirkung sind möglich:
- 10.000 neue Kunden können durch qualifizierte Beratung gewonnen werden,
- das Energiesparen wird in die Breite getragen,
- die Bürgerberatung soll umsonst und damit wirtschaftsfördernd sein,
- durch Beratungsleistungen und Direktinstallationsmaßnahmen sowie Prämien für den
Einsatz hocheffizienter Kühlgeräte können Hartz-IV-Haushalte Energiekosteneinspa-
rung von jährlich bis zu 200 Euro erzielen,
- Gewerbe und Industrie können bei Energieeffizienzmaßnahmen unterstützt werden,
- Kommunal- und Landesbeamte könnten für Solarinvestitionen besondere Kredite er-
halten, etc.
Förderung der Windkraft – Windkraft im Aufschwung
Noch zur Jahrhundertwende 1900 arbeiteten in Deutschland ca. 18.000 traditionelle Wind-
mühlen. Das Mahlen von Mehl war eine ihrer Hauptaufgaben. Diese Mühlen wurden bald
durch Elektroantriebe verdrängt.
Erst in den achtziger Jahren begann das Kapitel der modernen Windkraftnutzung: Dabei ging
es nicht mehr um mechanische Antriebe, sondern um die Stromerzeugung.
1Durch die weiterentwickelte Windenergietechnik sowie die Serienproduktion der Anlagen
wurde der Strom aus Windkraft seit 1990 um mehr als die Hälfte billiger.
Bis zum Jahr 2030 sollen in Thüringen 30 Prozent des Strombedarfs durch die Windenergie
abgedeckt sein. Neue, ertragreichere Windkraftwerke reduzieren die Anzahl der vor zehn
Jahren gebauten Anlagen bei gleicher Stromproduktion auf zwei oder drei Anlagen.
Die Windkraftanlagen produzieren in Deutschland heute wesentlich mehr Strom als die Was-
serkraft, die bislang die ergiebigste regenerative Energiequelle war.
Hersteller von Windkraftanlagen, Zulieferer und Windkraftprojektierer in Deutschland haben
in den letzten Jahren rund 80.000 Arbeitsplätze geschaffen, viele davon in kleineren und
mittelständischen Unternehmen. Nach der Automobilbranche ist die Windindustrie mittlerwei-
le der zweitgrößte Kunde der deutschen Stahlwerke.
Arbeitsplatzsicherung durch Export der Windanlagen
Die absehbar in der Autoindustrie wegfallenden Arbeitsplätze können durch eine Expansion
im Windenergiemarkt teilweise aufgefangen werden.
Auch international gesehen kann die Windenergie in den letzten Jahren auf einen starken
Aufschwung zurückschauen. Neben den Märkten in Europa weisen vor allem die USA, In-
dien und China starke Zuwächse auf.
Während die deutschen Hersteller auf dem einheimischen Markt, der bis zum Jahr 2007
weltweit den größten Markt für Windkraftanlagen darstellte, eine sehr gute Marktposition ha-
ben, bestehen auf den ausländischen Märkten noch Ausbaupotentiale.
Lediglich 14 Prozent des Weltmarktes außerhalb Deutschlands werden von der deutschen
Windenergieindustrie bedient. Hier wollen wir dazu beitragen, dass systematisch der beste-
hende, aber noch nicht entwickelte Zweig der Exportindustrie in Thüringen ausgebaut wird.
Eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Markteinführung von Technologien kann ent-
scheidende ökonomische Vorteile für Industrie und Handwerk bringen: Der technologische
Vorsprung stärkt die Position auf internationalen Märkten und erhöht die Exportmöglichkei-
ten. Zudem ist eine solche Entwicklung geeignet, die einseitige Abhängigkeit vom Inlands-
markt zu reduzieren.
Förderung der Wasserkraft – Wasserkraftpotentiale
Wasserkraft war bis zum Jahr 2003 die bedeutendste regenerative Energiequelle in der
Bundesrepublik. In Thüringen liegen hier noch mögliche Ausbaupotentiale für die Energie-
produktion.
Die Potentiale für neue große Wasserkraftwerke sind fast vollständig ausgeschöpft. Aller-
dings kann bei den bestehenden Anlagen durch eine Modernisierung in der Regel noch eine
deutliche Leistungssteigerung erzielt werden.
Ein echtes Ausbaupotential gibt es noch bei den Kleinwasserkraftwerken. Der Bundesver-
band der Deutschen Wasserkraftwerke e.V. (BDW) schätzt, dass durch den Ausbau der
Kleinwasserkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu 5 MW die Stromerzeugung aus Klein-
wasserkraftwerken um etwa 50 % gesteigert werden kann.
Doch nicht nur durch die Wiederinbetriebnahme alter Anlagen lässt sich die Energiegewin-
nung aus Wasserkraft steigern. Technische Verbesserungen sind auch bei alten Wasserrä-
dern und Turbinen möglich.
Förderung der Geothermie
Im Erdinnern sind unvorstellbare Energiemengen gespeichert: Über 99% des Erdvolumens
sind heißer als 1000 oC. Deshalb nimmt die Temperatur in der Erde bei steigender Tiefe
ständig zu, in Mitteleuropa sind das ca. 3 Grad pro hundert Meter Tiefe. Diese Erdwärme
(Geothermie), die aus dem Erdinneren durch einen ständigen Wärmestrom Nachschub er-
hält, lässt sich auf unterschiedliche Art zur Energieversorgung nutzen.
Voraussetzung für den Betrieb geothermischer Heizzentralen sind entsprechende Thermal-
wasservorkommen. Solche finden sich in Deutschland vor allem im norddeutschen Becken
(nördlich der Mittelgebirge). In den Thüringer Bergbaustandorten soll die Möglichkeit, Tem-
1Sie können auch lesen