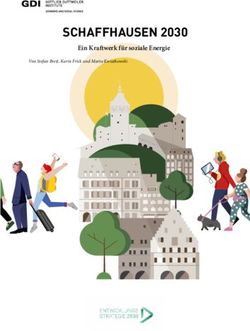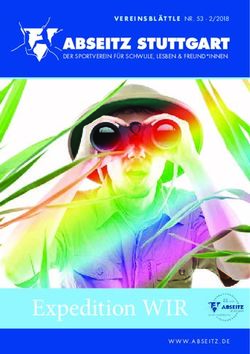Der Wolf im Hundepelz - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Wolf im Hundepelz
Wie viel Wolf steckt in unseren Haushunden?
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
einer Magistra der Naturwissenschaften
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Viktoria EDERMAYER, Bakk.phil.
am Institut für Biologie
Begutachterin: Dr. Cornelia Franz-Schaider
Graz, 2021Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die hier vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne
fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen
wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die
vorliegende Fassung entspricht dem elektronisch übermittelten Dokument.
Graz, 31.08.2021
Viktoria Edermayer
1Danksagung
An dieser Stelle möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und mich bei einigen Personen
bedanken, die mich während meines gesamten Studiums unterstützt haben und ohne die diese
Arbeit nicht zustande gekommen wäre.
Zuerst möchte ich mich bei meiner Betreuerin Dr. Cornelia Franz-Schaider bedanken. Danke
für die hilfreichen Tipps und die Geduld!
Besonders hervorheben möchte ich meine Familie, vor allem meine wundervollen Eltern, die
während meines ganzen Studiums immer an mich geglaubt haben und mir Kraft und Ausdauer
zum Endspurt geschenkt haben. Danke auch an meinen Partner Philipp, der mir immer mit
einem offenen Ohr und einer helfenden Hand zur Seite stand und mich auf meinem Weg
begleitet hat.
Zuletzt möchte ich auch meiner lieben Tante Margit danken, die immer ein Sonnenschein in
meinem Leben ist.
2Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ............................................................................................................................ 5
2. Der Wolf ............................................................................................................................. 6
2.1. Bedeutung für den Menschen ...................................................................................... 6
2.2. Morphologie ................................................................................................................ 7
2.3. Verhalten ..................................................................................................................... 7
2.3.1. Sozialverhalten ..................................................................................................... 7
2.3.2. Territorialverhalten ............................................................................................. 10
2.3.3. Fressverhalten und Ernährung ............................................................................ 11
3. Domestikation ................................................................................................................... 12
3.1. Historischer Überblick ............................................................................................... 12
3.2. Theorien zur Domestikation des Hundes................................................................... 12
3.3. Das Farm-Fuchs Experiment ..................................................................................... 14
4. Der Haushund ................................................................................................................... 15
4.1. Beziehung zwischen Mensch und Hund .................................................................... 15
4.2. Hunde als Einsatzpartner ........................................................................................... 16
4.3. Rassehundezucht ....................................................................................................... 16
4.3.1. Rahmenbedingungen der Hundezucht ............................................................... 17
4.3.2. Fédération Cynologique Internationale .............................................................. 17
4.3.3. Hundeausstellungen ........................................................................................... 20
4.4. Morphologie .............................................................................................................. 21
4.5. Verhalten ................................................................................................................... 26
4.5.1. Sozialverhalten ................................................................................................... 26
4.5.2. Territorialverhalten ............................................................................................. 28
4.5.3. Fressverhalten und Ernährung ............................................................................ 28
5. Der Wolf in unseren Haushunden ..................................................................................... 29
5.1. Aktuelle Forschungen ................................................................................................ 29
35.2. Hypothesen ................................................................................................................ 32
5.3. Methode ..................................................................................................................... 32
5.4. Stichprobe .................................................................................................................. 33
5.5. Ergebnisse .................................................................................................................. 34
6. Unterrichtseingliederung................................................................................................... 46
6.1. Relevanz des Themas im Lehrplan ............................................................................ 46
6.2. Stundenbild Unterstufe .............................................................................................. 46
6.2.1. Beschreibung der Einheit ................................................................................... 47
6.2.2. Ziele der Einheit ................................................................................................. 48
6.2.3. Stundenbild......................................................................................................... 48
6.2.4. Material .............................................................................................................. 48
6.3. Stundenbild Oberstufe ............................................................................................... 50
6.3.1. Beschreibung der Einheit ................................................................................... 50
6.3.2. Ziele der Einheit ................................................................................................. 51
6.3.3. Stundenbild......................................................................................................... 51
6.3.4. Material .............................................................................................................. 52
7. Zusammenfassung............................................................................................................. 56
Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 57
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. 60
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................. 61
Anhang ..................................................................................................................................... 62
Umfrage ................................................................................................................................ 62
41. Einleitung
Seit Jahrtausenden stellen Kaniden für uns Menschen ein verzauberndes Mysterium dar. Kaum
wohl gibt es in unserer Geschichte Wesen, mit denen wir uns mehr verbunden fühlen als mit
dem Wolf und später mit dem Hund in seiner domestizierten Form. Insofern brennt in
Forscher*innen die Frage, wie viel vom natürlichen, urtypischen Verhalten noch in unseren
Hunden manifestiert ist. Diese Fragestellung soll das zentrale Thema dieser Abschlussarbeit
sein.
In den kommenden Kapiteln wird zuerst auf den Wolf, seine Beziehung zum Menschen und
seine Verhaltensweisen eingegangen. Durch das Phänomen der Domestikation wird
beschrieben, wie es möglich ist, dass sich eine Spezies im Laufe der Zeit verändert und sich
von einer ursprünglichen Erscheinungsform in eine neue Art verwandelt: es entstand der Hund.
Hunderassen wurden in unserer Gesellschaft in unterschiedlichsten Erscheinungsformen und
mit variierenden Verhaltenscodes gezüchtet.
In unterschiedlichsten Arbeits- und Lebenssparten findet der Mensch im Hund einen Partner,
der ihn im Tun unterstützt und ihm zur Seite steht. Um die Fähigkeiten, Charakterzüge und
phänotypischen Merkmale des Hundes besonders an Bedürfnisse der Menschen anzupassen,
wurden Elterntiere sehr selektiv verpaart und die Rassehundezucht bis nahezu an ihre Spitze
getrieben.
Im Zuge dieser Arbeit wurde eine kleine eigene Forschung zum Thema Hunderassen und ihrer
Ähnlichkeit zum Wolf durchgeführt. Es wird untersucht, ob es bei Hunden einen rassebedingten
Unterschied in der Ähnlichkeit zum wölfischen gibt. Die Haupthypothese dazu lautet: Es gibt
Gruppen von Hunden, die dem Wolf ähnlicher sind als andere.
Dazu wurden ebenso drei Unterhypothesen zu drei ausgewählten Verhaltensaspekten
formuliert. Die drei Unterhypothese befassen sich mit spezifischen Verhaltensaspekten, wie
Sozialverhalten, Territorialverhalten und Fressverhalten.
In der Schule schürt der Hund bei Kindern in jedem Alter eine große Faszination. Besonders in
der Funktion als Lehrpersonen ist es unsere Aufgabe diese Faszination aufzugreifen und mit
Kindern intrinsisch motivierte Themen auszuarbeiten. Aus diesem Grund wird auch der
Abschluss der Arbeit aus einer Einarbeitung des Themas „Wolf“ in den Unterricht gebildet. Für
die Oberstufe, als auch für die Unterstufe finden sich abschließend Unterrichtsbeispiele und -
anregungen.
52. Der Wolf
2.1.Bedeutung für den Menschen
In der Geschichte der Menschheit sind Wölfe auf unterschiedliche Art und Weise präsent. Sie
sind sowohl ökologische Mitstreiter und Konkurrenten als auch ein wesentlicher Teil unserer
Mythen und Geschichten. Bereits in der Jungsteinzeit nahmen Menschen wahr, dass es ein Tier
in ihrem Lebensraum gab, das jagte wie sie, das fürsorgliche Familienpflege betrieb, Feinde
entschlossen bekämpfte und neugierig beobachtete was in der Menschenwelt vor sich ging.
Durch diese Ähnlichkeiten im Wesen wurde oftmals eine Seelenverwandtschaft gesehen.
Zwei bekannte Mythen rund um den Wolf halten sich bis heute in unserer Kultur. Zum einen
existiert der „Werwolfmythos“, in welchem sich ein Mann bei Vollmond in einen Wolf oder
eine wolfsähnliche Kreatur verwandelt. Zum anderen hält sich der Mythos, dass Wölfinnen
Menschen beziehungsweise verlorengegangene Menschenkinder aufnehmen und säugen, wie
in der bekannten Geschichte „Das Dschungelbuch“.
Neben den Mythen nehmen Wölfe in den verschiedensten Kulturen auch metaphorische
Sinnbilder ein. Wie etwa in Märchen „der große böse Wolf“ bis hin zur Wiedergeburt des
Teufels, der kaum zu bändigende, nordische Fenriswolf, Wölfinnen als Gründungsmütter
ganzer Nationen, oder auch als Verkörperung tapferer Kriegertugenden und Sinnbild einer
wilden, unzähmbaren Natur (vgl. Kotrschal 2012, S. 16).
Langsam aber sicher etabliert sich der Wolf wieder in unseren Ökosystemen. Im Jahr 2020
wurden 22 Tiere in Österreich gezählt, wobei man die Population auf etwa 40 Tiere schätzt. Im
Vergleich zu unseren Nachbarn ist diese Zahl jedoch noch sehr gering anzusetzen. Eines der
großen Probleme bei der Wiederansiedlung der Tiere liegt darin, dass Landwirte besorgt um
ihre Freilandherden sind. Sie befürchten schmerzhafte Verluste von Nutztieren aufgrund von
Wolfsangriffen. Als weitere große Gefahr wird das mangelhafte Management der
Wolfsbesiedlung beschrieben. Es werden gewisse Strukturen, ausreichend finanzielle Mittel
und geschultes Personal gefordert, um sowohl dem Wolf als auch den angesiedelten
Bewohner*innen das höchste Maß an Sicherheit zu bieten (vgl. WWF 2021, o.S.)
Fakt ist, dass es sich derzeit noch als sehr schwierig gestaltet den Wolf in Österreich wieder
anzusiedeln. Gesetzlich sind die Tiere zwar geschützt, jedoch verschwinden trotz jährlicher
Einwanderung von 5 bis 10 Individuen immer wieder viele Wölfe spurlos oder werden
überfahren oder aufgrund einer Verwechslung mit einem jagenden Hund erschossen (vgl.
Kotrschal 2012, S. 17).
62.2.Morphologie
Auch beim Wolf existiert weltweit eine große Anzahl an diversen Unterarten. In Österreich und
generell Europa ist jedoch der Graue Wolf (Canis lupus) die am häufigsten anzutreffende Art.
Der Graue Wolf wird bis zu 50kg schwer, misst eine Schulterhöhe von bis zu 95cm und eine
Rumpflänge von bis zu 150cm. Seine Körpergestalt ist gekennzeichnet durch eine quadratische
Form, was vor allem durch die langen Beine, welche er zur Fortbewegung über große Distanzen
benötigt, bewerkstelligt wird. Seine Rute ist 30cm bis 50cm lang und reicht ihm in etwa bis zur
Ferse. Der Wolf ist ein Zehengänger und kann durch seinen energiesparenden Laufstil
Streifzüge von bis zu 50km pro Nacht hinter sich bringen. Dabei erreicht er über kurze
Distanzen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 60km/h.
Die Ohren sind dreieckig angeordnet und ragen stehend nach oben. Die Fellfarbe bei
europäischen Grauwölfen ist graubraun mit verschiedenen hellen und dunklen
Farbschattierungen (vgl. Verein CHWolf 2021, o.S.)
2.3.Verhalten
Im Verhaltensaspekt spiegelt sich eine große Anzahl an verschiedenen Themen. Diese Arbeit
fokussiert sich allerdings auf drei spezifische Punkte, nämlich das Sozialverhalten, das
Territorialverhalten und das Fressverhalten.
2.3.1. Sozialverhalten
Wölfe leben in der freien Wildbahn in Rudeln, die meistens aus den Elterntieren und deren
Nachwuchs der letzten zwei bis drei Jahren bestehen. Im Laufe des zweiten Lebensjahres
wandert der nun selbständig und selbstsicher handelnde Nachwuchs des Rudels ab und macht
sich auf die Suche nach einem eigenen Revier. Dennoch wird das Rudel als ein sehr komplexes
und individuelles Sozialgefüge gesehen, in dem ebenso andere Familienkonstellationen
vorkommen können (vgl. Bloch 2013, S. 25f.).
Diese Arbeit fokussiert sich auf drei spezielle Aspekte des Sozialverhaltens: das Verhalten von
erwachsenen Individuen gegenüber Welpen, das Spielverhalten und der Umgang mit
Führungsposition und Dominanz.
7• Verhalten von erwachsenen Individuen gegenüber Welpen
Nicht selten wird in Diskussionen rund um Hundeartige der allseits bekannte Mythos des
„Welpenschutzes“ thematisiert. Welpen seien aufgrund ihres niedlichen Äußeren sicher vor
Attacken fremder Individuen. Bei Wölfen in freier Wildbahn ist es schwierig diesbezüglich
Annahmen aufzustellen, da es in unterschiedlichsten Forschungen keinen einzigen Fall gab, bei
dem sich ein fremder Wolf einem jungen Welpen bis ins Alter von etwa 5 Monaten nähern
konnte, da die Elterntiere dies nicht zuließen (vgl. Bloch, Radinger 2013, S. 131).
Innerhalb des eigenen Rudels gesteht man allerdings Welpen eine gewisse „Narrenfreiheit“ zu.
In ihren ersten Lebenswochen können Wolfswelpen mehr oder minder machen, was sie wollen
und finden durch Versuch und Irrtum heraus, was sie sich erlauben dürfen und was nicht. Erst
nach 6 bis 7 Wochen tauchen erste Tabus auf und die Welpen werden strenger maßgeregelt. In
der untenstehenden Abbildung 1 wird aufgezeigt, dass unerwünschtes Verhalten von Welpen
unter 8 Wochen eher ignoriert wird als von Welpen über 8 Wochen. Nach der 8. Woche, etwa
ab dem Zeitpunkt, wo die Welpen endgültig an feste Nahrung gewöhnt sind, müssen sie
Kommunikationsregeln lernen und sich an das Konzept der Erwachsenen gewöhnen (vgl. Bloch
2013, S. 42f.).
Abb.1: Verhalten von Wölfen gegenüber Welpen (In: Bloch 2003, S. 44).
• Spielverhalten
Das gemeinsame Spiel ist für Wölfe sehr wichtig und es hat eine Menge Funktionen, wie
beispielsweise Trainings- und Übungsfunktionen. Im Spiel wird etwa die Ausdauer enorm
gefördert, da es häufig zu einer Überforderung der Muskelapparate kommt. Außerdem werden
Gehirn, Herz und Kreislauf aktiviert. Besonders aber hat das Spiel eine soziale Funktion, da die
8Bindung gestärkt wird und es dadurch zu einer Verbesserung und Intensivierung der Dynamik
kommt. Darüber hinaus schöpft das Tier Selbstvertrauen aus einem harmonischen Spiel.
Wichtig ist, dass Wölfe nur in entspannten, ruhigen Lebensräumen spielen, in welchen sie sich
wohl fühlen. Ist dies der Fall, ist das Spiel vor allem durch eine Signalankündigung als
„Startschuss“ geprägt. Ein Wolf macht vor dem anderen einen Zick-Zack-Lauf, stellt den
Vorderkörper tief, schleudert den Kopf und rollt sich auf dem Boden. Diese Signale
unterstreichen auch den Willen zur Aufrechterhaltung der Spielstimmung (vgl. Bloch, Radinger
2013, S. 138).
• Führungsposition und Dominanz
Das Führungsverhalten innerhalb einer Wolfsfamilie ist sehr komplex. Zwar haben diese Rudel
bestimmte Leittiere, welchen gänzlich der Respekt der Gruppe gezollt wird, jedoch sind die
zeitweiligen Führungsaufgaben sehr variabel. Sogar jüngere Tiere des Rudels können
stellenweise Führungspositionen einnehmen (vgl. Bloch 2013, S. 59).
Wenn eine Situation gefährlich oder schlecht einschätzbar wird, sind es die Leittiere, die die
Entscheidungen treffen. In unverfänglichen Situationen geben sie die Führung jedoch auch
zeitweise ab. Die „Leitwolfkrone“ bleibt dabei allerdings unumstritten beim Leittier.
Um das Gruppengefüge zu stabilisieren müssen in einem Wolfsrudel Konflikte gelöst werden.
Deshalb müssen, je nach Situation auch klare Grenzen gesetzt werden, um die Dynamik zu
stabilisieren. Eine dieser Methoden ist der „Schnauzengriff“ (siehe Abbildung 2). Er wird als
eine verhaltenskorrigierende Maßnahme eingesetzt, wobei das Alttier mit geöffnetem Maul
über die Schnauze des jungen Wolfs stößt und diese kurz nach unten drückt (vgl. Bloch,
Radinger 2013, S. 119).
9Abb.2: Schnauzengriff als Erziehungsmaßnahme (In: Kotrschal 2012, S. 96).
Das Führungsverhalten innerhalb einer Wolfsfamilie ist sehr komplex. Zwar haben diese Rudel
bestimmte Leittiere, welchen gänzlich der Respekt der Gruppe gezollt wird, jedoch sind die
zeitweiligen Führungsaufgaben sehr variabel. Sogar jüngere Tiere des Rudels können
stellenweise Führungspositionen einnehmen (vgl. Bloch 2013, S. 59).
Wenn eine Situation gefährlich oder schlecht einschätzbar wird, sind es die Leittiere, die die
Entscheidungen treffen. In unverfänglichen Situationen geben sie die Führung jedoch auch
zeitweise ab. In Situationen, in denen ein Leitrüde als Beschützer fungieren soll, führt er den
Rest des Rudels dazu, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. In relativ entspannten Situationen
gibt er jedoch die Führung auch an jüngere Individuen ab. Beispielsweise lässt er Junghunde
im Winter den Vortritt, sodass sie eine Loipe für das Rudel anfertigen (vgl. Bloch 2013, S.
59f.).
2.3.2. Territorialverhalten
Wölfe sind sehr territoriale Tiere und sie bewachen und verteidigen ihr Revier intensiv. Im
Jagdrevier entdeckte Eindringlinge werden von Rudelmitgliedern sofort angegriffen,
verscheucht oder getötet. Entlang der Grenzen ihres Reviers setzen sie hochfrequentiert
Urinmarkierungen ab, um fremden Individuen zu verdeutlichen, dass dieses Gebiet besetzt ist.
Allein umherziehende Wölfe meiden diese Gebiete meist, denn die Angst vor der Stärke des
10Rudels nimmt die Überhand. Im Falle einer aggressiven Begegnung und einer einhergehenden
Verletzung lebt ein einzelner Wolf am Rande seiner Existenzmöglichkeiten (vgl Zimen 1992,
S. 290). Deshalb erscheint es klüger für ihn diese Gebiete zu meiden. Anders aber verhält sich
die Situation mit Tieren anderer Spezies. Wölfe sind in der Lage funktionierende
Zweckgemeinschaften mit anderen Tieren einzugehen. Eine dieser Zweckgemeinschaften ist
die Beziehung zwischen Wolf und Rabe. Im Laufe von Forschungen des Verhaltensbiologen
Günther Bloch und seinen Kollegen konnte festgestellt werden, dass dieselben Rabenfamilien
stets in unmittelbarer Nähe derselben Wolfsfamilien nisten, gemeinsam mit ihnen jagen und
anschließend wieder ins Nest zurückkehren.
Wölfe und Raben interagieren in ihrer Beziehung auf vielerlei Ebenen miteinander.
Beispielsweise verfolgen die Raben die Wölfe bis in ihr Nest und warten bis das Muttertier
Futter für den Nachwuchs hochwürgt, das die Raben ebenso vertilgen. Außerdem sind sie
Spielpartner. Sie toben und necken sich, etwa ziehen Raben die Wölfe provozierend am
Schwanz oder hüpfen vor der Schnauze herum. Raben bieten den Wölfen ein erhöhtes Maß an
Sicherheit, da sie durch ihre Warnrufe die Wölfe auf herannahende Feinde aufmerksam
machen. Raben sind von Natur aus sehr scheue Tiere. Wenn sie einen Kadaver finden, der nicht
vom Wolfsrudel getötet wurde, nähern sie sich diesem nur äußerst skeptisch. Wird jedoch ein
Tier vom Rudel getötet, stürzen sie sich ohne zögern auf das Tier und die Wölfe lassen sie
gewähren (vgl. Bloch, Radinger 2013, S. 13 ff).
Während Wölfe anderen Individuen gegenüber sehr feindselig gesinnt sind, reagieren sie auf
Menschen sehr scheu. Betreten Menschen ihr Territorium, überwiegt die Tendenz zur Flucht
(vgl. Zimen 1992, S. 291).
2.3.3. Fressverhalten und Ernährung
Wölfe sind wie beinahe alle Kaniden Schlingfresser und würgen große Futtermengen in sehr
kurzer Zeit hinunter. Sie sind wenig wählerisch in der Auswahl ihrer Nahrung und fressen so
gut wie alles, das ihnen vors Maul kommt (vgl. Zimen 1992, S. 236).
Bei großen Beuterissen, nehmen die Mitglieder eines Wolfsrudels eine gewisse Futterposition
ein, die sie auch verteidigen. Dabei kommt es im Normalfall allerdings nicht zu extremen
Auseinandersetzungen, sondern lediglich zu Knurren und Zähnefletschen. Tiere, mit denen ein
Rudel symbiotisch lebt, können sich gefahrlos an gleichen Kadavern bedienen. Fremde Wölfe
werden mit viel Feindseligkeit empfangen und sofort vertrieben (vgl. Bloch, Radinger 2013, S.
240).
113. Domestikation
Bis dato existieren viele Hypothesen und Theorien wann, wo, warum und wie Menschen und
Hunde zusammengefunden haben. Es ist jedoch sehr schwierig diesen komplexen Prozess
nachzuvollziehen, weshalb dieses Wissen derzeit noch sehr lückenhaft ist.
Mittlerweile herrscht in der Forschung Einigkeit, dass nicht der Kojote oder Schakal als
Stammvater unserer Haushunde gilt, sondern der altweltliche Wolf. Jedoch gibt es große
Unterschiede in den Theorien zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort diese Domestikation
stattgefunden hat und darüber, wie viele einschneidende Ereignisse daran beteiligt waren,
welche die Domestikation ausgelöst beziehungsweise begünstigt haben (vgl. Sommerfeld-Stur
2016, S. 21f.).
3.1.Historischer Überblick
Aus der gemeinsamen Geschichte erklärt sich, dass der Hund einen herausragenden
Sozialpartner für den Menschen darstellt. Viele Knochenfunde bestätigen, dass Homininen und
Wölfe schon lange in einem Sozialgefüge leben und die frühesten gemeinsamen Funde werden
auf ein Alter von 400.000 Jahre datiert. Die ältesten gesicherten Funde von Hundeknochen sind
14.000 Jahre alt und wurden in Bonn-Oberkassel entdeckt. Dies gilt vor allem deshalb als
bemerkenswert, da vergleichsweise das Schaf als eines der ältesten Haustiere des Menschen
vor etwa 7000 Jahren domestiziert wurde.
Anhand aktueller genetischer Daten konnte festgestellt werden, dass die Nahbeziehung
zwischen Mensch und Hund, beziehungsweise Wolf, über 20.000 bis sogar 100.000 Jahre
besteht. Zu dieser Zeit verließen Homo sapiens in mehreren Schüben Afrika und breiteten sich
über die ganze Welt aus. Auf ihrem Weg kamen unsere Ahnen möglicherweise zuerst im Gebiet
des Nahen Ostens oder im eurasischen Raum mit Wölfen in Berührung und so begann der
gemeinsame Schicksalsweg (vgl. Kotrschal 2004, S. 57f.).
3.2.Theorien zur Domestikation des Hundes
Eine der Hauptfragen im Zusammenhang mit der Domestikation des Wolfes ist die Frage nach
der Initiative. War es der Mensch, der den Wunsch verspürte einen Wolfswelpen als
12Gesellschafter mit nach Hause zu nehmen oder waren es Wölfe, die ihre Scheu gegenüber den
Menschen abgelegt hatten und zahm in bewohnte Siedlungen gezogen sind, um
Nahrungsmittelreste zu verzehren. Das Ehepaar Ray und Lorna Coppinger stellte diesbezüglich
eine nachvollziehbare Theorie auf und formulierte im Zuge dessen die „Scavenger-Hypothese“.
Sie besagt, dass die Initiative der Annäherung vom Wolf ausging, als die Menschen anfingen
sesshaft zu werden und die Wölfe sich als Abfallverwerter den Siedlungen näherten. Als
Nomaden konnten die Menschen ihre Abfälle stets zurücklassen, durch die Sesshaftwerdung
jedoch, mussten sie im direkten Umfeld der Behausungen entsorgt werden, was wiederum wilde
Tiere direkt in ihrer unmittelbaren Umgebung anlockte. Der Vorteil für die Menschen lag neben
der Abfallbeseitigung darin, dass die zahmen Tiere Plagen wie zum Beispiel Ratten dezimierten
oder vertrieben. Somit profitierten beide Parteien von der Annäherung und es entstand eine
Symbiose (vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S. 24).
Die ersten Partnerschaften zwischen Hunden und Menschen brauchen allerdings frühe
Sozialisierung. Wolfswelpen wurden von Hand aufgezogen und an der Brust von stillenden
Müttern gefüttert. Waren diese Welpen jünger als drei Wochen, wurden besonders gute
Ergebnisse in Hinblick auf die Zahmheit erwartet. Noch heute werden in Teilen Afrikas und
Neuguineas Hundewelpen so aufgezogen und gefüttert (vgl. Kotrschal 2004, S. 59).
Damit die ersten Hunde die Intention hatten, sich den Menschen zu nähern, bedurfte es einer
grundsätzlichen Änderung bestimmter Voraussetzungen. Eine davon war, dass die Änderung
des Verhaltens genetische Auswirkungen hatte. Es manifestierte sich die Annäherung an den
Menschen, welche sich durch Zahmheit und das sukzessive Ablegen von Scheu bemerkbar
machte, im Genom der Tiere, was zu einer genetischen Varianz zur Ausgangspopulation führte
(vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S.24).
Die Domestikation dieser ersten Hunde ist nicht als ein universales Ereignis zu sehen, sondern
eher als ein fortlaufender Prozess, in welchem es auch immer wieder Rückkreuzungen mit dem
Wolf gab. Dies führte zu einer besonderen genetischen Vielfalt und einer speziellen
Durchmischung des Genpools. Dabei handelte es sich hauptsächlich um weibliche Hunde,
welche von männlichen Wölfen gedeckt wurden.
Im Laufe der Zeit ergab sich durch das Zusammenleben der zwei Spezies eine Reihe von
gegenseitigen Anpassungen. Die Co-Evolution führte auf biochemischer Basis zu einer
beidseitigen Veränderung des Serotonintransporters und einem Glutamatrezeptors, welche
beide im Bereich der Aggressionssteuerung eine tragende Rolle spielen. Den Spezies fiel es
zunehmend leichter sich gegenseitig zu verstehen, was zu einer leichteren ganzheitlichen
Kommunikation führte. Vor allem die Deutung der Körpersprache ist ein herausragendes
13Merkmal, das neben Hunden auch noch Katzen vorbehalten ist. Diese zwei Spezies sind die
einzigen, welche menschliche Zeigegesten beziehungsweise Blicksignale richtig verstehen und
interpretieren können (vgl. ebd. 2016, S. 25f.).
Eine weltberühmte Veranschaulichung wie der Mensch auf den Hund kam, beziehungsweise
wie Domestikation über eine kurze Zeitspanne stattfinden kann, bietet die experimentelle
Forschungsarbeit des Biologen Dmitri Beljajew.
3.3.Das Farm-Fuchs Experiment
Der sowjetische Biologe Dmitri Beljajew hat vor etwa 60 Jahren ein Experiment gestartet, in
welchem er prüfen wollte, ob sich Silberfüchse ebenso domestizieren lassen wie einst der Wolf.
Sein Ziel war es, biologische Mechanismen herauszufiltern, welche bei der Zähmung wilder
Tiere zum Vorschein kommen.
Das große grundlegende Hindernis, dem Beljajew gegenüberstand, lag darin, dass zu dieser
Zeit die falschen Theorien von Trofim Lyssenko vorherrschten. (vgl. Taschwer 2018, o.S.).
Lyssenko war sowjetischer Agrarwissenschaftler und wurde durch die großzügige
Unterstützung von Stalin zu einer wichtigen Schlüsselfigur in der Biologie. Seine
Forschungsarbeit führte jedoch wider Erwartens zu enormen Katastrophen in der Genetik und
in der Landwirtschaft. Lyssenko stützte seine Methode, welche er „Vernalisation“ nannte, auf
die Theorie der Vererbung von erworbenen Eigenschaften und er lehnte jene Theorien seiner
westlichen Forschungskollegen, wie etwa die von Gregor Mendel oder von August Weismann,
ab. Mit unter behauptete er, dass Winterweizen schon im Frühjahr reif werden könne, wenn die
Samen längere Zeit bei niedrigen Temperaturen gelagert werden. In der Landwirtschaft wirkte
sich diese Theorie fatal aus und führte schließlich zu Missernten, die Millionen von Menschen
verhungern ließen (vgl. Taschwer 2016, o.S.).
Zur Blütezeit Lyssenkos mussten Wissenschaftler*innen, welche gegen die Theorien von
Stalins Schützling arbeiteten jedoch sehr vorsichtig vorgehen. Aus diesem Grund führte
Beljajew sein Experiment als Nebenprodukt der Züchtungen einer Pelztierfarm durch.
Charakterisiert wird der Forschungsvorgang bis heute durch die Selektion der zahmsten
Silberfüchse, welche im weiteren Verlauf zur Zucht eingesetzt werden.
Etwa zehn Prozent der sozialsten Tiere werden ausgewählt.
In den ersten Generationen gab es zunächst keine bedeutenden Veränderungen. Die Füchse
blieben aggressiv und angriffslustig sobald sich Menschen näherten. Bis zu einem
14forschungsverändernden Tag im Jahre 1963, als ein Männchen geboren wurde, welches
heftiges, Hund typisches Schwanzwedeln im Alltagsverhalten zeigte, sobald Menschen sich
näherten. (vgl. Körbel/ Stein 2018, o.S.). In weiterer Folge wurden beeindruckende
Verhaltensveränderungen an den Füchsen festgestellt und es manifestierten sich nach und nach
mehr hündische Eigenschaften bei einer steigenden Anzahl von Silberfüchsen. Die Tiere ließen
sich am Bauch kraulen, nahmen Körper- und Blickkontakt mit Menschen auf, entwickelten
kurze, runde Schnauzen, Ringelschwänze und Schlappohren und zeigten kleinere Köpfe sowie
Variationen in der Fellfärbung. Was jedoch erhalten blieb, war der strenge Geruch nach
Moschus.
Außerdem stellten Forscher fest, dass sich das Gehirn verkleinerte und es wurde Körper der
Tiere ein niedrigerer Cortisolspiegel sowie ein höherer Serotoninspiegel festgestellt (vgl.
Sommerfeld-Stur 2016, S. 21).
4. Der Haushund
Seit Jahrtausenden sind Mensch und Hund ein unschlagbares Team. Deswegen scheint es nicht
verwunderlich, dass sie in Österreich zu den beliebtesten Haustieren überhaupt zählen und im
Jahr 2019 rund 641.000 Hunde in Österreich gemeldet wurden (vgl. Statistica Research 2020,
o.S.). In diesem Kapitel steht vor allem die Beziehung zwischen Mensch und Hund im Fokus,
was Rassezucht für die Gesellschaft bedeutet und es wird das Verhalten des Hundes mit
wölfischen Verhaltensmustern verglichen.
4.1.Beziehung zwischen Mensch und Hund
Seit 100.000 Jahren hat sich zwischen Mensch und Hund eine facettenreiche Beziehung
aufgebaut. So scheint es nicht verwunderlich zu sein, dass eben diese Beziehung Gegenstand
von zahlreichen Forschungsarbeiten ist, welche vorwiegend positive Aspekte für den Menschen
in diesem Zusammenhang aufzeigen.
Die Haltung von Hunden hat sich in den menschlichen Kulturen manifestiert und sie sind zu
Begleitern und Helfern der Kulturentwicklung geworden.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass eine Koevolution zwischen Mensch und Hund
stattgefunden hat. Dabei werden Hunde als „soziale Katalysatoren“ gesehen, welche durch das
lange Zusammenleben Spuren in den sozialen Veranlagungen des Menschen hinterlassen
15haben. Das Sozialleben der Menschen soll also nicht mit dem Hund entstanden, sondern auch
durch den Hund entwickelt worden sein.
Zusätzlich zu der unumstrittenen Wichtigkeit des Hundes als Schutz-, Wach-, und Jagdhund
nimmt er auch aus sozio-ökonomischer Sicht eine essentielle Funktion ein und lässt ihn
aufgrund seiner Fähigkeiten zum optimalen Einsatzpartner für den Menschen werden (vgl.
Kotrschal 2004a, S. 11f.).
4.2.Hunde als Einsatzpartner
Ob man nun ein Freund von Hunden ist oder nicht – es ist wohl kaum abzustreiten, dass Hunde
und Menschen als Team herausragendes Potenzial aufweisen können. Der menschliche Partner
verfügt dabei über ein großartiges Konzepthirn, welches das Training und den jeweiligen
Einsatz der Fähigkeiten planen, langfristig denken und Wichtiges von Unwichtigem
unterscheiden kann. Der Hund verfügt im Gegensatz dazu zu Sinnen im Riech- Seh- und
Hörbereich, welche die menschlichen Kompetenzen um ein Vielfaches übersteigen (vgl.
Kotrschal 2012, S. 162f.).
Auf dem Weg zum modernen Haushund ist der Wolf dem Menschen gegenüber immer fähiger
geworden mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, da sich Aufmerksamkeit und Wille zur
Kooperation gesteigert haben. Heute gibt es eine ganze Palette an Einsatzmöglichkeiten, in
welchen der Hund als menschlicher Partner agieren kann.
Diese Palette reicht von Assistenz- und Arbeitshunden über Polizei- und Militärdienst,
Rettungsaufgaben, professionellen Therapieeinsatz und Sport (vgl. Kotrschal 2004a, S. 62f.).
4.3.Rassehundezucht
Einige Domestikationsforscher gehen davon aus, dass sich Rassebildung aufgrund von Bildung
geographischer Subspezies ereignet hat. Diese Theorie wird allerdings von modernen
Forschungen abgelehnt. Menschen haben eine gewisse Zielvorstellung von Merkmalen, welche
eine Haustierrasse kennzeichnen soll. Rassen entstehen dadurch, dass Tiere aufgrund einer
bestimmten Merkmalsausprägung zur Zucht auserkoren werden. Es geschieht gewollt eine
Zuchtauslese, welche zu von Menschen erwünschten Ausprägungen führen (vgl. Zimen 1992,
S. 144).
164.3.1. Rahmenbedingungen der Hundezucht
In den meisten Fällen wird Hundezucht (unabhängig von der Qualität der Aufzucht) als Hobby
gesehen und nur die wenigsten Züchter*innen bauen sich hauptberuflich eine Zuchtstätte auf.
Anders als die landwirtschaftliche Nutztierzucht ist die Hundezucht gesetzlich nur sehr wage
geregelt und gilt im Ganzen als Graubereich, welcher sich zumindest dem Tierschutzgesetz
unterordnen muss.
Trotz der Tatsache, dass es nur wenig gesetzliche Regelungen in diesem Bereich gibt, hat sich
ein großer Teil der Hundezüchter*innen in Zuchtverbänden organisiert. Auf internationaler
Ebene gibt es eine große kynologische Vereinigung, die Fédération Cynologique Internationale
(FCI). Die FCI akzeptiert auf nationaler Ebene einen einzigen Zuchtverband, wie etwa in
Österreich den ÖKV (Österreichischer Kynologenverband, in Deutschland den VDH (Verband
für das Deutsche Hundewesen) oder in der Schweiz die Schweizerische Kynologische
Gesellschaft (SKG). Diesen Zuchtverbänden sind jeweils den Rassen entsprechende
Verbandskörperschaften angeschlossen, welche oft interne Regelungen zusätzlich zu den FCI
Regelungen aufweisen (vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S. 10f.).
4.3.2. Fédération Cynologique Internationale
Die FCI wurde am 22.Mai 1911 von fünf Gründerländern ins Leben gerufen. Österreich,
Deutschland, Belgien, Frankreich und die Niederlande gründeten den Verband mit dem Ziel,
die Rassehundezucht zu unterstützen und zu schützen.
Die 367 derzeit anerkannten Hunderassen innerhalb der FCI teilen sich in insgesamt 10
Gruppen und die ihnen jeweils untergeordneten Sektionen auf.
FCI-Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde
Hütehunde sind Arbeitshunde, welche vor allem für das Lenken von Schafherden eingesetzt
werden. Diese Arbeit ist sehr komplex und erfordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit seitens
des Hundes. Sie sind sehr intelligent und ordnen sich dem Menschen schnell unter, sind also
auch verhältnismäßig leicht erziehbar. Außerdem zeichnen sie sich durch eine große
Bereitschaft zur Wachsamkeit aus.
Im Vergleich zu den eher ruhig arbeitenden Hütehunden, arbeitet der Treibhund mit viel Gebell.
17Die Gemeinsamkeit der Rassen der FCI-Gruppe 1 liegt darin, dass sie alle einen stark
ausgeprägten Arbeitstrieb haben. Aus diesem Grund eignen sie sich eher weniger dazu als reine
Wohnungs- und Spazierhunde gehalten zu werden.
FCI-Gruppe 2: Pinscher und Schnauzer, Molossoide, Schweizer Sennenhunde und andere
Ursprünglich wurden Pinscher und Schnauzer aus dem Genpool unterschiedlicher Bauernhunde
herausgezüchtet. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, Ungeziefer wie Ratten und Mäuse zu fangen
und den Hof und die Stallungen so gut wie möglich davon zu reinigen. Das Wesen dieser Tiere
war charakterisiert durch Furchtlosigkeit und einer Leidenschaft zur Jagd.
Molossoide waren ursprünglich als Hetz- und Jagdhunde gezüchtet, jedoch fanden sie auch als
Hütehunde ihren Einsatz. Im Gegensatz zur FCI-Gruppe 1 sollten sie allerdings nicht die
Nutztiere hüten, sondern sie sollten die Herde vor Raubtieren schützen. Vor allem durch ihre
massigen Körper und kräftigen Fänge sollten sie abschreckend für jegliche Art von Feinden
wirken.
Die Schweizer Sennenhunde wurden ebenso wie Pinscher und Schnauzer für die Arbeit auf
Bauernhöfen eingesetzt. Jedoch aufgrund ihrer Masse eher weniger als Jagdhunde, sondern vor
allem als Wach- und Zughunde. Sie haben ein ruhiges und freundliches Wesen und gelten als
sehr gelehrig. Die Kombination ihrer Stärke, Masse und Intelligenz lässt sie mit großem Erfolg
als Begleit-, Schutz-, und Lawinenhunde Einsatz finden.
FCI-Gruppe 3: Terrier
Terrier werden vor allem als draufgängerisch, mutig und intelligent beschrieben. Ihren
Ursprung fanden sie in der Bekämpfung von Fuchs und Dachs, indem sie ihnen in den
jeweiligen Bau folgten. Das Einsatzgebiet dehnt sich jedoch auch auf felsige Umgebungen und
Flur aus, um Raubzeug, Mäuse und Ratten zu bekämpfen.
Heute werden sie mit Vorliebe als Begleithunde gehalten, da sie sehr lernfreudig, treu und
anhänglich sind.
FCI-Gruppe 4: Dachshunde
Dachshunde werden seit mehr als 100 Jahren als pflegeleichte, robuste, lustige und sehr
intelligente Persönlichkeiten gezüchtet. Sie sind passionierte und ausdauernde Jagdhunde, im
Stöbern und im Stellen der Beute, jedoch finden viele Menschen auch verlässliche und freche
Familienhunde in den kleinen Tieren. Besonders hervorzuheben ist bei den Dachshunden ihr
ausgeprägtes Selbstbewusstsein.
18FCI-Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp
Früher wurde der Spitz als Begleiter der großen Lastenfuhrwerke gehalten, die den
Gütertransport über weite Strecken besorgten. Der Spitz hatte hier die Aufgabe als Wächter
über das Transportgut und als Jäger von Ratten, und Mäusen auf dem Areal. Als
Fuhrmannshund ist der Spitz charakterisiert durch hohe Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und
Schnelligkeit.
Der Charakter der nordischen Spitze wird anders beschrieben als jener der normalen Spitze.
Sie haben einen weit ausgeprägten Jagdinstinkt, sind sehr stämmig mit dichtem Pelz.
FCI-Gruppe 6: Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen
Laufhunde sind ursprüngliche Jagdhunde und stammen von Bracken und Meutehunden ab. Mit
diesen Hunden jagten schon die Kelten und auch Könige mit ihrem Gefolge. Sie sind durch
Ausdauer und Widerstandskraft ausgezeichnet und sind dabei sehr instinktiv. Bemerkenswert
an ihrer Arbeitsweise ist, dass sie in der Meute jagen, was für viele wildlebende Hunde typisch
ist. Ihr Temperament ist freundlich und fügsam, was sie neben treuen Jagdhunden auch zu
beliebten Familienhunden macht.
Schweißhunde wurden sehr ausdauerfähig gezüchtet, da sie einer Wildfährte so lange folgen
sollen, bis die/der Hundführer*in (eventuell auch durch eine kurze Hetzjagd) in den Besitz des
beschossenen Stückes brachte.
FCI-Gruppe 7: Vorstehhunde
Vorstehhunde sind zwar Jagdhunde, jedoch zeichnet sich ihr Jagdverhalten dadurch aus, dass
sie das Vorhandensein von Wild anzeigen. Besonders seit der Verwendung von Schusswaffen
bekam der Vorstehhund enorme Bedeutung bei der Jagd und dafür ist es natürlich notwendig,
dass die Hunde schussfest sind.
FCI-Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde
Apportierhunde, beziehungsweise Retriever, sind speziell für die Jagdarbeit nach dem Schuss
zum Apportieren von Har- und Federwild gezüchtet worden. Sie sind freundliche, intelligente
Hunde mit ausgeglichenem Temperament. Ihnen wird eine besondere Leidenschaft in Bezug
auf Wasser nachgesagt und außerdem sind sie sehr lernfreudig. Durch ihr ausgeglichenes,
sanftes Wesen und ihre leichte Führigkeit eigenen sie sich für diverse Arbeitssparten, wie
beispielsweise als Blinden-, Lawinen- und Spürhunde für Zoll- und Polizeidienst.
19Unter den Stöberhunden sind vor allem Spanielrassen stark vertreten. Sie sind lebhaft,
freundlich, neugierig, sehr aufmerksam und intelligent. Ursprünglich stammen sie von kleinen
Vogelhunden mit Hängeohren ab, die in Spanien und Frankreich zur Jagd verwendet wurden.
Trotz des ursprünglichen Einsatzes in der Jagd, sind sie heute vor allem als Familien- und
Begleithunde im Einsatz, da andere Rassen wohl besser für den Wildfang geeignet erscheinen.
FCI-Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde
Begleithunde sind intelligent, freundlich und anpassungsfähig, weshalb sie auch in Wohnungen
problemlos gehalten werden und doch auch für alle möglichen Arten des Hundesports
eingesetzt werden können. Im 17. Jahrhundert waren diese Hunde „Seelentröster“ der oberen
Gesellschaftsschicht, bewachten wertvoll bestickte Handtaschen und wurden bereits damals
allgegenwärtig mitgenommen.
FCI-Gruppe 10: Windhunde
Der Windhund galt als prädestinierter Hund für die Hetzjagd. Durch seine überlegene
Schnelligkeit und Wendigkeit ist er besonders in der Hasenjagd im Einsatz. Die Jäger waren
bei der Ausübung dieser Art des Jagens meist zu Pferd unterwegs und konnten so der Hetz
folgen. Heutzutage werden Windhunde in Europa eher nicht mehr in der Jagd verwendet. Sie
sind heute elegante Familienhunde oder finden aufgrund ihrer Schnelligkeit Einsatz im
Windhunderennen (vgl. ÖKV 2021, o.S.).
4.3.3. Hundeausstellungen
Unter den diversen Rassezüchter*innen ist der Stellenwert von Ausstellungen ganz verschieden
gewichtet. Einige Züchter*innen besuchen beinahe jedes Wochenende Ausstellungen auf der
ganzen Welt, während andere lediglich den Sollwert erfüllen. Bei jeder Ausstellung können pro
Hund verschiedene Formwerte und damit verbundene Zertifikate und Titel errungen werden.
Zu diesem Zweck vollführen besonders ambitionierte Aussteller*innen ausgedehnte
Pflegeprogramme an ihren Hunden.
Die Hunde müssen in Aussehen, Pflege und Verhalten ihrem jeweiligen Rassestandard
entsprechen, welcher von der FCI schriftlich festgehalten wurde. Je eher ein Hund diesem
Standard entspricht, desto besser wird sein Formwert ausfallen. Dieser Formwert wird von
einer/einem professionellen Richter*in festgelegt und verkörpert deren subjektive Meinung,
20weshalb dieser Wert von Ausstellung zu Ausstellung sehr stark variieren kann (vgl.
Sommerfeld-Stur 2016, S. 12).
Folgende Formwerte können dabei erreicht werden:
- Vorzüglich
- Sehr gut
- Gut
- Genügend
Neben dem Formwert gibt es zusätzlich noch eine Reihung. Wenn mehrere Hunde im Ring
gegeneinander antreten, so kann es sein, dass alle die angestrebte Bewertung „Vorzüglich“
erhalten. Sie werden dann noch je nach Ermessen der richtenden Person in V1, V2, V3 etc.
gereiht.
Für den tatsächlichen Einsatz in der Zucht ist ein solcher Formwert jedoch nichtssagend, denn
man kann daraus nicht lesen, wie kompatibel ein Rüde und eine Hündin im Falle einer
Verpaarung sind (vgl. ebd. 2015, S. 12f.).
Innerhalb einer Rasse existieren mehrere Klassen in verschiedenen Altersgruppen:
- Jüngstenklasse: 6-9 Monate
- Jugendklasse: 9-18 Monate
- Zwischenklasse: 15-24 Monate
- Offene Klasse: über 15 Monate
- Veteranenklasse: ab dem vollendeten 8. Lebensjahr
Innerhalb jeder Klasse können die subjektiv schönsten Hunde bei jeder Ausstellung
unterschiedliche Titel und Anwartschaften erringen. Je nach Rasse erhält man nach drei bis fünf
Titel nationale und internationale Schönheits-Championate (vgl. ÖKV 2015, S. 4f.).
4.4.Morphologie
Das äußere Erscheinungsbild des Hundes ist von unterschiedlichsten Farben und Formen
geprägt. Die Größe variiert dabei von unter 20cm wie etwa beim Chihuahua bis hin zu über
70cm beim Neufundländer und dem Irischen Wolfshund. Züchter*innen haben in der
Vergangenheit das Urbild des Hundes derartig verändert, dass es heute oftmals nur noch ein
21Zerrbild des Urhundes darstellt. Das übermäßige Wachstum wirkt sich allerdings negativ auf
die Lebenserwartung aus.
Die Extremitäten der Hunde haben ebenso eine recht unterschiedliche Erscheinungsform.
Stellung, Länge und Winkelung der Extremitäten wurden von der ursprünglichen Verwendung
der Rasse abhängig gemacht (vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S. 95f.) Heutzutage scheint es
allerdings in Mode gekommen zu sein jene Formationen in ein derartiges Extrem zu züchten,
dass die Deformationen gesundheitliche Schäden mit sich ziehen.
Eine steil abfallende Rückenlinie wie etwa beim Deutschen Schäferhund führt zu
Fehlbelastungen im Bereich der Hinterextremität und der Wirbelsäule. Im Vergleich von
Abbildung 3 und 4 ist der optische Unterschied der Körperformen klar ersichtlich.
Abb.3: Steil abfallende Rückenlinie beim Deutschen Schäferhund (In: Sommerfeld-Stur 2016,
S. 314).
22Abb.4: Gerader Hunderücken mit gleichmäßigem Belastungspotenzial (In: Sommerfeld-Stur
2016, S. 122).
Die Extremitäten des Hundes sind die mechanische Basis der Beweglichkeit, welche auf einer
gleichmäßigen Belastung der Gelenke beruht. Wird eine Deformation eingezüchtet, beim
Deutschen Schäferhund in Form dieser abnormalen Rückenlinie, ergibt sich durch die
abgeänderte Winkelung der Extremitäten eine physische Überbelastung einzelner
Gelenksbereiche (siehe Abbildung 5). Diese Gegebenheit führt zu frühzeitigem Verschleiß der
Gelenke und oftmals auch Sehnen und Bänder und kann in diversen Erkrankungen in diesen
Bereichen führen (vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S. 313f.).
Abb.5: Gleichmäßige und ungleichmäßige Belastung der Gelenke (In: Sommerfeld-Stur 2016,
S. 313).
23Die Schädelform des Hundes zeigt sich im Vergleich zum Wolf in einer großen Variation. Diese
Variation wird in Abbildung 6 dargestellt. Die Kopfstruktur wird breiter und bei einigen Rassen
flacht sich die Form der Schnauze ab, was zu einer Verkürzung des Schädelerscheinungsbilds
führt. Diese Veränderungen bringen eine Abnahme der Hirnmasse um etwa 30% mit sich (vgl.
Sommerfeld-Stur 2016, S. 98f.).
Abb.6: Variationen in der Schädelform beim domestizierten Hund (In: Sommerfeld-Stur 2016,
S.99.
Die Veränderung der Kopfform ist vor allem für das Gebiss relevant. Im Zuchtbereich liegt ein
großes Augenmerk auf einem vollständig ausgeprägten, korrekten Gebiss. Besonders auf
Zuchtausstellungen wird bei jedem Hund eine Zahnkontrolle durchgeführt und die
24augenscheinlichen Beobachtungen diesbezüglich in die Bewertung eingetragen. Anomalien in
diesem Bereich führen nicht selten zum gänzlichen Zuchtausschluss.
Zähne passen sich in ihrer Größe oftmals nicht vollständig an die Größe des Kiefers an. Stark
verkürzten Kopfformen, vor allem bei Kleinhunden, ist es geschuldet, dass sich Fehlstellungen,
zum Beispiel in Form eines Kulissengebissen (siehe Abbildung 7), manifestieren. Bei
langschädeligen Hunden kommt es im Gegensatz dazu zu einer Lückenbildung zwischen den
Zähnen, da die Kiefer der Hunde übernatürlich lang sind (vgl. Sommerfeld-Stur 2016, S. 100f.).
Abb.7: Kulissengebiss - Oberkiefer eines Hundes mit abgeflachter Schnauze (In: Sommerfeld-
Stur 2016, S. 323).
Für den Zuchteinsatz ist ein weiteres wichtiges Merkmal die Stellung der Ohren. Bei den
meisten Hunderassen sieht der Rassestandard entweder ein mehr oder weniger hängendes Ohr
vor oder ein Stehohr. Die Varianz der Ohrenform hält sich im Normalfall innerhalb einer Rasse
sehr in Grenzen. Bei einigen Hunderassen sind allerdings Kippohren gefragt, welche eine
Kombination aus Steh- und Hängeohren darstellt. Soll aus einem ungewollten Stehohr ein
Kippohr werden, kleben manche Tierbesitzer*innen die Ohren der Hunde nieder, was aus
tierschützerischer Sicht mehr als bedenklich erscheint.
Die Rute erfüllt auf den ersten Blick rein optische Zwecke. Dies ist jedoch keineswegs der Fall,
denn sie wird sowohl für Gleichgewichtsfunktionen, indem sie als eine Art Heckruder
25eingesetzt wird, als auch für Kommunikationsfunktionen benötigt. Im Laufe der
Rassenentwicklung nimmt sie unterschiedliche Erscheinungsformen ein. So haben manche
Hunde eine sehr wolfsähnliche Rute, während sie sich bei andern Rassen einringelt, in ihrer
Länge variiert oder manchmal auch gänzlich fehlt. Hunde kommunizieren beinahe
ausschließlich über Körpersprache, wodurch es noch deutlicher erscheint, wie wichtig die Rute
für den Ausdruck der Stimmungssignale des Hundes und seinen Absichten ist. Für den
Arbeitseinsatz mancher Hunderassen erschien jedoch die Rute in einigen Fällen als Hindernis,
wie etwa bei einigen Jagdhunden. Sie können sich mit dem Schwanz in Zäunen, oder anderen
Barrieren verfangen und die Jagd dadurch verzögern. Deshalb wurden viele Hunde kupiert, also
es wurde ihnen der Schwanz verstümmelt. Dieser Vorgang ist in Österreich inzwischen
verboten und die Rute wird bei diesen Arten durch genetische Selektion weggezüchtet (vgl.
Sommerfeld-Stur 2016, S. 101f.).
Weiters gibt es noch einige rassespezifische Veränderungen, wie beispielsweise die
Anzüchtung einer zusätzlichen Zehe an den Vorderbeinen der Pyrenäenberhunde, die extreme
Bemuskelung bei Whippets, um ihre Rennleistung zu verbessern, oder der Rhodesian
Ridgeback, welcher einen Hautstreifen am Rücken trägt, auf dem die Haare in die
gegengesetzte Richtung wachsen (vgl. ebd. 2016, S. 103).
4.5.Verhalten
Im Verhaltensaspekt spiegelt sich eine große Anzahl an verschiedenen Themen. Diese Arbeit
fokussiert sich allerdings auf drei spezifische Punkte, nämlich das Sozialverhalten, das
Territorialverhalten und das Fressverhalten.
4.5.1. Sozialverhalten
Verhalten gegenüber Welpen älter als 8 Wochen
Beim Wolf gestaltet es sich schwierig festzustellen, ob in ihrer natürlichen Umgebung ein
Welpenschutz existiert oder nicht. Beim Hund jedoch lautet die Antwort auf diese Frage
definitiv NEIN! Wenn ein fremder Hund in stromliniger Form schnell und zielstrebig zu einem
Welpen heranläuft, kann es beispielsweise sein, dass der Hund den Welpen als Beute eingestuft
hat (vgl. Boch,Radinger 2013, S. 131).
26Bei uns Menschen ist verankert, dass unsere Hunde Welpen gegenüber keinerlei aggressives
Verhalten zeigen dürfen. Knurrt ein Hund oder fletscht er seine Zähne ist das in den meisten
Fällen ein Zeichen, dass der Welpe seine Geduld überstrapaziert. Diese Signale sind Teil einer
ganz natürlichen Kommunikation von Hunden und sollten von Menschen nicht unterbunden
werden. Ein fremder Hund hegt im Normalfall eher selten die Intention mit Welpen zu spielen.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie die Welpen durch Schnauzengriff und „Auf den Boden
werfen“ in ihre Schranken weisen (vgl. Heiduk 2021, o.S.).
Spielverhalten
Wie auch für Wölfe ist das gemeinsame Spiel für Hunde eine wichtige Instanz. Hunde lernen
durch Spielen von klein auf gegenseitig den jeweiligen Handlungsspielraum kennen und soziale
Signale zu deuten (vgl. Bloch, Radinger 2013, S. 139).
Im Vergleich zu Wölfen behalten Haushunde ihr kindliches Wesen ein Leben lang bei, weshalb
man sie eher mit dem Verhalten von jungen Wölfen vergleichen sollte. Deswegen scheint es
nicht verwunderlich, dass Hunde viel eher dazu neigen miteinander zu spielen, als es Wölfe
tun. Insgesamt nimmt aber auch ihr Spieltrieb vom Jugendalter bis zum Erwachsenenalter stark
ab (vgl. Bloch 2013, S. 65).
Führungsposition und Dominanz
Als Hundebesitzer*in ist es nicht nötig, dass man den Hund ständig anführt und leitet, um von
ihm respektvoll behandelt zu werden. Ein Hund darf auch beim Spaziergang mit Frauchen
und Herrchen je nach Belieben nach vorne oder hinten laufen. Er darf am Weg entlang gehen
und die Richtung einschlagen. Wenn man zu einer Weggabelung gelangt, wird ein Hund, der
die/den Besitzer*in akzeptiert stets Inne halten und abwarten, wo diese hingehen. Bis zu der
Weggabelung hat also der Hund die Führung. Genau wie beim Wolf gibt der Hund in
Situationen, die nicht eindeutig sind, die Führung anschließend wieder ab und verlässt sich
darauf, dass der Mensch sie übernimmt (vgl. Bloch, Radinger 2013, S. 58f).
Wie auch beim Wolf existiert beim Hund der Schnauzengriff als korrigierende Instanz. Jene
Individuen, die im Sozialgefüge höhergestellt sind, wenden den Schnauzengriff als
erzieherischen Ansatz an. Hundetrainer*innen empfehlen, dass auch Menschen, die ihre
Hunde erziehen wollen, diese Methode anwenden sollen, da es als eine natürliche
Zurechtweisung betrachtet wird, keinesfalls vom Hund mit Brutalität gleichgesetzt wird und
die Vertrauensbasis nicht beschädigt (vgl. Bloch, Radinger 2013, S. 119f.).
27Sie können auch lesen