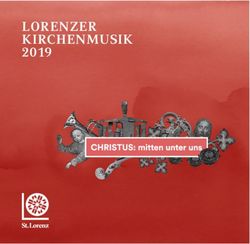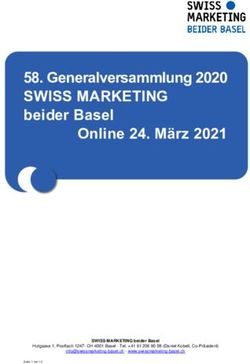Die Kräuterhauapotheke - Phytotherapie - Basiskurs - Auflage (2020) - Salvia-Heilpflanzenschule
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INHALT
DIE PFLANZENHEILKUNDE............................................................................................................................... 4
Die Aromatherapie ...................................................................................................................................................4
Die Mykotherapie ....................................................................................................................................................4
Die Taxonomie......................................................................................................................................................... 5
Die Pflanzeninhaltsstoffe .........................................................................................................................................7
Die Sekundären Pflanzeninhaltsstoffe ..................................................................................................................... 7
Alkaloide .............................................................................................................................................................. 7
Ätherische Öle...................................................................................................................................................... 8
Bitterstoffe ........................................................................................................................................................... 8
Flavonoide............................................................................................................................................................ 9
Gerbstoffe (Tannine) .......................................................................................................................................... 10
Glykoside ........................................................................................................................................................... 10
Phytosterine........................................................................................................................................................ 11
Saponine............................................................................................................................................................. 11
Schleimstoffe ..................................................................................................................................................... 11
Carotinoide ......................................................................................................................................................... 12
Pflanzenteile ........................................................................................................................................................... 13
Zubereitungsarten................................................................................................................................................... 13
Richtiges Sammeln von Kräutern .......................................................................................................................... 14
Richtiges Trocknen und Aufbewahren von Kräutern ............................................................................................. 14
Darreichungsformen............................................................................................................................................... 14
Presssaft ............................................................................................................................................................. 14
Sirup ................................................................................................................................................................... 14
Dekokt (Abkochung).......................................................................................................................................... 14
Infus (Aufguss) .................................................................................................................................................. 15
Mazerat (Kaltauszug) ......................................................................................................................................... 15
Ölauszug (Maceratum oleosum) .................................................................................................................... 15
Tinktur................................................................................................................................................................ 15
1 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020Extrakt ................................................................................................................................................................ 16
Tablette und Kapsel ........................................................................................................................................... 16
Creme und Salbe ................................................................................................................................................ 16
Zäpfchen ............................................................................................................................................................ 16
Ätherisches Öl .................................................................................................................................................... 16
Die Destillation ...................................................................................................................................................... 17
Die Ringelblume .................................................................................................................................................... 20
Die Ringelblumensalbe ...................................................................................................................................... 20
Die Arnika.............................................................................................................................................................. 21
Die Deutsche Kamille ............................................................................................................................................ 22
Das Ätherische Deutsche Kamillenöl ................................................................................................................ 23
Psychisch........................................................................................................................................................ 23
Körperlich ...................................................................................................................................................... 23
Die Pfefferminze .................................................................................................................................................... 24
Das Ätherische Pfefferminzöl ............................................................................................................................ 25
Psychisch........................................................................................................................................................ 25
Körperlich ...................................................................................................................................................... 25
Achtung! ........................................................................................................................................................ 25
Die Melisse ............................................................................................................................................................ 26
Das Ätherische Melissenöl ................................................................................................................................. 27
Psychisch........................................................................................................................................................ 27
Körperlich ...................................................................................................................................................... 27
Achtung! ........................................................................................................................................................ 27
Das Johanniskraut .................................................................................................................................................. 28
Das Rotöl (Johanniskrautöl) ............................................................................................................................... 29
Körperlich ...................................................................................................................................................... 29
Achtung! ........................................................................................................................................................ 29
Die Brennnessel ..................................................................................................................................................... 30
Die Mistel............................................................................................................................................................... 31
Die Schafgarbe ....................................................................................................................................................... 32
2 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020Das Ätherische Schafgarbenöl ........................................................................................................................... 33
Psychische Wirkung ....................................................................................................................................... 33
Körperliche Wirkung ..................................................................................................................................... 33
Achtung!........................................................................................................................................................ 33
Der Wermut ........................................................................................................................................................... 34
Die acht Regeln für richtiges Rezeptieren .............................................................................................................. 35
Wichtige Formulierungen und Abkürzungen ..................................................................................................... 35
Beispielrezept ......................................................................................................................................................... 36
Bildquellennachweise:
Pflanzenbilder, Ätherische Öle und Grafik des Destillierkolbens: Wikipedia
alle übrigen Grafiken und Bilder: Daniel Lorenz
3 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE PFLANZENHEILKUNDE Die Pflanzenheilkunde heilt körperliche Leiden mit Heilpflanzen. Sie ist die älteste, nachgewiesene Heilkunst der Menschheit und wurde weltweit in allen Kulturkreisen unabhängig voneinander entdeckt. Bereits in über 30.000 Jahre alten steinzeitlichen Bauten konnten Heilpflanzenreste nachgewiesen werden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich diese Heilkunst permanent weiter und es entstand schließlich daraus unsere moderne Pharmazie, die sich mittlerweile nicht mehr nur auf rein natürliche Mittel sondern auch auf synthetische Substanzen erstreckt. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass die Pflanzenheilkunde die Mutter unzähliger, innovativer Medikamente der modernen Pharmazie darstellt. So war beispielweise die im Echten Mädesüß enthaltene Salizylsäure das Vorbild zur Entwicklung ihres synthetischen Pendants im Aspirin. Die Digitalisglykoside aus dem Roten Fingerhut sind nach wie vor unersetzliche Herzmedikamente. Die Augenheilkunde verwendet noch heute das Atropin (Tollkirsche) zur Erweiterung der Pupille bei Augenuntersuchungen. Nach wie vor ist die Pflanzenheilkunde eine unerschöpfliche Quelle von Heilmitteln, deren Bedeutung trotz ihres Alters keineswegs geschmälert wurde. DIE AROMATHERAPIE Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der Pflanzenheilkunde, der sich ausschließlich mit einem bestimmten hochwirksamen Pflanzenbestandteil befasst – dem ätherischen Öl. Es ist meist nur in Spuren vorhanden und verleiht einer Pflanze ihren charakteristischen Duft. Mit Hilfe von physikalischen Methoden wird es aus der Pflanze extrahiert und steht uns dann als hochkonzentrierte, immens heilkräftige Essenz mit ganz spezifischen Wirkeigenschaften zur Verfügung. DIE MYKOTHERAPIE Die Mykotherapie behandelt körperliche Beschwerden mit Heilpilzen und ist ähnlich wie die Pflanzenheilkunde bereits seit Jahrtausenden bewährt. Die Mykotherapie ist die Wiege des Pennicillin. Dieses Antibiotikum wird nach wie vor durch Anzucht und Aufbereitung von Penicillium chrysogenum gewonnen und verdeutlicht auf imposante Art und Weise, welche Macht in einem vermeintlich simplen Pinselschimmel zu stecken vermag. 4 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE TAXONOMIE
Die Taxonomie in der Phytotherapie ist eine wissenschaftliche Einteilung von Lebewesen in bestimmte
Kategorien nach einem fest vereinbarten Schema.
Wir benötigen sie in erster Linie zur genauen Bennung von Pflanzen, beispielsweise bei der Erstellung von
Rezepturanleitungen für den Apotheker.
Weiterhin ermöglicht sie uns Einblicke in die Abstammung und somit auch u.U. die Eigenschaften einer Pflanze.
Dabei interssieren uns nur zwei Teilbereiche:
• die Pflanzen
• und die Pilze
5 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020Hier die genaue Klassifikation der Waldkiefer: Der wissenschfliche Name setzt sich wie folgt zusammen: 6 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE PFLANZENINHALTSSTOFFE
Pflanzen enthalten viele verschiedene Inhalststoffe mit oft typischen Eigenschaften. Man unterscheidet dabei
zunächst in Primäre und Sekundäre.
Primäre Pflanzeninhaltsstoffe sind fur die Pflanze lebensnotwendig. Sekundäre dagegen nicht. Sie ergänzen
lediglich den Schutz der Pflanze vor bestimmten Einflüssen, wie z.B. Schädlingen, Parasiten oder
Umwelteinflüssen.
In den meisten Faällen sind es aber gerade diese Stoffe, die für die Heilkunde interessant sind.
DIE SEKUNDÄREN PFLANZENINHALTSSTOFFE
ALKALOIDE
Alkaloide sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die teilweise äußerst starke und besonders charakteristische
Wirkungen im menschlichen Körper entfalten können. Von Aufbau und Beschaffenheit her können diese
stickstoffhaltigen, organischen Verbindungen stark voneinander abweichen. Fast alle dieser Stoffe wirken
basisch (alkalisch). Insgesamt sind weit über 10.000 verschiedene Alkaloide bekannt.
Ein typisches Merkmal dieser Stoffgruppe ist der bittere Geschmack, wie z.B. bei Chinin.
Die Eigennamen von fast allen Alkaloiden enden auf -in. Der erste Teil der Bezeichnung enthält oft Bestandteile
des wissenschaftlichen Namens der Pflanze, in der sie zuerst entdeckt worden sind.
Alkaloide können starke Wirkungen auf das zentrale Nervensystem ausüben, indem sie beispielsweise den
Parasympathikus blockieren.
Sie sind auch verantwortlich für die berauschende oder stark toxische Wirkung diverser Pflanzen.
Jedoch gerade diese Eigenschaften sind in die Pharmakologie von großer Bedeutung:
• Morphin (Schlafmohn)
• Codein (Schlafmohn)
• Strychnin (Brechnuss)
• Colchicin (Herbstzeitlose)
• Mescalin (Peyote-Kaktus)
• Kokain (Cocastrauch)
• Atropin (Tollkirsche)
• Muscarin (Fliegenpilz)
• Curarealkaloide (Lianen)
• Mutterkornalkaloide (Mutterkorn)
Aber auch im täglichen Gebrauch spielen diese Stoffe für uns eine große Rolle:
• Koffein (Kaffee, Tee
• Solanin (Kartoffel)
• Nikotin (Tabak)
• Theobromin (Kakao)
• Capsaicin (Chili, Cayenne)
• Piperin (Pfeffer)
7 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020ÄTHERISCHE ÖLE
Ätherische Öle sind stark riechende, aromatische, leicht flüchtige Substanzen. Sie bestehen aus bis zu 300
verschiedenen Einzelsubstanzen. Daher bezeichnet man sie auch als Vielstoffgemische.
Duftenden Pflanzen verleihen sie ihr unverwechselbares Aroma, wie beispielsweise bei Lavendel, Pfefferminze,
Ingwer, oder Zimtrinde.
Ätherische Öle lösen sich schlecht in Wasser, jedoch gut in Fett oder Alkohol. Über Haut- und Schleimhäute
können sie rasch aufgenommen werden.
Sie haben ein äußerst breites Wirkspektrum und können bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden.
Wirkspektrum ätherischer Öle
BITTERSTOFFE
Bitterstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe, die bitter schmecken. Diese Substanzen verursachen nach dem
Verzehr eine erhöhte Produktion von Verdauungssäften im Magen-Darm-Trakt (Sekretionssteigerung).
Dabei wirken sie, indem sie die Rezeptoren für den bitteren Geschmack auf der Zunge anregen und somit den
Speichelfluss verstärken.
Im Magen angekommen, verstärken Sie die Freisetzung von Gastrin und Magensäure. Zusätzlich erhöhen sie die
Peristaltik und die Ausschüttung von Pankressekret (Bauchspeichel).
Man unterscheidet zwischen reinen Bitterstoffdrogen (Amara pura):
• Andorn
• Gelber Enzian (Gentianopicrin)
• Löwenzahn (Taraxosid)
• Tausendgüldenkraut
und aromatischen Bitterstoffe (Amara aromatica):
• Anis
• Engelwurz
• Fenchel
8 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020• Galgant
• Hopfen (Humulon)
• Koriander
• Kümmel
Aufgrund ihrer erleichternden und unterstützenden Wirkung bei Verdauungsbeschwerden wurden
bitterstoffreiche Pflanzen seit jeher in Form von Tinkturen, Kräuterschnäpsen oder Likören eingesetzt. Sehr
bekannt ist beispielsweise der Schwedenbitter.
FLAVONOIDE
Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe. Kennzeichnend ist ihre auffällige Farbe. Bisher wurden über 8.000
verschiedene Verbindungen entdeckt.
Medizinisch werden sie meist aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung eingesetzt. Es konnten jedoch noch eine
ganze Reihe anderer Eigenschaften wissenschaftlich nachgewiesen werden. Je nach Art können sie wie folgt
wirken:
• antiallergisch
• virustatisch
• antimikrobiell
• antiphlogistisch
• antiproliferativ
• antikanzerogen
• antioxidativ
• kardiovaskulär
• hormonell
• thrombozytenaggregationshemmend
Besonders hohe Konzentrationen finden sich oft in den Blütenblättern diverser Pflanzen, wie z.B.:
• Arnika
• Rotklee (Isoflavon, ein Phytoöstogen)
• Tagetes
• Kornblume
• Gänseblümchen
• Malve
• Prunkwinde
• Dahlie
• Schlüsselblume
• Weißdorn
Aber auch in Frucht, Holz und Kraut können sie enthalten sein:
• Buchweizen
• Apfel
• Zitrusfrüchte
• Lattich
• Wegwarte
• Weintraube
• Süßholz
9 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020GERBSTOFFE (TANNINE)
Gerbstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe, auch Tannine genannt, die adstringierend (zusammenziehend),
austrocknend und damit auch konservierend wirken.
Sie können tierische Haut in Leder umwandeln – gerben. Die Gerbstoffe sind so alt wie die Menschheit selbst.
Bereits die alten Ägypter verwendeten sie, um feinstes Leder herzustellen.
Naturheilkundlich werden sie eingesetzt zur Behandlung von Entzündungen an Haut und Schleimhaut sowie zur
Erstversorgung von Verletzungen. Sie bilden an der Wundoberfläche sowie auf Schleimhäuten eine mehr oder
wenige dichte Lage koagulierter Zellschichten. Gerbstoffe sorgen so für eine rasche Blutungsstillung, fördern die
Wundheilung und beugen Entzündungen vor. Sie wirken auch leicht schmerzlindernd.
Reichlich enthalten sind sie in:
• Eichenholz
• Tee (Camellia sinensis)
• Blutwurz
• Quitte
• Weintraube
• Brombeere
• Hamamelis
• Ratanhia
• Gerberakazie
• Odermennig
GLYKOSIDE
Glykoside sind sekundäre Pflanzenstoffe. Chemisch beinhalten diese Verbindungen in ihrer Struktur sowohl
Anteile eines Alkohols als auch eines Zuckers. Dieser Zucker kann chemisch abgespalten werden.
Glykoside kommen in den Pflanzen häufig gemeinsam mit Enzymen vor. Diese können bei der Verarbeitung
und bei der Lagerung die Glykoside zerstören.
Heilkräuter, die wegen ihrer Glykoside geerntet werden, behandelt man daher oft mit einer beschleunigten
Trocknung. So kann die Zerstörung auf ein Minimum reduziert werden.
Als Reinsubstanz erscheinen die meisten Glykoside als farblose Kristalle. Sie sind im Pflanzenreich weit
verbreitet und können sehr unterschiedlich wirken. Die Bandbreite erstreckt sich dabei von einfachen
biologischen Effekten bis hin zur starken Toxizität.
Man unterteilt sie folgende Gruppen:
• Anthocyanglycoside (in vielen Pflanzen als Farbstoffe, z.B. Holunder und Heidelbeere)
• Anthracenglykoside (in Faulbaumrinde, Goabaum, Rhabarber, Senneskraut, Aloe)
• Cumaringlycoside(diverse pharmakologische Wirkungen)
• Cyanogene Glycoside (spalten bei Zersetzung Blausäure ab, in Lein, Bittermandeln)
• Flavonoidglykoside (große Gruppe pharmakologisch wirksamer Pflanzenfarbstoffe)
• Herzglycoside (wirken pharmakologisch auf die Herzmuskulatur, in Roten Fingerhut)
• Iridoidglycoside (Abwehr von Fressfeinden, in Indigo, div. Orchideen)
• Phenolglycoside (diverse pharmakologische Wirkungen, in Bärentraube, Weidenrinde, Pappel)
• Senfölglykoside (wirken reizend und antibakteriell, in Meerrettich, Senf, Rettich)
• Saponine (schaumbildende und tensidähnlich wirkende Stoffe, in Seifenkraut, Waschnüssen)
10 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020PHYTOSTERINE
Die Phytosterine sind eine Gruppe primärer Pflanzeninhaltsstoffe aus der Familie der Lipide. Als wichtige
Bestandteile der pflanzlichen Zellmembranen sind sie für die Pflanze essenziell. Diese Stoffe sind nahezu
nicht wasserlöslich.
Reichlich enthalten sind sie in fettreichen Pflanzenteilen wie z.B.:
• Kürbiskernen
• Sesamsaat
• Sonnenblumenkernen
• Weizenkeimen
• Roggenkeimen
• Maiskeimen
• Leinsamen
• Oliven
• Kokosnuss
• Sojabohnen
• Rapssamen
Phytosterine verringern die Aufnahme von Cholesterin im menschlichen Darm. Daher werden sie
therapeutisch zur begleitenden Behandlung von Hypercholesterinämie eingesetzt.
Da der menschliche Organismus jedoch Cholesterin selbst produzieren kann, setzt nach
Phytosterineinnahme zeitlich versetzt ein entsprechender Ausgleich ein. Die Werte können daher meist nur
um maximal 10 % reduziert werden.
Bei benigner Prostatahyperplasie (Prostatavergrößerung) können Phytosterine die Symptome lindern.
SAPONINE
Saponine sind im Pflanzenreich weit verbreitet. Sie können zusammen mit Wasser ähnlich wie Seife Schaum
bilden. Chemisch sind sie aus ein- oder mehreren Zuckermolekülen aufgebaut. Saponine können abführend,
schmerzlindernd, oder durchblutungsfördernd wirken.
SCHLEIMSTOFFE
Schleimstoffe bestehen vorwiegend aus Polysacchariden und gehören zu den sekundäre
Pflanzeninhaltsstoffe. Sie sind in der Lage, große Mengen von Wasser zu binden. Ein Gramm des in Roggen
enthaltenen Schleimstoffs Pentosan vermag 23 g Wasser zu binden. Dabei bilden sie stabile Gele, die meist
farblos und transparent sind. Die Viskosität reicht je nach Wassergehalt von dünnflüssig schleimig, über
fadenziehend, gallertartig bis hin zu schnittfest. Man bezeichnet diese Verbindungen als Biopolymere.
Im Wesentlichen bestehen sie aus Mehrfachzuckern, sogenannten Polysachariden. Man unterscheidet dabei
wasserlösliche und -unlösliche Schleimstoffe, die jeweils unterschiedliche Wirkungen auf den menschlichen
Organismus haben.
Die wasserlöslichen Schleimstoffe schützen die Schleimhäute. Sie überziehen sie mit einem dünnen Film
aus Schleim, der strukturell dem körpereigenen Pendant ähnelt. Dadurch wirken sie reizlindernd, wie z.B.
Eibisch oder Isländisch Moos bei Reizhusten.
Die Wasserunlöslichen vergrößern nach Verzehr das Volumen des Stuhlgangs und beugen somit
Verstopfung vor (z.B. Leinsamen, Flohsamen). Zusätzlich können sie im Stuhl enthaltene Toxine,
11 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020Nahrungsbestandteile sowie Gallensäuren binden und wirken sich positiv auf die Darmschleimhaut
(Mukosa) aus.
Schleimstoffhaltige Pflanzen
• Eibisch (Galacturonohammane und Arabinogalactane)
• Spitzwegerich
• Isländisch Moos (Lichenin)
• Leinsamen
• Flohsamen
• Hafer
• Roggen (pentosane)
• Apfel
• Quitte
• Zitrusfrüchte
• Nachtkerze
• Spitzwegerich
CAROTINOIDE
Carotinoide sind fettlösliche, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die maßgeblich für die Färbung bestimmter
Pflanzen verantwortlich sind.
Dabei umfassen sie je nach Art und Konzentration ein Farbspektrum von beige über orange bis hin zu rot.
Sie sind beispielsweise für die charakteristische Färbung von Ringelblumenblüten oder Möhren
verantwortlich.
Carotinoide haben ein großes pharmakologisches Potenzial. Je nach Sorte werden ihnen stark antioxidative,
immunmodulierende oder antikanzerogene Wirkungen zugeschrieben.
So werden z.B. Lutein und Zeaxanthin traditionell zur Behandlung von Netzhauterkrankungen eigesetzt.
Beispiele:
• β-Carotin (Ringelblume)
• Lycopin (Tomate)
• Lutein (Grünkohl)
12 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020PFLANZENTEILE ZUBEREITUNGSARTEN 13 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
RICHTIGES SAMMELN VON KRÄUTERN 1. Fernhalten von Straßen, Deponien, Ställen, Hundetoiletten und Ähnlichem 2. an einem sonnigen, trockenen, regenfreien Tag 3. individuelle Reifezeit der Pflanze beachten (meist kurz vor der Blüte) 4. zur Mittagszeit 5. nur saubere und makellose Pflanzen 6. nicht zerkleinern (ganze Blätter oder Blüten usw.) 7. locker sowie luftig lagern und transportieren (Weidenkorb) 8. nicht waschen! RICHTIGES TROCKNEN UND AUFBEWAHREN VON KRÄUTERN 1. locker und luftig (Bettlaken, Körbe, Netze, auf Papierlagen oder kopfüber in Sträußen) 2. an einem warmen, schattigen Ort (Dachboden, Gartenlaube) 3. regelmäßig wenden 4. auf Schimmelbefall und Fäulnis kontrollieren 5. nur saubere und makellose Pflanzen 6. in einem luftdicht verschließbaren und lichtundurchlässigen Gefäß aufbewahren (z.B. Braunglasflaschen) DARREICHUNGSFORMEN PRESSSAFT Saft von gepressten Frischpflanzen oder Frischpflanzenteilen, wie z.B. Früchten oder Knollen. Oft haltbar gemacht durch Einkochen. SIRUP Konzentrierte zuckerhaltige Lösung mit Pflanzenextrakten oder –säften. Ebenfalls oft durch Einkochen haltbar gemacht DEKOKT (ABKOCHUNG) Auszug einer Teedroge oder einer Teemischung durch Aufkochen mit Wasser. Vorwiegend bei harten, ganzen, geschnittenen oder gequetschten Bestandteilen wie z.B. Hölzer, Rinden, Wurzeln, usw. Den Dekokt bereitet man, indem man einen Teelöffel einer Teemischung mit 150 ml Wasser aufkocht und für 15 – 30 Minuten bei geringer Hitze abgedeckt weitersieden lässt. Danach seiht man den Tee ab und presst die Pflanzenrückstände gut aus. Der fertige Dekokt wird warm und langsam getrunken. 14 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
INFUS (AUFGUSS) Auszug einer Teedroge oder einer Teemischung durch Übergießen mit kochendem Wasser und anschließendem Ziehenlassen. Vorwiegend bei zerkleinerten oder pulverisierten Bestandteilen wie z.B. Blüten, Blätter, usw. Zur Bereitung eines Aufgusses gibt man in der Regel einen Teelöffel einer Teemischung in ein Gefäß und übergießt mit etwa 150 ml kochendem Wasser. Um weniger ätherische Öle zu verlieren, deckt man das Gefäß ab. Nach ca. 10 Minuten seiht man den fertigen Tee ab, und presst die Pflanzenrückstände gut aus und trinkt ihn langsam, warm. MAZERAT (KALTAUSZUG) Häufig gebräuchlich bei TCM-Mischungen, aber auch bei einheimischen Kräutern wie Mistel und Bärentraube, die Bachblütenurtinkturen fallen ebenfalls darunter Man gibt meist einen Teelöffel der Mischung in ein Gefäß zusammen mit 150 ml kaltem Wasser oder Wein. Die Ziehdauer variiert je nach Rezept zwischen 2 und 24 Stunden. Danach wird der fertige Auszug abfiltriert und den Tag über getrunken. ÖLAUSZUG (MACERATUM OLEOSUM) Auszug einer Pflanzendroge oder einer Pflanzenmischung durch mehrstündiges bis wochenlanges Ausziehen in einem Pflanzenöl (z.B. Johanniskrautöl, Klatschmohnöl, usw.) Bei frischen Pflanzen mischt man meist im Verhältnis 1:2; bei getrockneten Kräutern eher 1:5. Die Mazerationszeit beträgt zwischen vier bis sechs Wochen. Man verwendet dabei luftdicht abschließende, meist lichtundurchlässige Gefäße. Ein Beispiel dafür ist das Johanniskrautöl (Rotöl). Es wird traditionell immer aus frischem Pflanzengut hergestellt und in Klarglasbehältern in der prallen Sonne mazeriert. Um alle Trübstoffe restlos zu entfernen, filtert man am Ende der Mazeration durch feines Filterpapier. TINKTUR Eine Tinktur ist ein Kaltauszug in Alkohol. Häufig verwendet man dazu 70%igen Alkohol. Das Verhältnis von Alkohol zu Pflanzengut kann unterschiedlich sein. In der Regel beträgt es 1:5 oder 1:10. In der Praxis verwendet man dann beispielsweise bei einem Mischungsverhältnis von 1:5 einen Teil der Teemischung und gibt ihn zusammen mit fünf Teilen Alkohol in ein luftdicht verschließbares, lichtundurchlässiges Gefäß. Je nach Rezept lässt man die Mischung zwischen 10 Tagen und 6 Wochen ziehen. Danach filtert man ab. Eine Tinktur sollte klar sein. Bei noch vorhandenen Trübungen, die nicht durch Filtrieren entfernbar sind, kann man die Tinktur absetzen lassen und danach die klaren Anteile mit einer Pipette abtrennen. 15 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
EXTRAKT
Extrakte werden hergestellt, indem man zunächst die Pflanzeninhaltsstoffe in einem geeigneten Lösungsmittel
(Wasser, Alkohol, Äther oder Hexan) löst, die Pflanzenrückstände entfernt und dann das Lösungsmittel mehr
oder weniger stark entfernt. Der Rückstand ist der fertige Extrakt.
Je nach Restkonzentration des Lösungsmittels unterscheidet man:
• Dünne Extrakte (Extracta tenua) mit einer Konsistenz von frischem Honig
• Dicke Extrakte (Extracta spissa), die nicht mehr fließfähig sind
• Trockenextrakte (Extracta sicca), die nahezu kein Lösungsmittel mehr enthalten
Eine Besonderheit ist der Fluidextrakt. Hier wurde schon von Anfang an möglichst wenig Lösungsmittel
zugegeben. Meist verwendet man dazu ein Mischungsverhältnis von 1:1.
TABLETTE UND KAPSEL
Pulverisierte Pflanzenteile oder Extrakte zu Tabletten gepresst oder in Kapseln gefüllt
CREME UND SALBE
Reine Fettcremes oder mit Hilfe von Emulgatoren (z.B. Wollfett oder Lecithin) hergestellte Öl-Wasser-
Emulsionen mit pflanzlichen Wirkstoffen (z.B. Auszüge oder ätherische Öle)
ZÄPFCHEN
Bei Zimmertemperatur feste Fette (z.B. Kokos- oder Palmfett) mit pflanzlichen Wirkstoffen (z.B. Auszüge oder
ätherische Öle) angereichert und in Form gebracht.
ÄTHERISCHES ÖL
Gewonnen durch Destillation von Pflanzenteilen (Lavendel), Kaltpressung von Fruchtschalen (Orange) oder
Lösungsmittel-Extraktion (Jasmin).
Findet Anwendung gering dosiert pur auf der Haut oder oral mit Zucker, verdünnt in alkoholischer Lösung oder
fetten Ölen (Therapeutische Aromamassage), zur Beduftung, Inhalation, für Wickel und Umschläge sowie in
Speisen
16 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE DESTILLATION
Mit Hilfe der Destillation können ätherische Öle
extrahiert werden.
Die Pflanzenteile werden von unten nach oben mit
Wasserdampf durchströmt.
Dabei werden die ätherischen Öle herausgelöst
und mit dem Dampf mitgerissen.
Im Kühler kondensiert der Dampf wieder zu
Wasser und tropft gemeinsam mit den Ölen in den
Auffangbehälter.
Bedingt durch die schlechte Löslichkeit in Wasser
und die unterschiedliche Dichte schwimmen die
ätherischen Öle entweder über der
Wasseroberfläche als Film oder sinken unter die
Wassersäule ab.
Mittels einer Pipette können die Öle relativ
einfach vom Wasser getrennt werden.
17 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020Großer Destillationsapparat (links Kessel, rechts Kühler, vorne Auffangbehälter) Mobiler Destillationsapparat zur Direktdestillation auf dem Feld (für Lavendel) 18 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
Destillationsergebnis – Öl-Wasser-Phase (Das ätherische Öl schwimmt auf der Wasseroberfläche) 19 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE RINGELBLUME
DIE RINGELBLUMENSALBE
• 70 g frisches Schweineschmalz
• ca. 6 g Ringelblumenblüten
Das Fett schmelzen (nicht über 100 °C) und die
Blüten darin ca. 15 Minuten ziehen lassen.
Anschließend durch Gaze filtern und abkühlen
lassen.
HILFT GUT BEI:
• Schnittverletzungen
• Hautentzündungen
• geschwollenen Drüsen
20 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE ARNIKA 21 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE DEUTSCHE KAMILLE 22 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DAS ÄTHERISCHE DEUTSCHE KAMILLENÖL
FARBE blau
DUFT mild krautig, süßlich
DUFTBEREICH Herznote
GEWINNUNG Wasserdampfdestillation der Blüten
ERGIEBIGKEIT 300 kg ergeben einen Liter Öl
PREIS ca. 12 € pro ml
KONZENTRATION max. 1 Tropfen auf 10 ml fettes Öl
PSYCHISCH
• entspannend
• besänftigend
• antidepressiv
KÖRPERLICH
• lindert Heuschnupfen, Asthma, Ekzeme
• Magenkrämpfe, Gastritis, Geschwüre
• Hautprobleme
• rheumatische Erkrankungen
• entzündete Wunden, Ulzera und Verbrennungen
• Amenorrhö, PMS
• senkt die leicht die Harnstoffkonzentration im Blut
23 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE PFEFFERMINZE 24 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DAS ÄTHERISCHE PFEFFERMINZÖL
FARBE schwach grünlich
DUFT frisch, intensiv, minzig
DUFTBEREICH Herznote
GEWINNUNG Wasserdampfdestillation des Krauts
ERGIEBIGKEIT 100 kg ergeben einen Liter Öl
PREIS ca. 2 € pro ml
KONZENTRATION max. 1 Tropfen auf 10 ml fettes Öl
PSYCHISCH
• klärend
• konzentrationsfördernd
• vitalisierend
KÖRPERLICH
• Schnittwunden und kleineren Verletzungen (pur)
• Kopfschmerzen und Migräne
• Magen- und Darmkrämpfe
• Blähungen
• Sinusitis (Inhalation)
• für Wadenwickel (2 Tropfen Pfefferminze auf 2 EL Weingeist. In einer großen Schüssel mit kaltem
Wasser verrühren.)
• zur Mundpflege
ACHTUNG!
• Nicht während der ersten drei Schwangerschaftsmonate einnehmen!
• Nicht während einer homöopathischen Behandlung anwenden!
• Nicht abends anwenden, da Pfefferminzöl zu Einschlafschwierigkeiten führen kann.
• Ätherisches Pfefferminzöl ist in hoher Dosierung toxisch! (Niere)
25 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE MELISSE 26 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DAS ÄTHERISCHE MELISSENÖL
FARBE gelblich
DUFT frisch, sanft, warm, zitrusartig
DUFTBEREICH Herznote
GEWINNUNG Wasserdampfdestillation des Krauts
ERGIEBIGKEIT 7000 kg ergeben einen Liter Öl
PREIS 21 € pro ml
KONZENTRATION max. 1 Tropfen auf 25 ml fettes Öl
PSYCHISCH
• Depression
• Schlaflosigkeit
• Unruhe und Nervosität
• Albträume
• Gefühlsschwankungen
• Wetterfühligkeit
KÖRPERLICH
• Herpes und Gürtelrose
• Heuschnupfen und Asthma
• Nervöse Herz- Kreislaufbeschwerden
• Kopfschmerzen und Migräne
• Menstruationsbeschwerden
• Wechseljahrsbeschwerden
• Insektenstiche
• Nervöse Magen- und Darmbeschwerden
• Hypertonie (nervös)
ACHTUNG!
Nicht anwenden in der Schwangerschaft!
27 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DAS JOHANNISKRAUT 28 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DAS ROTÖL (JOHANNISKRAUTÖL)
FARBE rot
GEWINNUNG Ölmazerat aus Blüten
KONZENTRATION pur
KÖRPERLICH
• Neuralgien und Neuritis
• Muskel- und Knochenbeschwerden
• rheumatische Erkrankungen
• Verrenkungen und Verstauchungen
• Blutergüsse
• geschwollene Drüsen
• Gürtelrose
• als Massageöl (z.B. Dorn und Breuss)
ACHTUNG!
Nach der Anwendung nicht der Sonne aussetzen!
29 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE BRENNNESSEL
Verwendung: Wirkung:
• benigne Prostatahyperplasie (Wurzel) • erhöht das Miktionsvolumens
• Harnwegsinfektionen (Kraut, Blätter) • erniedrigt die Restharnmenge
• Blasenentzündung (Kraut, Blätter) • durchblutungsfördernd
• rheumatische Beschwerden • harntreibend
• zur Entgiftung & Entschlackung
• als Lebensmittel (Spinatersatz)
30 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DIE MISTEL 31 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE SCHAFGARBE 32 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DAS ÄTHERISCHE SCHAFGARBENÖL
FARBE blau
DUFT mild krautig, leicht bitter
DUFTBEREICH Herznote
GEWINNUNG Wasserdampfdestillation der Blüten
ERGIEBIGKEIT 250 kg ergeben einen Liter Öl
PREIS ca. 7 € pro ml
KONZENTRATION max. 2 Tropfen auf 10 ml fettes Öl
PSYCHISCHE WIRKUNG
• kräftigend
• harmonisierend
• entspannend
• schlaffördernd
• hilft, negative Erfahrungen zu verarbeiten
KÖRPERLICHE WIRKUNG
• Verstauchungen und Zerrungen
• Erkältung, Katarrh, Fieber
• Prostatitis
• Neuralgien und Neuritis
• rheumatische Erkrankungen
• Hypertonie
• Harnwegsinfekte und Nierensteine
• Hautprobleme, Akne, Cellulite
• Entkrampfend auf Leber und Galle und Darm, bei Blähungen
• Reguliert weibliches Hormonsystem
• Unterleibsentzündung
• Menstruationsbeschwerden
• Zur Wundbehandlung, bei Entzündungen und in der Kosmetik
ACHTUNG!
Nicht geeignet für Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder!
33 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020DER WERMUT 34 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
DIE ACHT REGELN FÜR RICHTIGES REZEPTIEREN WICHTIGE FORMULIERUNGEN UND ABKÜRZUNGEN 35 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
BEISPIELREZEPT 36 Phytotherapie - Basiswissen © Daniel Lorenz (HP) 2020
Sie können auch lesen