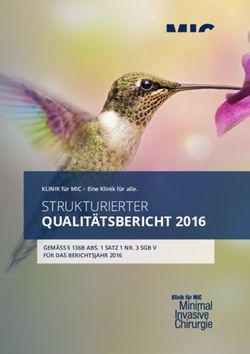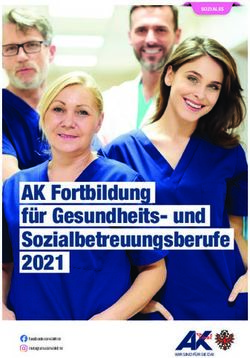EHE-GÜTERRECHT ERBRECHT INVENTURWESEN ERBSTEUERN SCHENKUNGSSTEUERN - Eine Dienstleistung der Gemeinde Sprei-tenbach
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eine Dienstleistung der Gemeinde Sprei-
tenbach
EHE-GÜTERRECHT
ERBRECHT
INVENTURWESEN
ERBSTEUERN
SCHENKUNGSSTEUERN
Verwaltungskurs 2004
(Stand 2012)
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1INHALTSVERZEICHNIS
I. Güterrecht (ZGB 181 - 251) Seite
a) Grundsatz 3
b) Güterstände 3 - 11
b1 Errungenschaftsbeteiligung 3-5
b2 Gütergemeinschaft 6-8
b3 Gütertrennung 9
b4 Güterverbindung 10 - 11
c) Ehevertrag 11
Fragen zum Güterrecht 12 - 17
II. Erbrecht (ZGB 457 - 640)
a) Grundsatz 18
b) Gesetzliche Erben 18
c) Erbberechtigte Verwandte 19
d) Gesetzliche Erbteile 20 & 24
e) Verfügungen von Todes wegen (Testament) 21 - 22
f) Erbvertrag 22
g) Gesetzliche Pflichtteile 23 - 24
h) Willensvollstrecker 25
i) Ungültigkeit & Herabsetzung von letztwilligen Verfügungen 25
j) Enterbung und Erbunwürdigkeit 25
k) Erbgang und Erbteilung 26
l) Erwerb und Ausschlagung 26
m) Sicherungsmassregeln 26
Fragen zum Erbrecht 27 - 30
III. Inventarisation, Sicherungsmassregeln (ZGB 551 ff und StG)
a) Sicherungsmassregeln 31 - 32
b) Sicherungsinventar 32
c) Steuerinventar 33
d) Öffentliches Inventar 33
e) Erbenverzeichnis, Erbgangsurkunde 34 - 36
f) Praxis im Inventurwesen (Verfügungsbeschränkung,
Unterj. Steuererklärung, erbsteuerpflichtiger/nicht pflichtiger Fall) 37 - 44
Fragen zum Inventurwesen 45 - 46
IV. Erbsteuer- und Schenkungssteuerwesen (StG §§ 142 - 151)
a) Steuerpflicht 47
b) Steuerbegünstigte 47
c) Steuerberechnung, Grundsatz, Klassen 47
d) Steuersatzbestimmung 47
e) Schenkungen 48
f) Erb- und Schenkungssteuer-Veranlagungen 49 - 50
Fragen zum Erbsteuer- und Schenkungssteuerwesen 51
Anhang mit rechtlichen Grundlagen 52 - 60
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 2I. Güterrecht (Art 181 ff ZGB)
I. a) Grundsatz
Das Güterrecht regelt die Vermögensverhältnisse der Ehegatten während der
Ehe und die Ansprüche jedes Ehegatten bei Auflösung der Ehe (Scheidung,
Trennung, Tod). Das Güterrecht hat beim Tod einer verheirateten Person direkte
Auswirkungen auf das Erbrecht, indem es festlegt, welcher Vermögensteil kraft
Güterrecht vorweg an den überlebenden Ehegatten fällt und somit nicht in die
Erbmasse gelangt. In diesem Sinne geht also das Güterrecht dem Erbrecht vor.
I. b) Güterstände
Das Gesetz unterscheidet 4 Güterstände. Es sind dies
die Errungenschaftsbeteiligung,
die Gütergemeinschaft,
die Gütertrennung und
die Güterverbindung.
Zudem ist es möglich, diese Güterstände mittels Vertrag in einzelnen Positionen
anzupassen.
I. b1) Errungenschaftsbeteiligung
Die Errungenschaftsbeteiligung ist der ordentliche Güterstand und wird durch die
Eheschliessung angenommen.
Eigentum, Nutzung und Verwaltung der Vermögensmassen (Eigengut und Er-
rungenschaft) beider Ehegatten sind formaljuristisch gesehen getrennt.
Jeder Ehegatte kann somit allein über sein Eigengut und seine Errungenschaft
verfügen. In seiner Freiheit ist er nur durch die allgemeinen Verpflichtungen der
Ehe eingeschränkt.
Jeder Ehegatte ist aber an der Errungenschaft des anderen Partners zur Hälfte
beteiligt.
Mittels Ehevertrag kann eine andere Teilung vorgesehen werden (z.B. Zuwei-
sung des ganzen Vorschlages an den überlebenden Ehegatten. Diese Begünsti-
gung darf aber die Pflichtteile nicht gemeinsamer Nachkommen nicht verletzen;
Begründung s. Ehevertrag).
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 3Es werden 4 Vermögensmassen unterschieden. Diese werden wie folgt
definiert:
Eigengut Mann/Frau (bei Errungenschaftsbeteiligung)
Eigengut ist alles, was ein Ehegatte im Zeitpunkt der Eheschliessung bereits
besessen hat (= eingebrachtes Gut),
was ihm während der Ehe unentgeltlich zufliesst
(= Erbschaften, Schenkungen, Genugtuungen, Ersatzbeschaffungen für Ei-
gengut) als auch
die persönlichen Gebrauchsgegenstände (z.B. Kleider).
Errungenschaft Mann/Frau (bei Errungenschaftsbeteiligung)
Errungenschaft ist alles, was während der Ehe entgeltlich erworben, also er-
arbeitet wird (Arbeitserwerb, Leistungen der Sozialversicherungen als Ein-
kommensersatz),
die Erträge aus dem Eigengut und aus der Errungenschaft, als auch
Vermögenswerte, welche aus der Errungenschaft gekauft worden sind.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 4Güterrechtliche Auseinandersetzung (bei Errungenschaftsbeteiligung)
Bei Auflösung des Güterstandes sind das Eigengut und die Errungenschaft zu
ermitteln. Das Eigengut bleibt beim jeweiligen Ehegatten; die Errungenschaft, al-
so was jeder Ehegatte erarbeitet hat, wird als Vorschlag bezeichnet und ist unter
den Ehegatten je zur Hälfte zu teilen. Ein allfälliger Minussaldo der Errungen-
schaft bedingt durch Misswirtschaft wird als Rückschlag bezeichnet und ist vom
Verursacher selbst zu tragen (wird nicht geteilt). In der Praxis ist das Aufsplittern
der beiden Errungenschaften oft nur schwer möglich.
Ermittlung Errungenschaft
Mann Frau
Total Aktiven 100'000 300'000
./. Errungenschaftsschulden
(= Passiven ohne Todesfallkosten) 140'000 010'000
= Reinvermögen
vor güterrechtl. Auseinandersetzung -40'000 290'000
./. abzüglich Eigengüter 050'000 100'000
= Errungenschaft -090'000 190'000
(Rückschlag) (Vorschlag)
Güterrechtliche Auseinandersetzung
Mann Frau
Aufteilung Errungenschaft Mann -90'000 000'000
Aufteilung Errungenschaft Frau (je ½) +95'000 095'000
Eigengüter +50'000 100'000
= güterrechtlicher Anspruch +55'000 195'000
Sofern aus Aufgabe ersichtlich:
Anspruch Erblasser (Mann) 55'000
./. Todesfallkosten 25'000
= Erbmasse netto (erbrechtl. Reinvermögen) 30'000
(Erst ab hier kommt dann das Erbrecht zum Zuge.)
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 5I. b2) Gütergemeinschaft
Die Gütergemeinschaft wird durch Ehevertrag begründet. Das gesamte Vermö-
gen beider Ehegatten wird zum Gesamtgut vereinigt, soweit es sich nicht um Ei-
gengut oder spezielle im Ehevertrag dem Eigengut zugewiesene Wertsachen
handelt. Bei Auflösung des Güterstandes erhalten die Ehegatten je ½ des Ge-
samtgutes zuzüglich ihrem "bescheidenen" Eigengut. Im Ehevertrag kann eine
andere Teilung vorgesehen werden (z.B. Zuweisung des ganzen Vorschlages an
den überlebenden Ehegatten. Diese Begünstigung darf aber die Pflichtteile nicht
gemeinsamer Nachkommen nicht verletzen; Begründung s. Ehevertrag).
Bei der Gütergemeinschaft werden 3 Vermögensmassen unterschieden. Diese
werden wie folgt definiert:
Gesamtgut (Gütergemeinschaft)
Dazu gehören alle Vermögenswerte der Ehegatten vor der Eheschliessung (ein-
gebrachtes Gut), zuzüglich Erbschaften, Schenkungen und Arbeitserwerb. Wäh-
rend der Ehe können die Ehegatten nur gemeinsam über das Gesamtgut verfü-
gen.
Eigengut Mann/Frau (Gütergemeinschaft)
Dazu gehören nur die persönlichen Gebrauchsgegenstände (z.B. Kleider) und
die ev. im Ehevertrag speziell dem Eigengut zugewiesenen Werte.
Berechnungsschema zur Ermittlung der Ansprüche bei der Gütergemein-
schaft, sofern im Ehevertrag kein spezielles Eigengut definiert worden ist.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 6Berechnungsschema zur Ermittlung der Ansprüche bei der Gütergemein-
schaft, sofern im Ehevertrag kein spezielles Eigengut definiert worden ist.
Ermittlung Gesamtgut (Gütergemeinschaft)
Eingebracht durch Mann 100'000
Erbschaft Mann während Ehe 150'000
Eingebracht durch Frau 500'000
Schenkung Frau während Ehe 250'000
= Gesamtgut 1'000'000
Güterrechtliche Auseinandersetzung (Gütergemeinschaft)
Anteil Mann ½ am Gesamtgut 500'000
Anteil Frau ½ am Gesamtgut 500'000
Hinweis: Es hat keinen Einfluss auf Berechnung,
woher das Geld kommt (Erbschaft, Schenkung, Arbeitserwerb etc.)
Sofern aus Aufgabe ersichtlich:
Anspruch Erblasser (Mann) 500'000
./. Todesfallkosten 025'000
= Erbmasse netto (erbrechtl. RV) 475'000
Erst ab hier kommt dann das Erbrecht zum Zuge.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 7Berechnungsschema zur Ermittlung der Ansprüche bei der Gütergemein-
schaft, sofern im Ehevertrag spezielles Eigengut definiert worden ist.
Ermittlung Gesamtgut & Eigengut (Gütergemeinschaft)
Total Aktiven 950'000
./. total Passiven 100'000
= Reinvermögen vor Auseinandersetzung 850'000
Eigengut Mann gemäss Ehevertrag 150'000
Güterrechtliche Auseinandersetzung (Gütergemeinschaft)
Reinvermögen vor Auseinandersetzung 850'000
./. Eigengut Ehemann gem. Ehevertrag 150'000
Gesamtgut 700'000
Anteil Mann ½ am Gesamtgut 350'000
zuzüglich Eigengut Mann gem. Vertrag 150'000
Total Anspruch Mann 500'000
Anteil Frau ½ am Gesamtgut 350'000
Sofern aus Aufgabe ersichtlich:
Anspruch Erblasser (Mann) 500'000
./. Todesfallkosten 025'000
= Erbmasse netto (erbrechtl. RV) 475'000
Erst ab hier kommt dann das Erbrecht zum Zuge.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 8I. b3) Gütertrennung
Die Gütertrennung erfolgt durch
Ehevertrag,
Gerichtsurteil oder
von Gesetzes wegen
(nur bei Gütergemeinschaft bei Konkurseröffnung gegen einen Ehegatten)
Dabei wird gleichzeitig eine güterrechtliche Auseinandersetzung mit voll-
ständiger Trennung der Vermögen beider Ehegatten vorgenommen. Bei
Auflösung der Ehe ist daher keine güterrechtliche Auseinandersetzung
mehr nötig.
Einfach formuliert kann festgehalten werden, dass die Vermögenssituation
bei den Ehegatten so wäre, als ob keine Heirat stattgefunden hätte. Die
Gütertrennung kann dann sinnvoll sein, wenn ein Ehegatte ein eigenes
Geschäft auf selbständiger Basis führt.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 9I. b4) Güterverbindung
Die Güterverbindung ist der altrechtliche Güterstand und wurde automa-
tisch mit der Eheschliessung bis zum 31.12.1987 angenommen. Er wird
heute nur noch selten angetroffen, da der Güterstand automatisch in die
Errungenschaftsbeteiligung überging, wenn nicht im Übergangsjahr 1988
eine Beibehaltungserklärung beim Güterrechtsregisteramt abgegeben
wurde oder wenn vor dem 1.1.1988 ein Ehevertrag mit Inhalt der Güter-
verbindung mit Modifikationen (z.B. Änderung der Vorschlagsteilung) ab-
geschlossen wurde.
Bei der Güterverbindung wird das Eigentum am eingebrachten Gut ge-
wahrt. Die Nutzung und Verwaltung des eingebrachten Gutes werden aber
zusammengelegt und dem Mann übertragen, der bis zur Teilung auch Ei-
gentümer der Errungenschaft ist. Bei der Teilung erhalten der Mann 2/3
der Errungenschaft; die Frau erhält 1/3 der Errungenschaft und ihr Son-
dergut (Sondergut = Einkommen Frau aus selbständiger Tätigkeit wäh-
rend der Ehe).
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 10Bei der Güterverbindung werden 5 Vermögensmassen unterschieden.
Sondergut Mann Sondergut Frau
Persönliche Gegenstände Persönliche Gegenstände
Sondergut gem. Ehevertrag Arbeitserwerb
Betriebseinkommen
Sondergut gem. Ehevertrag
Eingebrachtes Gut Eingebrachtes Gut
Vermögen bei Eheschliessung Vermögen bei Eheschliessung
Erbschaften Erbschaften
Schenkungen Schenkungen
Errungenschaft Mann
Einkommen Mann aus Arbeit
Erträge aus den eingebrachten Gütern beider Ehegatten
Kommentar:
Die Teilung mit 2/3 zu 1/3 Drittel erscheint auf den ersten Blick ungerecht.
Andererseits musste die Frau ihr Einkommen nicht teilen, was einen ge-
wissen Ausgleich bewirkte. Sicher ist die heutige Regelung mit der Errun-
genschaftsbeteiligung die bessere Lösung.
I. c) Ehevertrag
Die Ehegatten können mittels Ehevertrag einen anderen Güterstand an-
nehmen oder innerhalb des Güterstandes gewisse Änderungen vorneh-
men. Eheverträge sind nur gültig, wenn sie in der gesetzlichen Form ab-
geschlossen werden; dies ist die öffentliche Beurkundung (Urkunde vor
einem Notar).
Im Ehevertrag können sich die Ehegatten gegenseitig begünstigen und
den gesamten Vorschlag dem überlebenden Gatten zuweisen. Die Pflicht-
teilsansprüche der nicht gemeinsamen Nachkommen dürfen dabei nicht
verletzt werden. Die Erklärung liegt gemäss Erbrecht auf der Hand: (Bei-
spiel aus Sicht des Kindes) Würde das Kapital vom verstorbenen Elternteil
(z.B. Mann = Vater) auf den nicht verwandten überlebenden Ehegatten
(Frau = Stiefmutter) übergehen, würden beim Ableben der Frau (= Stief-
mutter) nur deren Erben zum Zuge kommen.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 11Fragen zum Güterrecht
01. In welchem Gesetz ist das Güterrecht geregelt?
__________________________________________
02. Was regelt das Güterrecht?
03. Welche 4 Güterstände nennt das Gesetz?
04. Wie heisst der ordentliche Güterstand?
05. Wie wird der ordentliche Güterstand angenommen?
06. Welche 4 Vermögensmassen werden bei ordentlichen Güterstand unter-
schieden?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1207. Wie setzt sich beim ordentlichen Güterstand das Eigengut zusammen?
08. Wie setzt sich beim ordentlichen Güterstand die Errungenschaft zusammen?
09. Wie wird beim ordentlichen Güterstand die Errungenschaft geteilt und was
passiert mit dem Eigengut?
10. Machen Sie eine einfache güterrechtliche Auseinandersetzung für den Güter-
stand der Errungenschaftsbeteiligung und verwenden Sie die nachfolgenden
Daten:
Vom Mann in Ehe eingebracht Fr. 200'000
Erbschaft Mann während Ehe Fr. 200'000
Von Frau in Ehe eingebracht Fr. 100'000
Schenkung Frau während Ehe Fr. 100'000
Total Aktiven Ehefrau bei Auflösung Güterstand Fr. 300'000
Total Aktiven Ehemann bei Auflösung Güterstand Fr. 650'000
Errungenschaftspassiven Mann Fr. 25'000
Errungenschaftspassiven Frau bei Tod Ehefrau Fr. 25'000
Was erhält der überlebende Ehegatte (Mann) gemäss Güterrecht und wieviel
beträgt das erbrechtliche Reinvermögen?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1311 Güterrechtliche Auseinandersetzung (Errungenschaftsbeteiligung); vollständi-
ge Lösungsversion mit Darstellung aller Vermögensmassen
Aktiven Mann bei Tod: ............................... Fr. 11'000
Aktiven Frau bei Tod Mann ........................ Fr. 15'000
Errungenschaftsschulden Mann ................ Fr. 1'000
Errungenschaftsschulden Frau .................. Fr. 3'000
Todesfall- und Inventarkosten ................... Fr. 2'000
eingebrachtes Gut Frau ............................. Fr. 3'000
eingebrachtes Gut Mann ........................... Fr. 0
Erbschaft Mann während Ehe ................... Fr. 0
Schenkung Frau während Ehe .................. Fr. 1'000
Was erhält der überlebende Ehegatte gemäss Güterrecht und wieviel beträgt
das erbrechtliche Reinvermögen?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1412 Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Errungenschaftsbeteiligung unter
Darstellung aller Vermögensmassen
Eingebrachtes Gut Mann 20'000
Erbschaft Mann während Ehe 20'000
Eingebrachtes Gut Frau 10'000
Schenkung Frau während Ehe 10'000
Aktiven Frau bei Tod Mann 95'000
Aktiven Mann bei dessen Tod 80'000
Errungenschaftsschuld Frau 25'000
Errungenschaftsschuld Mann 15'000
Der Lösungsweg muss aufgezeigt werden. Wie hoch sind die Errungenschaf-
ten der Ehegatten? Wie gross ist der güterrechtliche Anspruch?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1513 Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Errungenschaftsbeteiligung unter
Darstellung aller Vermögensmassen
Eigengut Mann 0
Eigengut Frau 10'000
Aktiven Frau bei Tod Mann 90'000
Aktiven Mann bei dessen Tod 20'000
Errungenschaftsschuld Frau 25'000
Errungenschaftsschuld Mann 25'000
Der Lösungsweg muss aufgezeigt werden.
Wie hoch sind die Errungenschaften der Ehegatten?
Wie gross ist der güterrechtliche Anspruch?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 1614 Was gehört zum Eigengut bei der Gütergemeinschaft?
15 Was gehört zum Gesamtgut bei der Gütergemeinschaft?
16 Ist beim Güterstand der Gütertrennung noch eine güterrechtliche Auseinan-
dersetzung nötig beim Versterben eines Ehegatten? Falls ja/nein: warum?
17 Seit wann gilt das neue Eherecht?
18 Wie heisst der altrechtliche Güterstand, welcher bis zur Einführung des neuen
Eherechtes angenommen wurde?
19 Wie viel erhalten die Ehegatten kraft Güterrecht bei der Auflösung des Güter-
standes, wenn sie den altrechtlichen Güterstand beibehalten haben (bzw. wie
sah die Situation früher aus)?
20 Wie kann ein anderer Güterstand angenommen werden?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 17II. Erbrecht (Art 457 ff ZGB)
II. a) Grundsatz
Das Erbrecht regelt die Vermögensnachfolge beim Tod einer Person (Erb-
folge) und hält fest, wie und wie weit jemand über Erbfolge und Vermö-
genswerte selber bestimmen kann. Ferner regelt es die Beziehungen der
Erben untereinander. Der Erbgang erfolgt am letzten Wohnsitz des Erb-
lassers, wobei das Vermögen mit dem Tod nahtlos an die Erbengemein-
schaft übergeht.
II. b) Gesetzliche Erben (Erbfolge)
Wenn der Erblasser nichts anderes bestimmt hat, kommt die gesetzliche
Erbfolge zur Anwendung. Der Erblasser ist aber frei, in den Schranken der
Rechtsordnung die Erbfolge durch Verfügung von Todes wegen (Testa-
ment oder Erbvertrag) abzuändern oder aufzuheben. Dazu und zur Verfü-
gungsfreiheit aber später.
Als gesetzliche Erben werden genannt:
die Verwandten
der überlebende Ehegatte
das Gemeinwesen
Die Verwandten und der überlebende Ehegatte kommen gemeinsam zum
Zuge. Nur wenn weder Verwandte noch ein Ehegatte vorhanden sind, und
der Erblasser nichts mittels Testament verfügt hat, gilt das Gemeinwesen
als Erbe. Unter dem Gemeinwesen werden die Gemeinde und der Kanton
verstanden, wobei die Gemeinde 1/3 und der Kanton 2/3 "einheimsen".
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 18II. c) Die erbberechtigten Verwandten (Parentelenordnung)
Die Nachkommen: Die Nachkommen erben zu gleichen Teilen. An Stelle
vorverstorbener Kinder treten deren Nachkommen;
falls keine Nachkommen vorhanden sind, gelangt die
Erbschaft an
die Eltern: (je zur Hälfte), falls verstorben an deren Nachkom-
men, falls keine vorhanden an
die Grosseltern: falls verstorben, an deren Nachkommen. Fehlt es
auch dort an Erben und ist kein Testament oder Erb-
vertrag vorhanden, kommt das Gemeinwesen zum
Zuge.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 19II. d) Gesetzliche Erbteile (= gesetzlicher Anspruch)
Sofern kein Testament vorhanden ist, erhält der überlebende Ehegatte:
- wenn er mit Nachkommen zu teilen hat, ½ der Erbschaft
- wenn er mit dem Stamm der Eltern zu teilen hat, ¾ der Erbschaft
- wenn keine Erben des elterlichen Stammes vorhanden sind, die
ganze Erbschaft
Die gesetzlichen Erbteile sind in der Graphik auf Seite 18 abgebildet
Berechnung des gesetzlichen Erbteils, Vorgehen
1. Aufzeichnung Erbfolge (ges. Erben bzw. erbberechtigte Verwandte)
2. Berechnung der Erbanteile (was erbt Ehegatte neben ...)
3. Falls ein Erbteil auf mehrere Personen aufgeteilt werden muss, ist
dies wie folgt zu tun:
- Erbteil aufschreiben;
- Zähler und Nenner x Anzahl Personen (Erben gleicher Stufe);
- = Erbteil anders dargestellt
- alsdann aufteilen auf Personen
Beispiel:
Erben sind der Ehegatte und 3 Kinder.
Ehegatte und Kinder erben je zu ½.
Nun sind die Anteile der Kinder auszurechnen, was wie folgt geht:
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
Erbteil Zähler (Anzahl Erben) Erbteil anders dargestellt
Nenner (Anzahl Erben)
Dann Aufteilung der 3/6 auf die 3 Kinder = 1/6 pro Kind
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 20II. e) Verfügungen von Todes wegen (Das Testament)
Wer urteilsfähig und das 18. Altersjahr zurückgelegt hat (= Handlungsfä-
higkeit), ist befugt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Schranken
und Formen über sein Vermögen letztwillig zu verfügen. Der Erblasser
kann in seinem Testament auch über Vermächtnisse oder Legate verfü-
gen. Mit Vermächtnissen und Legaten sind genau definierte Vermögens-
vergabungen an Personen oder Institutionen gemeint, welche nicht zu ei-
nem Anteil an der Gesamterbschaft partizipieren. Als Beispiel dazu kön-
nen genannt werden: Die antike Wanduhr soll mein Neffe Klaus Muster, Neuenhof,
erhalten ... oder .... Meinem Patenkind Rolf Muster, Baden, vermache ich Fr. 2'000.--.
Auch diese Vermächtnisse oder Legate dürfen den Pflichtteil nicht verlet-
zen. Dazu aber später.
Weiter kann der Erblasser dem überlebenden Ehegatten durch Verfügung
von Todes wegen gegenüber den gemeinsamen Nachkommen und den
während der Ehe gezeugten nicht gemeinsamen Kindern und deren
Nachkommen die Nutzniessung an dem ganzen ihnen zufallenden Teil der
Erbschaft zuwenden. Diese Nutzniessung tritt an die Stelle des dem Ehe-
gatten (neben diesen Nachkommen) zustehenden gesetzlichen Erbrechts.
Im Falle der Wiederverheiratung entfällt die Nutzniessung auf jenem Teil
der Erbschaft, der im Zeitpunkt des Erbganges nach den ordentlichen
Bestimmungen über den Pflichtteil der Nachkommen nicht hätte mit der
Nutzniessung belastet werden können. (473 ZGB)
Die Nutzniessung kann auch im Sinne eines Vermächtnisses oder Legates
zu Gunsten von Dritten ausgesprochen werden. Der belastete Teil des
Nachlasses darf die Pflichtteile in diesem Falle nicht verletzten.
Das Testament ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und kann jederzeit vom
Verfasser aufgehoben oder durch eine neue Verfügung ersetzt werden.
Das ZGB geht davon aus, dass die Erbteilung Sache der Erben ist. Diese
können beliebig von der gesetzlichen Erbfolge abweichen, sofern alle Er-
ben dem zustimmen. Auch vermag der Erblasser nicht durch Teilungsre-
geln den Erben, die übereinstimmend anderer Meinung sind, seinen Wil-
len aufzuzwingen.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 21Folgende 3 Testamentsformen (= Verfügungsarten) werden unterschie-
den:
II. e1) Das eigenhändige Testament
muss vollständig handschriftlich geschrieben sein und
Datum und
Unterschrift enthalten.
II. e2) Die letztwillige öffentliche Verfügung (= mit öff. Beurkundung)
erfolgt unter Mitwirkung von 2 Zeugen vor einem Notar;
die Zeugen müssen handlungsfähig sein und dürfen nicht in ge-
rader Linie mit dem Erblasser verwandt sein. Geschwister und
Ehegatten sind ebenfalls ausgeschlossen.
Die mitwirkenden Zeugen dürfen nicht in der Verfügung bedacht
werden.
II. e3) Die letztwillige mündliche Verfügung (= Nottestament)
kann nur bei ao. Umständen (Todesgefahr) erlassen werden;
2 Zeugen müssen den letzten Willen unverzüglich dem Gericht zu Pro-
tokoll geben oder haben ihn sofort schriftlich abzufassen, zu unter-
zeichnen und dem Gericht zu übergeben;
das mündliche Testament verliert seine Wirkung nach 14 Tagen, nach-
dem des dem Verfasser (Testator) möglich war, sich einer anderen
Testamentsform zu bedienen;
es gelten die gleichen Ausschliessungsgründe für Zeugen wie bei der
letztwilligen Verfügung mit öffentlicher Beurkundung (siehe oben).
II. f) Der Erbvertrag
ist kein Testament. Er ist ein 2seitiges Rechtsgeschäft. Dennoch kann
damit der Nachlass geregelt werden. Ein Erbvertrag kann nur mit öffentli-
cher Beurkundung vor einem Notar unter Mitwirkung von 2 Zeugen abge-
schlossen werden. Die Parteien müssen handlungsfähig sein. Es gelten
die gleichen Ausschliessungsgründe für die Zeugen wie beim Testament.
Zweiseitige Rechtsgeschäfte können nur mit Zustimmung der zweiten Par-
tei abgeändert oder aufgehoben werden.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 22II. g) Pflichtteile
Die Erbteilung erfolgt nach Gesetz (gesetzliche Erbteile), sofern der Erb-
lasser nichts über seinen Nachlass verfügt hat. Damit die Nachkommen,
der überlebende Ehegatte und die Eltern von der Willkür des Erblassers
geschützt sind, hat der Gesetzgeber bestimmt, welche Teile des Nachlas-
ses diesen nächsten Erben nicht durch Testament entzogen werden darf.
Dieser nicht entziehbare Erbteil wird Pflichtteil genannt.
Der Pflichtteil beträgt für
einen Nachkommen ¾ des gesetzlichen Anspruchs (= 3/4 des ges. Erbteils)
jeden Elternteil ½ des gesetzlichen Anspruches (= 1/2 des ges. Erbteils)
für den überlebenden Ehegatten ½ des gesetzlichen Anspruchs
(= ½ des gesetzl. Erbteils)
Berechnung des effektiven Pflichtteils, Vorgehen
1. Zuerst gesetzlichen Erbteil ausrechnen (siehe Seite 16)
2. dann ausgerechneten Erbteil x Pflichtteilssatz
Beispiel gemäss Seite 16, Erben sind Ehegatte und 3 Kinder
Berechnung Pflichtteil der Ehefrau
1 x 1 = 1
2 x 2 = 4 (=2/8)
Erbteil x Pflichtteilssatz = effektiver Pflichtteil
Berechnung Pflichtteil der Kinder (3 Kinder, Ausrechnung pro Kind)
1 x 3 = 3
6 x 4 = 24
Erbteil x Pflichtteilssatz = effektiver Pflichtteil
pro Kind (kürzbar durch 3 = 1/8 pro Kind)
Verfügbare Quote =
Der nicht durch den Pflichtteil geschützte Anteil an einer Erbschaft heisst „Ver-
fügbare Quote. Nachstehend die Berechnung zum obigen Bespiel:
8/8 minus 2/8 (Pflichtteil Ehefrau) minus 3/8 (Pflichtteile der 3 Kinder) = 3/8
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 23Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 24
II. h) Der Willensvollstrecker
wird vom Erblasser im Testament oder Erbvertrag eingesetzt
handelt im Auftrag des Erblassers;
er verwaltet das Nachlassvermögen,
vollzieht die testamentarischen Anordnungen und bereitet diese vor
(Teilungsvertrag);
er hat Anspruch auf angemessene Entschädigung; diese beträgt in der
Regel 1 - 3 % der Aktiven (bei geringem Vermögen nach Aufwand)
II. i) Ungültigkeit & Herabsetzung von letztwilligen Verfügungen
Letztwillige Verfügungen, welche die Formvorschriften oder die Pflichtteile
verletzen, können innerhalb 1 Jahres seit Eröffnung durch die Erben beim
Bezirksgericht angefochten werden.
II. j) Enterbung und Erbunwürdigkeit
Wer vorsätzlich oder rechtswidrig den Tod des Erblassers herbeiführt oder
herbeiführen will, oder gegen den Willen des Erblassers Einfluss auf das
Testament nimmt, kann enterbt bzw. als erbunwürdig erklärt werden. Un-
terschied:
Die Enterbung muss vom Erblasser im Testament enthalten und begrün-
det sein.
Die Erbunwürdigkeit muss von den Erben gegen eine der Erbparteien ein-
geklagt werden. Zuständig ist das Bezirksgericht am letzten Wohnort des
Erblassers.
Der Anteil des Enterbten fällt, sofern der Erblasser nicht anders ver-
fügt hat, an die gesetzlichen Erben des Erblassers, wie wenn der
Enterbte den Erbanfall nicht erlebt hätte. (Die Nachkommen des
Enterbten behalten ihr Pflichtteilsrecht, wie wenn der Enterbte den
Erbfall nicht erlebt hätte.)
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 25II. k) Erbgang und Erbteilung
Mit dem Tod des Erblassers geht das Vermögen nahtlos an die Erbenge-
meinschaft über. Die Erbengemeinschaft ist dann Gesamteigentümer der
Erbschaft und kann nur bei Einstimmigkeit handeln. Die Erben haften auch
solidarisch für die Schulden des Erblassers. Jeder Erbe kann jederzeit die
Erbteilung verlangen. Die Erbteilung ist Sache der Erben. Diese können
beliebig von der gesetzlichen Erbfolge abweichen, sofern alle Erben dem
zustimmen. Wird keine Einigung erzielt, so kann beim Bezirksgericht die
gerichtliche Erbteilung verlangt bzw. eingeklagt werden.
II. l) Erwerb und Ausschlagung der Erbschaft
Um die Erbschaft anzunehmen, braucht es keine besondere Erklärung.
Um der automatischen Erbfolge zu entgehen, kann ein Erbe beim zustän-
digen Bezirksgericht (Wohnort Erblasser) die Erbschaft ausschlagen. Die
Ausschlagungserklärung muss innerhalb von 3 Monaten seit Kenntnis des
Todes (in der Regel Todesdatum) eingereicht werden. Bei der Aufnahme
eines durch die Erben beantragten öffentlichen Inventars beträgt die Aus-
schlagungsfrist 1 Monat seit Eröffnung des öff. Inventars durch das Be-
zirksgericht. Mehr dazu im Thema Inventarwesen.
II. m) Sicherungsmassregeln
Die Sicherungsmassregeln sind ebenfalls im ZGB abgehandelt. Es geht
dabei um die Sicherung des Nachlasses und der Verfügungen. Die ge-
nauen Informationen dazu finden Sie im Thema Inventarwesen.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 26Fragen zum Erbrecht
1. In welchem Gesetz ist das Erbrecht geregelt?
__________________________________________________________
2. Wer sind die gesetzlichen Erben?
3. Welches sind die erbberechtigten Verwandten?
4. Was erbt der Ehegatte neben?
a) neben Nachkommen _______________________________________
b) neben Erben des elterlichen Stammes _________________________
c) neben Erben des grosselterlichen Stammes_____________________
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 275. Erbfolge und gesetzliche Erbteile - Lösen Sie folgende Aufgabe indem Sie
zuerst die Parantelenordnung aufzeichnen
diese beschriften und
alsdann die Erbteile ausrechnen und die Graphik entsprechend ergänzen.
Der Erblasser hinterlässt die Ehefrau und 3 Nachkommen. 1 Nachkomme ist
vorverstorben, jedoch verheiratet gewesen und hinterlässt seinerseits 3
Nachkommen.
6. Wer kann ein Testament errichten?
7. Welche Testamentsformen gibt es?
________________________________________________________________
8. Wann erbt das Gemeinwesen?
________________________________________________________________
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 289. Wie wird ein Erbvertrag errichtet (Formvorschriften)?
10. Welche Erben sind pflichtteilsgeschützt?:
________________________________________________________________
11. Wie gross sind die Pflichtteile für
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
12. Wie gross sind die Pflichtteile in folgendem Sachverhalt effektiv (= ausge-
rechnet pro Erbe)? Der Erblasser hinterlässt die Ehefrau und 4 Kinder.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 2913. Wie gross sind die Pflichtteile in folgendem Sachverhalt effektiv
(= ausgerechnet pro Erbe)?
Der Erblasser hinterlässt die Ehefrau und 2 Kinder, wovon 1 vorverstorben ist
und seinerseits 2 Nachkommen hinterlassen hat.
14. Wo und von wem wird der Erbgang eröffnet?
15. Was sind Gründe für eine Enterbung?
16. Wie, wo und innert welcher Fristen kann die Erbschaft ausgeschlagen wer-
den?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 30III. Inventurwesen (ZGB 551 ff und StG)
III. a) Sicherungmassregeln (ZGB)
Die zuständige Behörde am letzten Wohnsitz des Erblassers hat von Am-
tes wegen die zur Sicherung des Nachlasses nötigen Massregeln zu tref-
fen. Es sind dies insbesondere:
Die Siegelung (Art. 552 ZGB)
Sie wird vom Gemeinderat angeordnet, wenn Gefahr besteht, dass Teile
der Erbschaft durch Dritte oder die Erben selbst vor der Inventaraufnahme
weggeschafft werden könnten. In der Praxis ist die Siegelung eher selten.
Die Siegelung, insbesondere das Auswechseln von Schliesszylindern von
Wohnungstüren, kann von der Behörde auch gestützt auf das ZGB, das
StG und auch Art. 292 des Strafgesetzbuches (StGB) durchgesetzt wer-
den (Art. 292 StG: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Be-
amten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung
nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft.)
Aufnahme öffentliches oder Sicherungsinventar (Art. 553 ZGB)
Die Aufnahme des öffentlichen oder des Sicherungsinventars stützt sich
auf das Erb- und das Vormundschaftsrechtrecht. Die Aufnahme des Steu-
erinventars basiert auf dem Steuergesetz und ist keine eigentliche Siche-
rungsmassregel. Dazu später.
Einreichungspflicht von Testamenten (Art. 556 ZGB)
Bei der Inventaraufnahme vorgefundene oder von den Erben übergebene
letztwillige Verfügungen (Testamente/Erbverträge) sind immer sofort dem
Bezirksgericht einzureichen. Es ist nicht Aufgabe der Inventurbehörde, die
Formvorschriften zu prüfen und bei deren Verletzung Massnahmen zu er-
greifen.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 31Eröffnungspflicht von letztwilligen Verfügungen (Art. 557 ZGB)
Das Bezirksgericht hat eine letztwillige Verfügung innert 1 Monat ab Erhalt
(in der Regel ab Todesdatum des Erblassers) an die Erben zu eröffnen.
Anordnung Erbschaftsverwaltung
Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung erfolgt durch das Gericht. Sie
wird verfügt, wenn die Verwaltung der Erbschaft nicht durch die Erben si-
chergestellt ist oder wenn ein Erbe dauernd ohne Vertretung abwesend
ist. (Art. 554 ZGB)
Erbenruf (Art. 555 ZGB)
Der Erbenruf wird durch das Bezirksgericht angeordnet, wenn unklar ist,
wer gesetzlicher Erbe ist. Der Erbenruf wird im Amtsblatt publiziert.
III. b) Sicherungsinventar (ZGB)
Das Sicherungsinventar wird von Amtes wegen angeordnet,
wenn die Erbschaft durch eine Nacherbeneinsetzung gemäss Art. 488 ff
ZGB belastet ist. (Der Erbe wird verpflichtet, die erhaltene Erbschaft nach
seinem Tode einem Nacherben auszuliefern.)
Weiter ist es im Grundsatz erforderlich, wenn eine Person unter einer
vormundschaftlichen Massnahme steht oder zu bevormunden ist (Art. 553
Ziff. 1 ZGB) oder ein Erbe ohne Vertretung dauern abwesend ist (Art. 553
Ziff. 2 ZGB).
Das Sicherungsinventar wird durch das Bezirksgericht auf Wunsch von
Gläubigern oder Erben angeordnet (Art. 553 Ziff. 3 ZGB).
Häufiger trifft man das Sicherungsinventar bei der Errichtung von vor-
mundschaftlichen Massnahmen (Mündelinventar) oder nach Eheschei-
dungen als sogenanntes Kindsvermögensinventar. Es zeigt auf, welches
Vermögen vom Vormund/Beirat/Beistand bzw. dem Inhaber der elterlichen
Fürsorge verwaltet werden muss. In diesen Fällen ist keine Anordnung
des Richters nötig. Zuständig ist in diesen Fällen die Vormundschaftsbe-
hörde.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 32III. c) Steuerinventar
Die Aufnahme des Steuerinventars stützt sich auf das Steuergesetz (§ 210
ff) und auf die Verordnung zum Nachlassinventar (SAR 651.100). Dem-
nach ist in allen Fällen ein Steuerinventar aufzunehmen. Einzige Ausnah-
me ist die offensichtliche Vermögenslosigkeit. Liegt diese vor, haben die
Erben eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen. Die Erben können
die Erbschaft innert 3 Monaten seit Kenntnis des Todes des Erblassers
(idR Todesdatum) beim Bezirksgericht am letzten Wohnsitz des Erblas-
sers ausschlagen. (Bezüglich dem Ablauf der Inventaraufnahme wird auf
das separate Kapitel verwiesen.)
III. d) öffentliches Inventar (ZGB)
Die Erben haben die Möglichkeit, innerhalb 1 Monats seit dem Tod des
Erblassers beim zuständigen Bezirksgericht am letzten Wohnsitz des Erb-
lassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars zu verlangen. Das Be-
zirksgericht ordnet alsdann das öffentliche Inventar an und beauftragt die
Gemeindekanzlei, dieses auszustellen. Gleichzeitig lässt das Bezirksge-
richt im Amtsblatt des Kantons Aargau 3 Mal einen "Rechnungsruf" publi-
zieren. Den Gläubigern wird mit dem Rechnungsruf die Möglichkeit gege-
ben, die Forderungen innert publizierter Frist bei der Gemeindekanzlei am
Wohnsitz des Erblassers einzugeben/anzumelden. Verspätet eingereichte
Forderungen haben keinen Rechtstitel und verfallen (ausser, sie sind aus
der Steuererklärung ersichtlich oder stammen aus öffentlichen Registern).
Die Gemeindekanzlei (Gemeinderat) stellt das öffentliche Inventar alsdann
zusammen und nummeriert sämtliche Belege. Nach der Unterzeichnung
durch einen Erben und den Gemeinderat werden alle Inventarkopien mit
den Belegen dem Bezirksgericht zur Eröffnung an die Erben zugestellt.
Die Erben haben nach Erhalt des öff. Inventares die Möglichkeit, die Erb-
schaft innerhalb 1 Monats mittels mündlicher oder schriftlicher Erklärung
beim Bezirksgericht auszuschlagen. Das öffentliche Inventar sichert die
Erben somit ab, indem sie erst nach Vorlage der genauen Zahlen des
Nachlasses (Aktiv- oder Passivsaldo) über die Annahme oder Ausschla-
gung der Erbschaft entscheiden müssen.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 33III. e) Erbenverzeichnis und Erbbescheinigung
Das Erbenverzeichnis wird gestützt auf die Familienscheine des/der Hei-
matorte/s und auf die Angaben der Erben (Adressen) ausgestellt. Das Zi-
vilstandsamt unterscheidet zwischen folgenden Dokumenten:
Familienausweis:
Auf diesem Dokument ist nur die aktuelle Ehe registriert mit den Kindern
aus dieser aktuellen Ehe. Andere Kinder aus früheren Ehen oder voreheli-
che Kinder müssen durch die Gemeindekanzlei abgeklärt werden.
Ausweis über den registrierten Familienstand:
Aus diesem Dokument sind alle Kinder registriert, auch solche aus frühe-
ren Ehen und voreheliche (Ausnahme: ausländische Kinder).
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 34Nebst dem Erblasser werden im Erbenverzeichnis die gesetzlichen Erben
mit Name, Vorname, Verwandschaftsbezeichnung, Geburtsdatum, Heima-
tort, Zivilstand, Wohnsitz und Adresse festgehalten. Der Gemeinderat oder
die Gemeindekanzlei (Gemeindeschreiber) bestätigen den Inhalt des Do-
kumentes mit Unterschrift und Amtsstempel (Rundstempel). Das Erben-
verzeichnis wird von Banken, Versicherungen und Dritten verlangt, damit
die Zustelladresse der Erbenvertretung geregelt werden kann. Da die ge-
richtliche Bescheinigung fehlt, kann es jedoch nicht die Basis für Kontiaus-
zahlungen sein.
Gemäss Empfehlung des Obergerichts des Kantons Aargau sollten keine
Erbenverzeichnisse mehr für Private ausgestellt werden.
Weiterführende Bestimmungen über die Ausstellung für Erbenverzeichnis-
se sind dem Kreisschreiben des Obergerichtes aus dem Jahre 2009 zu
entnehmen.
Die Erbbescheinigung geht noch einen Schritt weiter als das Erbenver-
zeichnis. Nebst der vorstehenden Auflistung der Erben, welche vom Ge-
meinderat unterzeichnet sein muss, bescheinigt das Bezirksgericht, ob ei-
ne letztwillige Verfügung vorliegt und was der Inhalt dieser ist (weitere Er-
ben, Abweichung von der gesetzlichen Erbfolge, Vermächtnisse). Die
Erbbescheinigung ist von den Angehörigen direkt beim Bezirksgericht zu
bestellen, welches bei der Gemeinde anschliessend ein spezielles Erben-
verzeichnis für die Erbbescheinigung verlangt. Die Erbbescheinigung wird
in der Regel von Banken und Versicherungen einverlangt, da nur dieses
Dokument definitiv darüber Auskunft gibt, wer nun tatsächlich die Erb-
schaft erhält. (Dies ist aus dem Erbenverzeichnis nicht abschliessend
sichtbar, da mittels letztwilliger Verfügung von der gesetzlichen Erbfolge
abgewichen werden kann.)
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 35III. f) Praxis im Inventurwesen
Die Aufnahme des Steuerinventars stützt sich auf das Steuergesetz und
ist in allen Todesfällen erforderlich. Einzige Ausnahme ist die offensichtli-
che Vermögenslosigkeit
Vermögenslosigkeit
Liegt diese vor, haben die Erben eine entsprechende Erklärung mit einfa-
cher Auflistung der Vermögenswerte zu unterzeichnen. Als vermögenslos
werden Nachlässe mit einem Wert von bis zu
Fr. 20'000.-- bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass der Todesfall
(Einsargungen, Transport, Bestattung, Leidmahl, Grabstein, Grabunterhalt
für 25 Jahre etc.) Kosten in dieser Höhe verursacht. In der Praxis wird in
der Regel auf die Unterzeichnung dieser separaten Erklärung verzichtet,
da sämtliche Daten auch in der 'Unterjährigen Steuererklärung' enthalten
sind.
Inventurbehörde ist der Gemeinderat. Nach Anzeige des Todes einer
Person mit Wohnsitz in der Gemeinde hat der Gemeinderat an die Erben
bzw. an den Erbenvertreter eine Verfügungsbeschränkung zu erlassen.
Darin wird angeordnet, dass über den Nachlass keine Verfügungen getrof-
fen werden dürfen, bis die Inventaraufnahme erfolgt ist. Gleichzeitig mit
der Verfügungsbeschränkung wird dem Erbenvertreter eine "Unterjährige
Steuererklärung" mit Angaben zum Güter- & Erbrecht, Vorempfängen &
Schenkungen u. ein "leeres" Verzeichnis der gesetzlichen Erben zuge-
stellt. Mit dem Eingang der ausgefüllten und unterzeichneten "Unterjähri-
gen Steuererklärung" gilt die Verfügungsbeschränkung als aufgehoben.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 36Muster einer Verfügungsbeschränkung Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 37
Muster einer Verfügungsbeschränkung (Seite 3)
Unterjährige Steuererklärung
Die Unterjährige Steuererklärung basiert auf der Gegenwartsbesteuerung.
Sie muss bei jedem Todesfall ausgefüllt werden, damit die effektiven
Steuern des Verstorbenen vom 01. Januar des Kalenderjahres bis zum
Todestag veranlagt werden können. Als Bemessungsgrundlage werden
die während dieser Zeit erzielten Einkünfte und Aufwendungen und das
Vermögen (am Todestag) berücksichtigt.
Nach Eingang der 'Unterjährigen Steuererklärung' und dem zugehörigen
Verzeichnis der erbberechtigten Personen beim Gemeindesteueramt und
nach der darauf basierenden Einkommens- und Vermögensbesteuerung
(Steuerveranlagung) hat die Inventurbehörde zu prüfen, ob ein erbsteuer-
pflichtiger Fall vorliegt.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 38Prüfung Erbsteuerpflicht, nicht pflichtiger Fall
Seit dem 1.1.2001 sind Nachkommen und überlebender Ehegatte von der
Erbsteuer im Kanton Aargau befreit. Sind also lediglich solche Erben vor-
handen, ist von einem nicht steuerpflichten Erbanfall auszugehen und die
unterjährige Steuererklärung wird mittels Verfügung der Inventurbehörde
(Feststellungsverfügung) zum Steuerinventar erklärt und den erbberechtig-
ten Personen eröffnet. (Gleichzeitig wird nochmals die Aufhebung der Verfügungs-
beschränkung, welche mit dem Eingang der unterj. Steuererklärung bereits erfolgt ist,
schriftlich angezeigt).
Dem Kant. Steueramt wird eine Kopie des Deckblattes der Feststellungs-
verfügung eingereicht.
Die Feststellungsverfügung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen,
wonach die erbberechtigten Personen innert 20 Tagen nach Erhalt des
vorliegenden Dokuments bei der Inventurbehörde eine anfechtbare Verfü-
gung über die Erbschaftssteuerpflicht verlangen können.
Muster "Abschluss Steuerinventar mit Erbsteuerverfügung, nicht pflichtiger Fall"
(= Feststellungsverfügung)
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 39Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 40
Prüfung Erbsteuerpflicht, pflichtiger Fall
Ein erbsteuerpflichtiger Fall liegt vor, wenn gestützt auf die Angaben der
Unterjährigen Steuererklärung und der Familienscheine als auch der
letztwilligen Verfügungen festgestellt wird, dass
die Aktiven den Betrag von Fr. 20'000.-- übersteigen und
zumindest eine erbberechtigte Person erbschaftssteuerpflichtig ist
In diesen Fällen muss ein umfangreiches Steuerinventar erstellt werden.
Der Ablauf des Verfahrens zeigt sich dann wie folgt:
Aufforderung der Erben, nebst den aus der unterjährigen Steuererklä-
rung ersichtlichen Daten folgende Angaben und Unterlagen einzu-
reichen:
Angaben über eingebrachtes Gut, Erbschaften und Schenkungen (nur
bei verheirateten Erblassern)
Angaben über die Aktiven (Bank-/Post-/Wertschriftenbelege mit Wert
per Todestag jedoch ohne Marchzinsen), die Guthaben, die Liegen-
schaften und weitere Vermögenswerte
Angaben über Versicherungspolicen und über deren Auszahlung (Be-
lege)
Angaben über die Schulden (Kredite, Darlehen, Hypotheken, laufende
Schulden, Todesfallkosten), alles mittels Belegen
Gestützt auf diese Daten wird alsdann ein umfangreiches Steuerinventar
erstellt. Nebst den vorstehend genannten Angaben enthält es
die Daten des Erblassers, der Inventaraufnahme, ev. richterlicher Ver-
fügungen
Angaben über die Erben (Erbenverzeichnis)
Angaben über Erbvorempfänge und Schenkungen
Angaben über den Güterstand und allf. Eheverträge
Angaben über letztwillige Verfügungen
Angaben über einkommenssteuerwirksame Zuwendungen
eine güterrechtliche Auseinanerdersetzung (falls Erblasser verheiratet)
eine Bilanz (weitere Infos dazu im Anhang und im Unterricht)
Das Inventar wird nach der Erstellung durch die Inventurbehörde durch ei-
nen Erbvertreter unterschrieben und alsdann vom Gemeinderat gegenge-
zeichnet. Die pflichtteilsgeschützten Erben und jeder nach Quoten (Bruch-
teilen) beteiligte Erbe erhält eine Kopie des Inventars. Weitere Exemplare
erhalten das Steueramt und die Kanzlei, welche über das Original verfügt.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 41Alsdann muss die Erbsteuerveranlagung erstellt werden. Diese wird dem
Kant. Steueramt zusammen mit dem Inventar und der 'Unterjährigen
Steuererklärung' zugestellt. Dazu aber mehr im nächsten Thema.
Die Ausstellung des Inventars ist nicht kostenlos. Gemäss den gesetzli-
chen Grundlagen im Anhang sind verschiedene Abrechnungsarten mög-
lich. Der Unterzeichnete empfiehlt folgende Gebühren:
Familienscheine zur Erbenermittlung nach eff. Aufwand
Inventaraufnahme nach Stundenansatz*
Ausstellung Inventar & Kopien nach Stundenansatz*
Sicherung der Hinterlassenschaft 0,5 0/00 RV (siehe Dekret)
Stempelgebühr siehe GRV, entfällt seit 1.1.2001
Erbenverzeichnis, falls zus. ausgestellt gemäss Dekret
Spezielles (z.B. Schätzungskosten) nach eff. Aufwand
Erbsteuerveranlagung nach Stundenansatz*
* Abgaben dürfen nur gestützt auf eine gesetzliche Grundlage erhoben werden. Die An-
forderungen an die gesetzliche Grundlage dürfen jedoch nach der Bundesgerichtspraxis
herabgesetzt werden, wo dem Bürger die Überprüfung der Gebühr auf ihre Rechtmässig-
keit anhand von verfassungsmässigen Prinzipien, insbesondere des Kostendeckungs-
und des Äquivalenzprinzips, ohne weiteres möglich ist. Daher dürfen Kanzleigebühren
keiner fomellgesetzlichen Grundlage (BGE 112 Ia 39, 43 ff)
Gemäss dem Grundriss des allg. Verwaltungsrechtes (Häfeli/Müller) sind Kanzleigebüh-
ren (und dazu zählt auch die Erarbeitung des Inventares) Abgaben für einfache Tätigkei-
ten der Verwaltungsbehörden , die ohne besonderen Prüfungs- oder Kontrollaufwand er-
bracht werden und sich in ihrer Höhe in bescheidenem Rahmen halten. Bei Kanzleige-
bühren gilt das Erfordernis der Gesetzesform nicht. Sie müssen jedoch das Erfordernis
des Rechtssatzes erfüllen, d.h. in einem generell-abstrakten, genügend bestimmten Er-
lass (z.B. Verfügung des Gemeinderates) umschrieben sein.
Das heisst, dass bei einer Verrechnung des Arbeitsaufwandes nach Stunden der Ge-
meinderat vorab in einer generellen Verfügung die Kanzleigebühren für diese Tätigkeit
beschliessen muss. Ist dies erfolgt, kann z.B. ein Stundensatz Fr. 50.-- für die Erstellung
des Inventares in Rechnung gestellt werden.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 42Verfahrensablauf Steuerinventar & Erbsteuerveranlagung
- Familienscheine sofort nach Kenntnis Tod des
Einwohners bestellen für Erbenermittlung
- Verfügungsbeschränkung zusammen mit
unterjähriger Steuererklärung d. Erbvertreter zustellen
- Steuererklärung geht ein und wird von Steueramt
veranlagt
- Nach Rechtskraft geht unterj. Steuererklärung an
Inventurbehörde
Entscheid über die Erbsteuerpflicht
erbsteuerpflichtig = nicht erbsteuerpflichtig
- Gestützt auf unterj. Steuerklärung wird Unterj. StE wird zum Inventar erklärt
detailliertes Steuerinventar erstellt
- Gemeinderat/Gemeindekanzlei verfügt
'Feststellungsverfügung' (keine Steuern
- Steuerinv. an Erbenvertreter zur fällig) mit Rechtsmittelbelehrung an Erben.
Unterschrift
- Gegenzeichnung durch Gemeinderat
- Zustellung Inv. an pflichtteilsgeschützte &
nach Quoten eingesetzte Erben
- Kopie mit unterj. StE in Ablage
- Original der unterj. StE an Steueramt
- Formular Erbsteuerveranlagung ausfüllen - Verfahren ist abgeschlossen
- Erbteilung ist Sache der Erben
- Zustellung an Erbenvertreter für
Unterzeichnung
- Zustellung Inventar mit unterj. StE und
Erbsteuerveranlagung an
Kant. Steueramt
- Kant. Steueramt verfügt Erbsteuer und
retourniert alle Unterlagen an Gemeinde
- Gemeinde eröffnet Erbsteuerveranlagung
an Erben
- Gemeinde ist für Inkasso verantwortlich
- Ablage Unterlagsdoppel
- unterj. StE an Steueramt
- Verfahren ist abgeschlossen
- Erbteilung ist Sache der Erben
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 43Fragen zum Inventurwesen
1. Welche Sicherungsmassregeln kennen Sie? (mind. 3)
2. Wo sind Testamente zur Eröffnung einzureichen?
3. Was bezweckt die Aufnahme des öff. Inventars ?
4. Was ist die Basis für das Ausstellen des Erbenverzeichnisses?
5. Was enthält eine Erbbescheinigung und für welche 2 Zwecke wird sie in der Regel
ausgestellt?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 446. Wer ist Inventarbehörde?
7. Was muss die Inventarbehörde als ersten Schritt tun?
8. In welchem Fall muss kein Inventar aufgenommen werden?
9. Was ist der Sinn und Zweck der unterjährigen Steuererklärung?
10. Was passiert inventurrechtlich (steuerrechtlich) mit der unterjährigen Steuererklä-
rung, wenn sie eingereicht und veranlagt worden ist und als Erben "nur" Nachkom-
men vorhanden sind?
11. Was müssen Sie tun, wenn aus der unterjährigen Steuererklärung und den Fami-
lienscheinen entnommen werden kann, dass mehr als Fr. 20'000.-- Vermögen vor-
handen ist und als Erben nur die Geschwister in Frage kommen?
12. Welche Erben erhalten eine Kopie des Inventars?
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 45IV. Erbschafts- und Schenkungssteuern (StG)
IV. a) Steuerpflicht
Erbschafts- und Schenkungssteuern werden im Kanton Aargau gleich be-
handelt. Sie werden am Wohnort des Erblassers bzw. Schenkers veran-
lagt. Rechnungsempfänger ist, wer tatsächlich die Zuwendung erhält (sie-
he auch Kapitel: Prüfung Erbsteuerpflicht auf Seite 40).
IV. b) Steuerbegünstigte
Zuwendungen unter Ehegatten und an die Nachkommen sind steuerfrei.
Dabei ist zu beachten, dass die Nachkommen erst seit dem 1.1.2001 voll
von der Steuer befreit sind; bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Nachkom-
men lediglich einen einmaligen Steuerfreibetrag pro Elternteil von Fr.
50'000.-- (Minderjährige Fr. 60'000.--).
IV. c) Steuerberechnung
Das Steuergesetz unterteilt die Steuerpflichtigen in 3 verschiedene Klas-
sen. Je näher man mit dem Erblasser verwand ist, desto tiefer ist die
Klasse. Die Steuerklasse wirkt sich folglich auf die Steuersätze aus. Tiefe
Klassen haben auch einen geringeren Steuersatz. (siehe StG im Anhang)
IV. d) Steuersatzbestimmung
Für die Satzbestimmung ist nebst der Steuerklasse auch noch der effekti-
ve Vermögensanfall massgebend. Dabei wird der Vermögensanfall in so-
genannte Vermögenspakete aufgeteilt, welche je Einheit einen separaten
Steuersatz haben. Zum Beispiel: Die ersten Fr. 120'000.-- zu ... %, die
weiteren Fr. 60'000.-- zu ... % usw. (siehe § 147 - 149 StG im Anhang).
Zudem sind Vorempfänge und Schenkungen zu berücksichtigen. Diese
sind in 5-Jahres-Einheiten zusammengefasst ebenfalls für die Satzbe-
stimmung massgebend. Beispiel: Erbanfall Fr. 100'000.-- und Vorempfang
vor 3 Jahren von Fr. 100'000.-- = Steuersatz für Anfall von Fr. 200'000.--.
Ab hier gelangt alsdann die Paketbildung zur Anwendung. Liegt der Vor-
empfang 6 Jahre zurück, kann dieser nicht für die Satzbestimmung beige-
zogen werden; das heisst, beide Anfälle sind separat für den Steuersatz
zu betrachten.
Güter- und Erbrecht, Inventar-, Erb- und Schenkungssteuer-Wesen, Kurs 2004 (Stand 2011) 46Sie können auch lesen