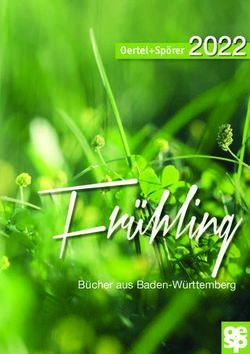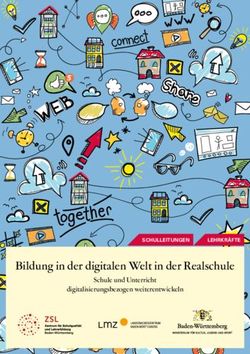Einblick - Bannwald "Wilder See-Hornisgrinde" - Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Forstliche Versuchs- Nr. 1, April 2012, Jahrgang 16
ISSN 1614-7707
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg
-einblick
Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“2 FVA-einblick 1/2012
Inhalt Liebe Leserinnen, liebe Leser,
3 Energiewende erhöht Nachfrage die erste Ausgabe des FVA-einblicks im Jahr 2012 beginnt mit einem Beitrag
nach Holz als Energieträger zum Thema „Energieholz und Nachhaltigkeit“. Die steigende Nachfrage nach
7 Baum des Jahres 2012: Holz als Energieträger stand im Mittelpunkt einer Fachtagung an der FVA. Dazu
die Europäische Lärche fasst ein Artikel die Beiträge der namhaften Redner zusammen. Diese zeigten
10 Insekt des Jahres 2012: auf, wie das Energieholzpotenzial der Wälder ermittelt werden kann, wo die
der Hirschkäfer nachhaltig vertretbaren Grenzen der Nutzung liegen und wie ein eventuell auftre-
12 Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“ tender Nährelemententzug kompensiert werden könnte.
– eine durch Buchdruckerbefall Dem Baum des Jahres, der Europäischen Lärche, und dem Insekt des Jahres,
getriebene Walddynamik dem Hirschkäfer widmen sich die beiden nachfolgenden Artikel. Damit wollen
16 Rindenschäden durch Holzernte: wir Ihre Aufmerksamkeit auf zwei bemerkenswerte Arten lenken, die Lärche als
altbekannt, gern verdrängt einzige heimische Nadelbaumart, die ihre Nadeln im Herbst abwirft, und den
19 Forschung und Praxis: das Dougla- Hirschkäfer als archaisch anmutenden „Geweihträger“.
sien-Versuchsflächennetz der FVA In einem weiteren Beitrag werden Untersuchungen zur Walddynamik in dem
100-jährigen Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“ vorgestellt. Es wird gezeigt,
wie sich der Borkenkäferbefall ausgebreitet und wie sich der Totholzanteil entwi-
ckelt hat. Im nächsten Beitrag wird ein zwar altbekanntes, aber häufig verdräng-
tes Thema aufgegriffen – die Rindenschäden im Wald.
Mit dem letzten Beitrag setzen wir unsere Rubrik „Forschung und Praxis“ fort.
Diesmal berichten wir von der Fortbildung „Douglasie – eine leistungsstarke
Alternative“, bei der die Erkenntnisse aus den Douglasienversuchen der FVA für
die Praxis aufbereitet wurden.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre sowie einen schönen Frühling
Ihre FVA-einblick-Redaktion
Impressum
Herausgeber Redaktion Auflage
Der Direktor der Forstlichen Alfons Bieling 1.700 Exemplare
Versuchs- und Forschungsanstalt Steffen Haas
Baden-Württemberg, Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker
Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel Jürgen Schäffer Die Redaktion behält sich die sinn-
Thomas Weidner wahrende Kürzung, das Einsetzen von
Adresse Titeln und Hervorhebungen vor. Die
Wonnhaldestr. 4 Bildherkunft Beiträge müssen nicht unbedingt die
D-79100 Freiburg Georg Jehle: Titel Meinung des Herausgebers wiederge-
Telefon: (07 61) 40 18 – 0 Thomas Weidner: Seite 3 bis 6 und 18 ben.
Fax: (07 61) 40 18 – 3 33 Alle anderen Abbildungen und Tabellen
fva-bw@forst.bwl.de stammen von den jeweiligen Autoren.
www.fva-bw.de Freiburg i. Brsg., April 2012FVA-einblick 1/2012 3
Energiewende erhöht Nachfrage nach
Holz als Energieträger
von Klaus von Wilpert und Jürgen Schäffer
Erneuerbare Energien werden in Unterschiedliche Strategieansätze Energie der kurzen Wege
Zukunft einen progressiv wach- zur Ermittlung des aus dem Wald mobi-
senden Anteil der Primärenergie- lisierbaren Energieholzpotentials, sowie Die über 100 Teilnehmenden aus
produktion einnehmen. Seit dem von Nutzungsgrenzen und/oder des Be- Forstpraxis, Verwaltung, Wirtschaft
beschlossenen Ausstieg aus der darfs zur Kompensation eines erhöhten und Forschung erlebten eine inno-
Atomenergie und der politisch pro- Nährelemententzugs wurden bei der vative und mitreißende Vortragsver-
klamierten Energiewende ist klar Tagung vorgestellt und diskutiert. Eben- anstaltung mit abschließender Podi-
und auch politisch gewollt, dass so wurden technische Ansatzpunkte umsdiskussion, in der die derzeit im
verstärkt intelligente Strategien zur zur Erhaltung der stofflichen Nachhal- deutschsprachigen Raum realisierte
Effizienzsteigerung regenerativer tigkeit behandelt. Die in Deutschland Breite unterschiedlicher Strategien
Energieerzeugung entwickelt wer- und der Schweiz derzeit konkretisierten für die Energieholznutzung dargestellt
den müssen, um Energieengpässe Länderkonzepte wurden vergleichend und das Für und Wider der einzelnen
abzuwenden. Waldholz spielt dabei dargestellt und fachlich detailliert und Ansätze trennscharf herausgearbeitet
eine zunehmende Rolle, da es der engagiert diskutiert. Grundsätzlich gilt, wurden.
derzeit größte zur Energieerzeu- dass angesichts der vielfältigen Belas- Eingeleitet wurde die Tagung von
gung geeignete Holz-Biomasse- tungen der Wälder eine durch Energie- mehreren Beiträgen, in denen der
pool ist. Doch wie viel Energieholz holznutzung intensivierte Holzernte nur umweltpolitische Rahmen des Ta-
lässt sich in Zukunft effizient und dann vertretbar ist, wenn gleichzeitig die gungsthemas abgesteckt wurde. So
nachhaltig nutzen? Soll man ver- Auswirkung auf den Nährstoffkreislauf betonten Ministerialdirektor Wolfgang
mehrt auch Baumkronen nutzen überwacht und auf Defizite reagiert wird, Reimer, Ministerium für Ländlichen
und Holzasche in den Wald zurück- entweder durch Nutzungsverzicht oder Raum Stuttgart und Ministerialdirek-
führen? Um diese Fragen drehte es durch Rückführung der Nährelemente tor Clemens Neumann, Leiter der
sich auf der Energieholztagung im im Sinne eines Kreislaufkonzepts. Die Abteilung Biobasierte Wirtschaft und
Dezember an der FVA in Freiburg. Belastung der Wälder und ihrer Funktio- Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft
nen sind neben hohen Ernteintensitäten im Bundesministerium für Ernährung,
vor allem durch schnell verlaufende, von Landwirtschaft und Verbraucher-
Menschen verursachte Umweltverände- schutz, dass Biomasse als regenerati-
rungen wie Säureeintrag und Klimawan- ver Energieträger immer wichtiger wer-
del bedingt. den wird und als „Energie der kurzen
Abb. 1: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Tagung „Energieholz und Nach-
haltigkeit“ in der FVA Freiburg am 13. 12. 20114 FVA-einblick 1/2012
und der Schweiz sind schon so weit
konkretisiert und mit quantitativen Da-
ten hinterlegt, dass sie als weit ent-
wickelte Strategieansätze mit einem
Potenzial zum praktischen Ökosys-
temmanagement angesehen werden
können. Die beiden anderen Ansätze
befinden sich eher in einem konzepti-
onellen Entwurfstadium.
Da jedoch sowohl die naturräumli-
chen Gegebenheiten als auch die Da-
tenlage zwischen und auch innerhalb
der dargestellten Länder erheblich va-
riieren, weisen die Konzepte deutlich
Abb. 2: MD Wolfgang Reimer (rechts) und MD Clemens Neumann
unterschiedliche Schwerpunkte auf.
In Baden-Württemberg sind die Wald-
Wege“ ideal für dezentrale Konzepte tionen und den Schlüssel für eine ef- standorte durch eine außerordentlich
und zugleich die Wertschöpfung im fektive Reduktion von Treibhausgas hohe geologische und landschaftliche
ländlichen Raum erhöht sei. Bis 2050 Emissionen in der Effizienzsteigerung Vielfalt gekennzeichnet. Die Stand-
sollen in Deutschland 60% der End- der Energienutzung. Das macht die orte in Nordwestdeutschland sind
energie aus erneuerbaren Energien Entwicklung intelligenter Energiekon- durch den Anteil an der norddeut-
stammen. Schon heute stammen in zepte notwendig, bei denen nicht nur schen Tiefebene von Niedersachsen
Deutschland ca. 35% der regenerativ die Energieausbeute optimiert, son- und Sachsen-Anhalt mit ihren ex-
erzeugten Energie aus Holzbiomas- dern gleichzeitig Mehrfachnutzung von trem nährstoffarmen altpleistozänen
se. Holzenergie ist besonders durch Ressourcen und die Minimierung von Böden völlig anders ausgestattet als
ihre Flexibilität und Grundlastfähig- Nebenwirkungen aktiv geplant und ge- in den anderen Ländern. Da sowohl
keit interessant, da mit ihr ein Teil staltet werden müssen. in Nordwestdeutschland als auch in
der hohen Intensitätsschwankungen Prof. Konstantin von Teuffel, Direk- Baden-Württemberg ein nennenswer-
aus Wind- und Sonnenenergie aus- tor der FVA, stellte die Entstehung und ter Anteil der Waldstandorte so stark
geglichen werden kann. Beide Minis- inhaltliche Entwicklung des Nachhal- versauert ist, dass schon die konven-
teriumsvertreter stellten als prioritäre tigkeitsbegriffs in der Forstwirtschaft tionelle Holzernte in vielen Fällen die
Randbedingung für eine verantwortli- dar. Er postulierte, dass quantitative Nährstoffnachhaltigkeit verletzt, wird
che Energieholznutzung heraus, dass Aspekte der Nachhaltigkeit, wie dy- in den für diese Regionen entwickel-
neuartige Energieholzkonzepte nicht namische Wachstumsmodelle, in das ten Konzepten vorgesehen, dass die
dazu führen dürfen, dass mehr Holz forstliche Planungswesen integriert Nährstoffnachhaltigkeit aktiv auf dem
genutzt wird als zuwächst, und dass werden müssen, um den Zuwachs Wege der Bodenschutzkalkung und
die Nährstoffverfügbarkeit in den der Waldbestände und damit das Nut- gegebenenfalls durch Holzascherecy-
Waldböden nicht dauerhaft beein- zungspotenzial in Abhängigkeit von cling gestützt werden soll. Damit kön-
trächtigt werden darf. sich verändernden Umweltfaktoren nen die durch Energieholzernte, aber
abbilden zu können. auch durch konventionelle Holzern-
te ausgelösten, erhöhten Nährele-
Intelligente Energiekonzepte mentexporte ausgeglichen werden.
entwickeln Holzascherückführung In Baden-Württemberg wurden das
– ja oder nein? Energieholzpotential und die Stoff-
In seinem Schlüsselvortrag führte bilanz für Erntestrategien aus den
Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Ko- Der inhaltliche Hauptteil der Tagung Daten der Bundeswaldinventur bzw.
Präsident des Internationalen Res- wurde von der Vorstellung unter- des Forstlichen Umweltmonitoring
sourcenpanels der Vereinten Nationen schiedlicher Konzepte zur Energie- für das Wuchsgebiet “Südwestdeut-
(UNEP), aus, dass der Forstsektor holzernte und gleichzeitiger Wahrung sches Alpenvorland” mit 140.000 ha
bezüglich Nachhaltigkeit eine führen- der Nährstoffnachhaltigkeit und Qua- Waldfläche in einem 3-jährigen, von
de Rolle einnimmt: „Wirtschaftsleute lität der Waldböden eingenommen. der EnBW geförderten Pilotprojekt
können von Forstleuten noch viel ler- Es wurden Konzepte aus Bayern, Ba- abgeleitet. Außerdem wurden in der
nen“. Weizsäcker sieht die Hauptver- den-Württemberg, Nordwestdeutsch- Projektarbeit ein Logistikkonzept und
antwortung für den CO2 -Anstieg in land und der Schweiz vorgestellt. Die eine standardisierte Dolomit-Holz-
der Atmosphäre bei den Industriena- Konzepte aus Baden-Württemberg aschemischung für den Einsatz in derFVA-einblick 1/2012 5
Bodenschutzkalkung entwickelt. Es in Modellregionen das Potenzial aller
konnte gezeigt werden, dass mit hin- erneuerbaren Energieträger zu be-
reichenden statistischen Sicherheiten urteilen. So liesse sich die Rolle des
für gesamte Regionen eine Abschät- Energieholzes realistisch einschätzen.
zung des mobilisierbaren Energie- Kölling empfiehlt, sich bezüglich der
holzpotentials auf der Basis von Mo- Düngung und Holzascherückführung
nitoringdaten möglich ist und dieses eher zurückzuhalten: „Ich sehe es kri-
auf Bestände und Betriebe übertragen tisch, wenn wir organischen Humus
werden kann. Ebenso können auf Be- abbauen und durch mineralischen
triebs- und Bestandesebene die durch Dünger ersetzen“. Die Schweizer Kol-
intensivierte Energieholzernte ausge- legen befürchten, dass sich bei der
lösten Nährelementdefizite kleinräu- Rückführung von Holzasche und den
mig auf der Basis der Messdaten aus darin enthaltenen Nähr- und Schad-
den forstlichen Umweltmessnetzen stoffen Konflikte mit der Philosophie
quantifiziert werden. Seine statisti- der multifunktionalen Forstwirtschaft Abb. 3: Prof. Ernst Ulrich Weizsäcker
sche Sicherheit und Datenfundierung ergeben könnten. Klaus von Wilpert,
qualifizieren dieses Konzept zu einem FVA, plädiert hingegen für eine stand-
praxisorientierten Steuerungsinstru- ortsdifferenziert dosierte Bodenschutz- „natürliche Nährstoffnachlieferung
ment, auf dessen Basis sowohl Stand- kalkung, bei der Dolomitkalk und Holz- aus der Verwitterung von Gesteins-
ortsplanungen für Kraftwerke als auch asche ausgebracht werden, um den mineralien als „Generallinie“ genauso
die Nachhaltigkeitssteuerung im Wald Böden exportierte Nährstoffe in öko- unökologisch wie die Maximierung
sicher umgesetzt werden können. systemverträglicher Form wieder zu- der Energieholzernte auf „Biegen und
In Bayern und der Schweiz herr- rückzugeben und den Stoffkreislauf in Brechen“ auf allen, auch den ärmsten
schen Mittelgebirgslandschaften mit Gang zu halten. Auch Karl-Josef Mei- Standorten. Wenn man die erste Opti-
einem hohen Anteil kalkalpiner Land- wes, Nordwestdeutsche FVA, meint, on einseitig durchsetzt, wird dies auch
schaften und damit geologisch junger, dass es unter Umständen erforderlich auf besseren Standorten erhebliche
nährstoffkräftiger Böden vor. Damit, sei, Asche zurückzuführen. Man müs- Einschränkungen auch der konven-
und auch aufgrund der andersarti- se aber nichts überstürzen: „Wir haben tionellen Holzernte bedeuten. Diese
gen politischen Rahmenbedingun- noch etwas Zeit, offene Fragen abzu- Option würde also eine Reduktion
gen, wird in diesen beiden Ländern klären“, sagt er. der Nutzungsmöglichkeiten des nach-
eine andere Strategie im Umgang mit wachsenden, CO2-neutral produzier-
der Waldenergieholzgewinnung ver- ten Rohstoffs Holz unter die derzeit
folgt. Hier wird eher eine natürliche Fazit realisierten Nutzungsintensitäten be-
Nutzungsgrenze zur Steuerung der deuten. An eine quantitativ relevante
Nährstoffnachhaltigkeit verwendet Die Referenten bekennen sich klar Steigerung der Energieholzernte wäre
und weniger die technische Stützung zu einer nachhaltigen Waldnutzung. abgesehen von Kalkstandorten mit
des Nährstoffhaushalts durch Holz- Sie sind sich auch darüber einig, dass hoher natürlicher Nährstoffnachliefe-
ascherückführung. deutlich mehr Energieholz als bisher rung nicht zu denken. Andererseits
im Wald genutzt werden kann. Doch
wie gross dieses Potenzial ist und wel-
Ist Energieholzernte che Rolle dabei die Vollbaumnutzung
nachhaltig möglich? spielt, ist stark von den regionalen
naturräumlichen Randbedingungen
In der abschließenden Podiumsdis- und auch von normativen, umweltpo-
kussion betonte Landesforstpräsident litischen Leitlinien abhängig. Die zent-
Max Reger, MLR Baden-Württemberg, rale Frage ist, auf welchen Standorten
dass er in den Wäldern Baden-Würt- die zusätzliche Nutzung der Baumkro-
tembergs keine Holznutzungen in Kauf nen nicht nur ökonomisch, sondern
nehmen werde, die nicht nachhaltig auch ökologisch sinnvoll ist, und auf
seien. Christian Kölling, LWF Bayern, welchem Weg das unstrittige Problem
sagte, dass die Forstwirtschaft bei ver- erhöhter, mit der Energieholzernte ver-
stärkter Energieholznutzung Sicher- bundener Nährelementexporte gelöst
heit brauche, damit die Nachhaltigkeit werden soll. Dabei ist sicherlich eine
gewährleistet bleibt. Oliver Thees, harte Reduktion der Nährelementex-
WSL Birmensdorf, Schweiz, regte an, porte durch Nutzungsverzicht auf die Abb. 4: Prof. Konstantin von Teuffel6 FVA-einblick 1/2012
Abb. 5: Experten bei der Abschlussdiskussion (von links): Oliver Thees, Joachim Hug (EnBW), Christian Kölling, Max Re-
ger, Klaus von Wilpert, Karl-Josef Meiwes.
kann der Versuch des Nährelement- trags von Waldholz zur regenerativen
recyclings durch Ausbringung eines Energieerzeugung konkret umsetzbar
Dolomit-Holzaschegemischs auf sehr wird.
armen Böden, deren Speicherkapazi-
tät für Pflanzennährelemente haupt-
sächlich an die organische Boden-
substanz gebunden ist, problematisch
sein. Durch die reaktiven Bestandteile
der Holzasche können unkontrollier-
te Mineralisierungsschübe ausgelöst
und dadurch ein Teil der Speicher-
fähigkeit für Nährelemente zerstört
werden. Diese Problematik ist aber
nur auf sehr arme, sandige Extrems-
tandorte beschränkt. Auf den meisten
lehmigeren Böden sind solche unge-
wollten Nebenwirkungen von Dolomit-
Holzasche-Mischungen auszuschlie-
ßen. Die im Pilotprojekt für die Region
Oberschwaben erarbeitete Intensität
des durch eine Maximierung der Ener-
gieholzernte ausgelösten Kompensati-
onsbedarfs mit einem Wiederholungs-
turnus von durchschnittlich 64 Jahren
für 4 t/ha Dolomit-Holzaschegemisch
ist sehr niedrig. Außerdem können der
Erfolg des Nährelementrecyclings und
auch das Auftreten ungewollter Ne-
benwirkungen bei jeder Neuaufnahme
der Bodenzustandserfassung (BZE)
geprüft werden. Die dritte BZE-Auf-
nahme ist für 2021 geplant.
Damit und auch angesichts seiner
konsequenten Datenfundierung ist
der Vorschlag aus Baden-Württem- PD Dr. Klaus von Wilpert
berg als verantwortlicher und praxis- FVA, Abt. Boden und Umwelt
orientierter Strategieansatz zu sehen, Tel.: (07 61) 40 18 - 1 73
mit dem eine Optimierung des Bei- klaus.wilpert@forst.bwl.deFVA-einblick 1/2012 7
Baum des Jahres 2012: die Europäische Lärche
von Manuel Karopka und Katharina Töpfner
Baum des Jahres 2012 ist die Eu- Lärchen können bis zu 35 m hoch Verbreitung
ropäische Lärche (Larix decidua werden und entwickeln eine unregel-
Mill.). Sie gehört zur Familie der mäßig pyramidale bis schlank-kegel- Der autochthone Verbreitungsraum
Kieferngewächse (Pinaceaen) förmige Krone. Im Freistand bleiben sie der Lärche gliedert sich in vier Teilareale,
und ist die einzige bei uns heimi- etwas kleiner. Sie sind in der Jugend- in denen voneinander isolierte Vorkom-
sche Konifere Mitteleuropas, die phase bis zum Alter von ca. 25 Jahren men mit eigenen Rassen vorzufinden
ihre Nadeln im Winter abwirft. raschwüchsig; in zunehmendem Alter sind, deren morphologische Trennung
Charakteristisch ist vor allem wachsen sie deutlich langsamer. Ihr jedoch noch nicht gelungen ist:
ihre schöne goldene Herbstfär- herzförmiges Wurzelsystem reicht bis •• Im gesamten Alpenraum ist die Lär-
bung. Auch im Frühling setzt sie in 2 m Tiefe. che weit verbreitet. Dort kommt sie
im Vergleich zu anderen Nadel- Unter optimalen Bedingungen und als Hochgebirgsbaum in den westli-
gehölzen deutliche Farbakzente: ohne wirtschaftliche Nutzung kann chen Alpen oder in den flachen La-
Die weiblichen Zapfen leuchten eine Lärche bis zu 500 Jahren alt und gen im östlichen Alpenraum vor. Hier
purpurfarben, bis sie zum Herbst 50 m hoch werden; dabei kann sie ei- tritt sie oft in Mischung mit der Ge-
hin vergrünen und rosafarbene nen Stammumfang von etwa einem meinen Fichte (Picea abies Karst.)
Schuppenränder ausbilden. Meter erreichen. Sie hat somit ver- oder im Reinbestand auf.
gleichbare Wuchseigenschaften wie •• In der Tatra, einem Gebirgskomplex
die Kiefer. in den slowakischen und polnischen
Abb. 1: Herbsverfärbung der Lärche8 FVA-einblick 1/2012
Standorte Lärchenerntebestände
Die Lärche stockt auf Kalk- sowie auf Der Bedarf an Lärchen-Saatgut für
saurem Silikatgestein und bevorzugt die Forstwirtschaft in Baden-Württem-
frische, tiefgründige Böden mit hoher berg wird über Erntebestände und Sa-
wasserhaltender Kraft. Staunasse Bö- menplantagen gedeckt.
den meidet sie, aber auch flachgründi- Derzeit gibt es 124 zugelassene
ge Hanglagen gehören nicht zu ihren Erntebestände der europäischen Lär-
bevorzugten Standorten; ebenso mei- che. Die FVA hat in den 60er und 70er
det sie nährstoffarme Sande. Jahren drei Samenplantagen in Baden-
Die Lärche hat eine mit der Kiefer Württemberg angelegt, die heute durch
vergleichbare weite Standortsamplitu- die Staatsklenge in Nagold bewirt-
de. Diese Flexibilität lässt eine zuneh- schaftet werden:
mende Bedeutung unter dem prognos- •• Plantage Liliental, Herkünfte aus der
tizierten Klimawandel erwarten. Region Odenwald-Bauland
Sie ist anfällig gegen Lärchenkrebs, •• Plantage Großbottwar, Herkünfte aus
gegen den die Eurolepis-Hybridlärchen den Regionen Bodensee, Hochrhein,
jedoch resistent sind. Schwarzwaldvorberge
•• Plantage Denkendorf, „Sudetenlär-
che“
Holzverwendung Die „Sudetenlärche“ stammt aus der
Sudetenregion und konnte ihre guten
Lärchenholz ist höchst widerstandsfä- Schaftformen in Nachkommenschafts-
hig und sehr harzhaltig. Eine Imprägnie- prüfungen unter Beweis stellen. Das
rung ist nicht erforderlich, selbst für die Saatgut dieser Plantage fällt unter die
Verwendung im Außenbereich. Das Holz Kategorie „geprüftes Vermehrungsgut“.
hat eine rötliche Farbe, trocknet schnell Lärchen fruktifizieren nicht regelmä-
Abb. 2: Zapfen im Frühjahr und schwindet nur geringfügig. Aufgrund ßig, sondern alternieren stark. Eine
der hohen Beständigkeit ist Lärchenholz regelmäßige Ernte ist daher nicht mög-
ein hervorragendes Bauholz für den lich. In dem Zeitraum von 1999 bis
Kaparten, finden sich große Lärchen- Außenbereich. Häufige Verwendung 2010 wurden ca. 12,7 t Zapfen geern-
bestände, vor allem in den Höhenla- findet es im Fenster-, Türen- oder auch tet. Das entspricht einer Menge von gut
gen der Hohen Tatra bis 1300 m. im Treppenbau sowie im Alpenraum im 762 kg an reinen Samen. Davon stam-
•• Auf der Ostseite der Sudeten, einem Hausbau. Die Holzeigenschaften sind men mindestens 40% aus den drei Sa-
Gebirgszug an den Grenzen von Po- mit denen von Douglasienholz vergleich- menplantagen Baden-Württembergs.
len, Tschechien und Deutschland, bar. Die Lärchenpreise liegen derzeit bei 1 Kilogramm Lärchensamen enthält
sowie in den Beskiden in Polen, be- 100 bis 230 € in Güteklasse A, 80 € in rund 170.000 Samenkörner. Die oben
finden sich die zwei weiteren, kleine- Güteklasse B und 60 € in Güteklasse C. genannte Erntemenge würde bei der
ren Teilareale.
Die Lärche war in der Nacheiszeit
Tab. 1: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der europäischen und der
weit verbreitet, wurde aber aufgrund japanischen Lärche sowie der Hybidlärche.
ihrer geringen Wettbewerbsfähigkeit,
die beispielsweise auf den hohen Licht- Larix decidua Mill. Larix kaempferi Larix x eurolepis
anspruch zurückzuführen ist, auf ihren (Lamb.) Carr. Henry
ursprünglichen Standorten zurückge- Zweige/
Grau-gelb Rotbraun Gelb-rot
drängt. Dass wir die Lärche unabhängig Triebe
der autochthonen Verbreitungsareale Grau, rötlich-grau,
Dunkelrot-braun Dunkelbraun-
jedoch in ganz Deutschland antreffen Rinde bis rotbraun,
Rissig-schuppig schuppig
können, ist waldbaulich begründet. Wir feinrissig-schuppig
finden die Lärche heute in Aufforstungen 30–40 Nadeln am Ca. 40 Nadeln am
Nadeln
von der Küste über die Ebenen und Mit- Kurztrieb Kurztrieb
telgebirge bis hoch auf 2000 m Höhe, oft Zapfenschuppen Zapfenschuppen
gemischt mit der Rotbuche (Fagus syl- Zapfen
aufrecht, anliegend, abstehend, am
Zwischenformen
vatica L.). Der waldbauliche Anteil der manchmal am Rand umgebogen,
Rand wellig rosenartig
Art liegt bundesweit jedoch unter 2 %.FVA-einblick 1/2012 9
für Lärchensamen durchschnittlichen die am stärksten frequentierten Lär-
Keimfähigkeitsrate von 50% zur An- chen-Erntebestände beider Arten mit
zucht von ca. 64 bis 65 Mio. Pflanzen DNA-Analysen auf ihre Artzugehörig-
reichen. keit zu überprüfen. Diese Untersuchun-
gen wurden 2009 im DNA-Labor der
Abt. Waldökologie durchgeführt.
Artansprache und Dabei wurden 9 Europäer-Lärchen-
Verwechselung erntebestände und 7 Japaner-Lärchen-
erntebestände untersucht. Von den 9
Die europäische Lärche ist leicht mit Europäer-Lärchenbeständen hatten
der japanischen Lärche (Larix kaemp- nur 5 ein „artreines“ Analyseergebnis.
feri [Lamb.] Carr.) zu verwechseln. Von den 7 Japaner-Lärchenbeständen
Beide Arten sind gut miteinender kreuz- konnten nur 2 als artreine Bestände
bar, was die Artansprache zusätzlich angesprochen werden. Die übrigen Be-
erschwert. Denn die Nachkommen stände wiesen alle einen hohen Anteil
artunterschiedlicher Eltern bilden keine an Hybriden oder Lärchen der jewei-
eigenen Merkmale aus, sondern Misch- ligen anderen Art auf. Die Zulassung
formen, verbunden mit einem großem entzog man diesen Beständen eben-
Spreitungspotenzial in Richtung der falls.
arttypischen Eigenschaften der Eltern. Aufgrund des hohen Aufwands stellt
Die Hybridform ist Larix x eurolepis. sich die Frage, welcher Nutzen durch
Alle drei Lärchenarten werden wald- die konsequente Getrennthaltung der
baulich in Baden-Württemberg verwen- Arten erfüllt wird. In den bestehenden
det. Erntebeständen erkennt man bei Be-
2008 wollte man einen bislang noch trachtung der Phänotypen zunächst
nie genutzten aber zugelassenen Ern- keine Nachteile. Beide Arten, europä-
tebestand der europäischen Lärche ische und japanische Lärche, werden
in Oberschwaben beernten. Bei der waldbaulich unter Berücksichtigung Abb. 2: Zapfen im Herbst
Vorbereitung der Ernte und phänoty- ihrer jeweiligen Standortansprüche ver-
pischen Ansprache der Bäume durch wendet.
den Revierleiter und den zuständigen Dabei spricht man Larix kaempferi in Wehingen, Backnang, Mosbach,
Kontrollbeamten kam der Verdacht auf, etwas bessere Schaftformen zu, aller- Schöntal, Ochsenhausen, Heidelberg/
dass der Bestand nicht ausschließlich dings bei höherem Feuchtigkeitsbe- ev. Pflege Schönau) getestet hat.
aus europäischen Lärchen besteht. darf. Da Larix kaempferi nur aus einem
Eine anschließende Analyse von Stich- relativ kleinen Verbreitungsraum in Ja-
proben bestätigte den Verdacht. Die pan stammt, hat die Art eine geringe
Bäume konnten sogar größtenteils der genetische Variationsbreite, was sie
japanischen Art Larix kaempferi zuge- auch entsprechend nur auf passenden
ordnet werden. Standorten anbauwürdig macht.
Gemäß den Richtlinien des Forstver- Probleme können in art-durchmisch-
mehrungsgutgesetz (FoVG) garantiert ten Erntebeständen allerdings später in
und haftet eine Revierleiterin/ein Re- der F1-Generation, also den Nachkom-
vierleiter mit ihrer/seiner Unterschrift menschaften des geernteten Saatgu-
des Stammzertifikates nach der Ernte tes, auftreten. Mit beiden Arten durch-
für die ordnungsgemäße Durchführung setzte Erntebestände als Eltern lassen
und Artreinheit der Ernte. Abweichun- Larix x eurolepis-Formen als Nachkom-
gen können als Straftatbestand gewer- men vermuten, die zwar starkwüchsig
tet werden. Dem besagten Erntebe- sind, jedoch häufig unbefriedigende
stand entzog man daraufhin folgerichtig Schaftformen aufweisen. Eine Eigen-
die Zulassung, um die Unterzeichner schaft, die bei eurolepis-Hybriden häu-
der Stammzertifikate nicht einer un- figer auftritt.
leistbaren Verantwortung auszusetzen. Von Larix x eurolepis werden daher Manuel Karopka
Diesen Fall nahm man zum Anlass, nur wenige gelenkte Kreuzungsformen FVA, Abt. Waldökologie
um im gesamten Verwaltungsbereich für den Waldbau empfohlen, die man Tel.: (07 61) 40 18 - 1 81
des Regierungspräsidiums Tübingen zuvor in Anbauversuchen (mit Flächen manuel.karopka@forst.bwl.de10 FVA-einblick 1/2012
Insekt des Jahres 2012: der Hirschkäfer
von Andreas Schabel
Jeder kennt ihn, den großen Aber was wissen wir über ihn? Er gesunden Wurzeln, sondern ernährt
kastanienfarbenen Hirschkäfer. gehört zur Familie der „Schröter“ (Lu- sich von und in morschem verpilztem
Nicht nur als der größte seiner canidae), die mit vier Arten bei uns und feuchtem Holzsubstrat. Der Nähr-
Art, auch durch sein imposantes vorkommt. Es sind allesamt xylobion- wert des Holzes erschließt sich dabei
„Geweih“ – den bizarr vergrö- te, d.h. an Holz gebundene Arten. Im wohl vor allem durch die Pilzhyphen
ßerten Oberkiefer – ist er unver- Allgemeinen wird der Hirschkäfer mit und die Wiederverwertung der Kotbal-
wechselbar. Findet man an einem altem Eichwald assoziiert. Aber heißt len (Koprophagie).
lauen Juniabend einen solchen das auch, dass der Käfer wie z.B. Da der Käfer bzw. die Larve ein ho-
Käfer, bleibt er ob seiner archa- zahlreiche Bockkäferarten in alten Ei- hes Wärmebedürfnis hat, bevorzugt
isch anmutenden Erscheinung chen bzw. im toten Holz alter oder ab- er lichte bis offene, wärmebegünstigte
oft noch lange in Erinnerung. sterbender Bäume vorkommt? Ja und Wälder. Das bringt in unseren Brei-
nein, lautet die sybillinische Antwort! ten eine gewisse Affinität an sonnige
Tatsächlich entwickelt sich die Larve Kleinstandorte und den Eichenwald mit
– ähnlich der des Maikäfers oder des sich. Der Hirschkäfer ist dadurch an die
Nashornkäfers – viele Jahre tief im Bo- Verjüngung der Eiche im Schirm- bzw.
den. Das erklärt auch seine engerling- Kahlschlag gut angepasst, weshalb er
artige Larvenform. Im Gegensatz zum als große, xylobionte Art auch in bewirt-
Maikäfer frisst die Larve aber nicht an schafteten Wäldern sein Auskommen
findet. Tatsächlich zeigen aber Unter-
suchungen, dass der Hirschkäfer zu
den polyphagen Insekten gehört und
per se die Eiche als Brutstätte nicht
bevorzugt. Über 20 Holzarten sind bis-
lang als Bruthabitat gelistet, darunter
auch Nadelbäume und auffällig viele
Offenland-Baumarten wie Kirsche, Bir-
ke, Weide, Pflaume und Apfel. Neu ist
– und das ist ein Ergebnis der letztjäh-
rigen Hirschkäferkartierung der FVA im
Zuge der NATURA-Managementplan-
Erstellung, dass der Hirschkäfer auch
Stubben von (amerikanischen) Rotei-
chen als Brutstätte nutzt: Im Freiburger
Mooswald wurden überraschenderwei-
se die meisten Hirschkäfer in einem
rund 50-jährigen Roteichenbestand ge-
funden. Also in einem Wald, der weder
alt, noch licht ist. Folgeuntersuchun-
gen haben die anfänglichen Zweifel,
dass es sich hierbei tatsächlich um ein
an Roteiche gebundenes Hirschkäfer-
vorkommen handelt, rasch beseitigt.
Der Hirschkäfer demonstriert damit
eine hohe Anpassungsfähigkeit. Der
Käfer nutzt in einer klimatisch begüns-
tigten Umgebung (Oberrheinebene) die
durch regelmäßige Durchforstungs-
Abb. 1: Zangen des Hirschkäfres eingriffe kontinuierlich bereit gestelltenFVA-einblick 1/2012 11
zahlreichen Stubben als Brutsubstrat.
Diese weisen bereits in jungem Alter
ausreichende Dimensionen von ca.
Mehr über den Wald wissen
40 cm Durchmesser auf. Nachdem
die Roteiche einen recht breiten, sich
rasch zersetzenden Splintholzbereich
hat, können die Stubben bereits besie-
delt werden, bevor die Zersetzung des
Kernholzes beginnt. Da sich das ver-
mulmte Holz zunächst auf den Splint
beschränkt, könnte dies der Grund
sein, warum die zahlreich gefundenen
Käfer bzw. Käferteile insgesamt etwas
kleinwüchsiger sind.
Mit der Wahl des Hirschkäfers zum
Insekt des Jahres 2012 wird die Auf-
merksamkeit auf eines unserer be-
merkenswertesten Insekten gelenkt.
Wie kaum eine andere Art steht der
Hirschkäfer für das verklärte, romanti-
sierte Bild des „deutschen Waldes“ und
illustriert die Bedeutung des Waldes
für den Artenschutz. Es ist daher ein
lohnendes Unterfangen, sich die Erhal-
tung des Hirschkäfers auf seine Fah-
nen zu schreiben. Mit Hilfe seiner An-
passungsfähigkeit und vielleicht auch
durch den Klimawandel begünstigt,
sollte es gelingen, dass auch künftige
Generationen beim Anblick des Hirsch-
käfers ins Staunen geraten.
Wie? Mit waldwissen.net!
Denn dort finden Sie:
p fundiertes und aktuelles Waldwissen aus drei Ländern
p über 2500 Artikel für Forstpraktiker und Waldinteressierte
p Ihr persönliches Forstlexikon unter »Mein Waldwissen«
p Kontakte zu Experten aus der Waldforschung
Neugierig?
Dann schauen Sie doch
einfach rein – wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
Andreas Schabel
FVA, Abt. Waldökologie
p www.waldwissen.net
Tel.: (07 61) 40 18 – 1 68
andreas.schabel@forst.bwl.de
fva-bw_anzeige_105x210mm_rz.indd 1 04.10.2012 FVA-einblick 1/2012
Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“ – eine durch
Buchdruckerbefall getriebene Walddynamik
von Katarzyna Zielewska und Eberhard Aldinger
Der Bannwald „Wilder See-Hor- Die terrestrische Waldstrukturauf- Zeitreihe von sechs ausgewählten CIR-
nisgrinde“ zählt zu den fich- nahme (WSA) und die Luftbildauswer- Luftbildern der Periode 1991 bis 2009
tenreichen Bannwäldern der tung, deren Ergebnisse hier präsentiert rekonstruiert werden (Abb. 1).
montanen und hochmontanen werden, erfolgen im Forschungspro- Dargestellt sind in grün die bruttaugli-
Höhenstufe des Buntsandstein- gramm von ForstBW. Im Zuge der chen fichtenreichen Bestände ab einer
schwarzwaldes. Wie in vielen Ausweisung der Bannwälder wird die Bestandeshöhe von > 20 m. Rot dar-
anderen fichtenreichen Wäl- Waldstruktur in einem 0,1 ha großen gestellt sind die befallenen Bestandes-
dern kam es auch hier nach den Probekreis (Verkleinerung auf 0,05 ha flächen; nicht befallsfähige, junge Be-
Stürmen des Jahres 1990 zur bei sehr großer Stammzahl) in einem stände und fichtenarme bzw. Bestände
Massenvermehrung des Buch- Stichprobenraster erhoben (Kärcher et ohne Fichte sind weiß belassen.
druckers, obwohl die damalige al. 1997) und nach Möglichkeit Colorin- Die Aufnahmen 1995 und 1996 zei-
Bannwaldfläche nur in sehr ge- frarot-Luftbilder (CIR) im Maßstab von gen, dass zuerst die Althölzer entlang
ringem Umfang vom Sturmwurf 1:5.000 angefertigt (Ahrens 2001, der Karwand und die Hänge entlang
betroffen war (60 umgestürzte Ahrens et al. 2004). Die Aufnahmen des Seebachs befallen wurden. Von
Bäume beim Seelochbach). Der werden erstmals möglichst bei der dort aus breitete sich der Buchdrucker
Absterbeprozess der Fichten- Ausweisung der Bannwälder angefer- weiter in den Bannwald aus, wie die
wälder, der seit mehr als 20 Jah- tigt, danach folgen weitere Aufnahmen Aufnahmen aus den Jahren 1998, 2003
ren vom Borkenkäfer im Bann- nach Bedarf. und 2009 zeigen.
wald verursacht wird und sich Das punktuelle Stichprobenraster der Im Jahr 1991 gab es 92 ha potenti-
ständig fortsetzt, hat bis heute WSA erfasst verschiedene waldwachs- elle Brutbestände, nur 0,5% davon wa-
insgesamt 38% der Bannwald- tumskundliche Parameter wie Baumart, ren damals vom Buchdrucker befallen.
fläche betroffen. Wie schnell hat Brusthöhendurchmesser, Höhe und na- In den Folgeaufnahmen stieg der An-
sich der Buchdrucker ausgebrei- turschutzfachlich interessante Merkma- teil an Störungsflächen auf 8% (1995),
tet? Wie viel Fläche ist befallen le an lebenden und toten Bäumen so- 18% (1996), 42% (1998), 49% (2003)
und wie hoch ist heute der Tot- wie die Verjüngung. Aufnahmen liegen und 61% (2009). In weniger als 20 Jah-
holzvorrat? für die Jahre 1995 und 2010 vor. ren wurde mehr als die Hälfte der Brut-
Mit der Luftbildauswertung werden bestände vom Buchdrucker zum Ab-
flächenhafte Waldstrukturen erfasst. sterben gebracht. Es handelte sich hier
Durch den Einsatz großmaßstäblicher vor allem um den Befall von stehenden
und großformatiger CIR-Luftbilder eig- Bäumen, die heutzutage als stehendes
net sich das Verfahren besonders gut Totholz das Bild des Bannwaldes stark
für die Dokumentation von Störungs- prägen (Abb. 2 und 3). Damit sinkt das
prozessen im Wald und für die Beob- durchschnittliche Alter der Bäume im
achtung der horizontalen Ausprägung Bannwald – der Wald wird jünger, wert-
von Waldstrukturen und deren Verän- volles Altholz wird seltener.
derungen. Es liegen zahlreiche Luftbil- Derzeit gibt es noch rund 40 ha po-
der seit 1951 bis 2009 vor. tenziell brutfähige Bestände – die Stö-
rung kann demnach weiter laufen.
Die WSA weist bei der ersten Auf-
Ausbreitung nahme 1995 noch einen Vorrat von
des Buchdruckerbefalls 269 Vfm/ha an lebenden Bäumen auf.
Zu rund 80% sind es Fichten, weniger
Der zeitliche und räumliche Verlauf als 9% Tannen. Fünfzehn Jahre später
der Borkenkäferstörung, der in den ist der Vorrat an lebenden Fichten stark
letzten 20 Jahren sehr dynamisch um 111 Vfm/ha gesunken, sein Anteil
fortgeschritten ist, kann anhand einer am Gesamtvorrat liegt nun bei nur nochFVA-einblick 1/2012 13
70%. Dafür ist der Tannenanteil auf
28% angestiegen. Die Buche kommt im
Bannwald nur in geringen Anteilen vor.
Sie wird im Stichprobenraster nur auf 4
Punkten erfasst und zeigt keine Reakti-
on auf die Störung.
Der Totholzvorrat war im Bannwald
bereits im Jahr 1995 mit insgesamt 156
Vfm/ha bemerkenswert hoch. Hochge-
rechnet bedeutet dies, dass im Bann-
wald rund 12.500 fm Totholz lagen. Da-
bei überwog das stehende Totholz mit
nahezu der vierfachen Menge des lie-
genden Holzes. Bei der Zweitaufnahme
stieg die Totholzmenge auf 268 Vfm/ha,
d.h. dass die gesamte Totholzmenge
im Bannwald auf rund 21.000 fm ge-
stiegen ist. Nun überwiegt der Anteil
des liegenden Totholzes deutlich.
Die Durchmesser des Totholzes be-
ginnen ab 14 cm. Bei der Aufnahme
im Jahr 2010 waren vor allem Fichten
mit den Durchmessern von 20-30 cm
zu finden. Auch der Zersetzungsgrad
hat sich zwischen 1995 und 2010 ver-
ändert: Die stärker zersetzten Anteile
haben deutlich zugenommen.
Abb. 1: Gesamtbefall der Fläche durch den Borkenkäfer
Wandel der Waldstrukturen
Auf der Grundlage der Luftbild-Jahr- Baumbewuchs (< 30% Überschirmung) und Sukzessionsflächen sind von 19
gänge 1996 und 2009 können im Bann- oder Verjüngung (< 50% Deckung) auf 16% (23,4 ha) bzw. von 8 auf 6%
wald „Wilder See-Hornisgrinde“ die zeigen, sowie Sukzessionsflächen mit (9,6 ha) zurück gegangen.
Waldstrukturen ausgewertet werden. walduntypischer Flächenstruktur z.B. Im Vergleich zu 1996 wurden 2009
Unterschieden werden Störungsflä- Moore oder Latschen. die Einzelflächen kleiner und sind
chen, auf denen die Folgen des Buch- Im Untersuchungszeitraum haben gleichmäßiger über den ganzen Bann-
druckerbefalls deutlich zu sehen sind; die Störungsflächen von 11 auf 17% wald verteilt (Abb. 4). Die natürlichen
Freiflächen, die vorübergehend kein (25,5 ha) zugenommen, die Freiflächen Altersstufen der Bestände bilden ein
Abb. 2: Abgestorbene Fichten auf den Störungsflächen in der Karwand oberhalb des Wilden Sees14 FVA-einblick 1/2012
chen des Bannwaldes. Sie gehen auf
die flächige Räumung nach Sturm und
Borkenkäferbefall zwischen 1990 und
1994 zurück.
Auf den Störungs- und Freiflächen
ist 2009 reichlich Verjüngung vorhan-
den. Auch die jüngeren Bestände,
Jungwuchs, Dickung und Stangenholz,
nahmen im Vergleich zu Aufnahme
1996 deutlich zu. Sie sind von Nadel-
holz bzw. Fichte dominiert und werden
in der Zukunft potentielle Brutbestände
des Buchdruckers. Da es mittels der
Luftbilder nicht möglich ist, die Baumart
Abb. 3: Abgestorbene Fichten in der Karwand oberhalb des Wilden Sees
der Verjüngung und des Jungwuchses
sicher zu bestimmen, kann die Frage
kleinflächigeres Mosaik mit einer stär- der Altbestände durch Buchdruckerbe- zur Veränderungen in der Baumarten-
ker ausgeprägten vertikalen Struktur. fall aus Naturverjüngung entstanden. zusammensetzung in diesen Altersstu-
Der Anteil an strukturreichen Bestän- Diese Flächen verteilen sich nahezu fen nicht beantwortet werden.
den ist in den letzten 13 Jahren von gleichmäßig über den Bannwald (au- Die Auswertung der WSA-Aufnahme
21% (1996) auf 43% (2009) gestiegen. ßer an westlichen Steilhängen) und re- zeigt, dass die Naturverjüngung vor al-
Die jüngeren Altersphasen nehmen präsentieren die Flächen, die sich nach lem auf den Störungsflächen stark ein-
zu: Jungwuchs und Dickung von 8% der Buchdruckergradation schon ver- gesetzt hat (Abb. 5).
auf 37%, Stangenhölzer von 7% auf jüngt haben. Stangenhölzer befinden In beiden Höhenklassen hat die Fich-
15%. Sie sind nach dem Absterben sich vor allem auf den Erweiterungsflä- tenverjüngung sehr stammzahlreich
eingesetzt, neu hinzu gekommen ist die
Vogelbeere. Die frühe und kräftige Auf-
lichtung nach dem Buchdruckerbefall
scheint der Naturverjüngung von Fich-
te mehr Vorteile zu verschaffen als der
Tanne. Die Anzahl der Fichte liegt beim
Zehnfachen der Tanne. Die meist ein-
zelnen oder in kleinen Gruppen wach-
senden Tannen lassen nicht vermuten,
dass ihr Anteil zunehmen wird. Aller-
dings profitiert die Tanne zum Zeitpunkt
des Buchdruckerbefalls, so dass ihr An-
teil in höherem Alter zunehmen kann.
Trotz des massiven Absterbens
von Fichtenbeständen bestehen im
Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“
weiterhin günstige Bedingungen zur
Fortsetzung der Ausbreitung des Buch-
druckers. Die Baumart Fichte dominiert
die Bestände weiterhin mit geringen
Beimischungen von Tanne, Kiefer und
Buche. Die 2009 kartierten ca. 40 ha
potentieller Buchdrucker-Brutbestände
und die nachwachsenden Stangen-
holz-Fichtenreinbestände (mit frisch
abgestorbenen Bäumen!) lassen auf
eine weitere Borkenkäferausbreitung
schließen. Geschwindigkeit und Aus-
maß dieses Prozesses bleiben von vie-
Abb. 4: Bestandesstrukturen im Bannwald Wilder See-Hornisgrinde 1996 und 2009 len Faktoren abhängig, z.B. Witterung,FVA-einblick 1/2012 15
Klimawandel, Flächenmosaik, Verän-
derungen in der Baumartenzusammen-
setzung sowie Gesundheitszustand der
Bäume, und sind deshalb schwer vor-
herzusagen. Auch wenn nach Auslau-
fen der jetzigen Buchdruckergradation
eine Phase der Konsolidierung eintre-
ten sollte, ist doch damit zu rechnen,
dass die dann wieder in stärkere Di-
mensionen wachsenden Fichten nach
Sturm und oder längeren Trockenheits-
und Wärmephasen wiederum gute Vor-
raussetzungen für eine neue Gradation
bieten.
Abb. 5: Jungwuchs (N/ha) auf „gestörten“ Flächen nach Baumarten 1995 und 2010
Bei der aktuellen Dynamik der Wald-
entwicklung ist der Bannwald Wilder
See-Hornisgrinde durch den hohen an-
thropogenen Fichtenanteil und die ge-
ringe Beimischung an standortsheimi-
schen Baumarten noch weit von einem
natürlichen Waldzustand entfernt. Nach
heutiger Erkenntnis wird es noch viele
Jahrzehnte dauern, bis sich nennens-
werte Anteile der Schlusswaldbaumar-
ten gegen die starke Konkurrenz der
Fichte durchgesetzt haben.
Dr. Eberhard Aldinger
FVA, Abt. Waldökologie
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 83
eberhard.aldinger@forst.bwl.de Abb. 6: Verjüngung und Jungwuchs in der Karwand
Literatur
Ahrens, W. (2001): Analyse der Wald- turen im Luftbild. Arbeitsanleitung für
Kärcher, R.; Weber, J.; Baritz, R.; Förster, entwicklung in Naturwaldreservaten Waldschutzgebiete in Baden-Würt-
M.; Song, X. (1997): Aufnahme von Wald- auf Basis digitaler Orthobilder. Dis- temberg. Schriftenreihe Waldschutz-
strukturen: Arbeitsanleitung für Wald- sertation. Universität Freiburg, 143 S. gebiete Baden-Württemberg, Band
schutzgebiete in Baden-Württemberg. Ahrens, W., Brockamp, U., Pisoke, T. 5. 54 S.
Mitt. FVA Baden-Württemberg 199, 57 S. (2004): Zur Erfassung der Waldstruk-16 FVA-einblick 1/2012
Rindenschäden durch Holzernte:
altbekannt, gern verdrängt
von Ulrich Kohnle, Udo Hans Sauter, Aikaterini Nakou, Michael Nill
Spätestens die umfangreiche Dieser Frage ging die FVA auf Initi- Ergebnisse der BI bezüglich
Arbeit von Winfried Meng (1978) ative von Stefan Gauckler, dem lang- Rindenschäden
machte in Baden-Württemberg jährigen Leiter der Abteilung Forstein-
nachdrücklich klar, welche Be- richtung Tübingen-Süd, im Auftrag des Erschreckend sind vor allem die Be-
deutung Rindenschäden zu- MLR in einem Projekt und der damit funde zum Umfang der Rindenschä-
kommt, die Forstbetriebe bei verbundenen Dissertation von Michael den: Ausweislich der BI tragen etwa
der Holzernte verursachen. Der Nill (2011) eingehend nach. Um nicht 20% der Bäume mit BHD>7cm in Ba-
Umgang mit dem Problem und eine weitere, in der Aussagekraft be- den-Württemberg einen durch Holzern-
Anstrengungen zur Begrenzung grenzte Fallstudie zu produzieren, wur- te verursachten Rindenschaden. Zwar
stehen seither kontinuierlich im de die Untersuchung von vorne herein entnahmen die Betriebe bei Durchfors-
Fokus lebhafter Diskussionen auf eine breite Basis gestellt. Diese tungen bevorzugt bereits beschädigte
und betrieblicher Richtlinien. Bei setzte sich aus zwei unterschiedlichen Bäume. Der Anteil neu beschädigter
einem so hohen Grad an Auf- Datensätzen zusammen: Bäume war jedoch so hoch, dass in-
merksamkeit sollte man eigent- Zum einen aus geeigneten Daten nerhalb der Periode zwischen der
lich erwarten können, dass sich der Betriebsinventur (BI). Zur Aus- Erst- und der Folgeinventur das Rin-
die Problemlage zwischenzeit- wertung herangezogen wurden Stich- denschadprozent zwischenzeitlich um
lich entspannt hat. Ist das aber probenpunkte, an denen a) nach der im Mittel 4% angestiegen ist. Gleichzei-
tatsächlich auch der Fall? Erstaufnahme zwischenzeitlich auch tig war eine tendenzielle Verschiebung
eine Wiederholungsaufnahme vor- von bodennahen Rindenschäden hin
liegt, und bei denen b) das Merkmal zu höher am Stamm liegenden Schä-
„Rindenschäden durch Holzernte“ den zu konstatieren.
konsistent erfasst worden war. Die
ausgewertete Datenbasis umfasst
etwa die beiden zurückliegenden Baumartenspezifische
Jahrzehnte. Einbezogen sind Inven- Anfälligkeit
turen aus 43 Betrieben (öffentlicher
Wald) mit über 50.000 Stichproben- Die BI zeigt auch, dass es beim Risi-
punkten und Aufnahmedaten zu etwa ko beschädigt zu werden, Unterschiede
einer halben Million Bäume. Zum an- zwischen Baumarten gibt. Besonders
deren wurde eine Untersuchung von empfindlich zeigen sich Fichte und
Praxishieben auf breiter Basis kon- Buche. Beim Vergleich Fichte / Tanne
zipiert; realisiert in Zusammenarbeit bestätigen die BI-Befunde die bereits
zwischen FVA und Forstlichen Stütz- früher festgestellte vergleichsweise
punkten. Erfasst wurden dabei rund größere Robustheit der Tannenrinde
180 Hiebe, bei denen auf etwa 2.300 gegenüber Beschädigungen (Kohnle &
Stichprobenpunkten rund 25.000 Kändler 2007).
Bäume aufgenommen wurden. Aus der Untersuchung der Praxis-
Diese außerordentlich breite Daten- Hiebe ergeben sich ergänzende Hin-
basis ist geeignet, der Studie den an- weise zum Einfluss hiebsspezifischer
gestrebten repräsentativen Charakter Faktoren auf die Entstehung neuer
zu verschaffen. Zwei wissenschaftliche Rindenschäden. Hingewiesen sei in
Publikationen mit Details zu Datenba- diesem Zusammenhang, dass sich
sis, Methoden und Ergebnissen liegen die Untersuchungen bisher lediglich
bereits vor (Nill 2011; Nill et al. 2011); auf das Auftreten von Rindenschä-
eine dritte ist in Vorbereitung Nakou et den >10cm² Größe beschränken.
al. (2012). Der Einfluss auf die Größe der Rin-FVA-einblick 1/2012 17
denablösungen und die Schwere
der Verletzungen wurde (noch) nicht
analysiert.
Erklärende Variablen
im Prognosemodell
Insgesamt zeigte sich, dass eine
Vielzahl von Faktoren Einfluss auf die
Entstehungswahrscheinlichkeit eines
Rindenschadens haben. Folgende
Faktoren erwiesen sich als signifikant
und hatten einen so starken Einfluss
Abb. 1: Gegenüberstellung der gemessenen (realen) Schadprozente mit den mo-
auf die Auftretenswahrscheinlichkeit dellierten (geschätzten) Schadanteilen. Die Achsen enthalten eine prozentuale
eines Rindenschadens, dass sie sich Teilung von 0 – 80%; je näher die Werte um die Winkelhalbierenden gruppiert
für das entwickelte Prognosemodell sind, umso zutreffender sagt das entwickelte Modell die Schäden voraus.
als unverzichtbar erwiesen: mittle- Die linke Grafik zeigt die ausschließlich auf der Basis „hart“ gemessener
re Vorrückeentfernung, Abstand ei- hiebsspezifischer Einzeleffekte (Baumart, Vorlieferentfernung, Ernteverfahren,
Eingriffstärke etc.) geschätzen Erwartungswerte; die rechte Grafik enthält darü-
nes Baumes zur Erschließungslinie, berhinaus die Wirkung zusätzlicher Faktoren, deren Effekte eindeutig betriebli-
Eingriffstärke, Baumart, Baum- bzw. chen Ebenen zugeordnet werden können, die jedoch nicht auf „hart“ messbare
Bestandeshöhe, Arbeitsverfahren, Einzelfaktoren zurückgeführt werden können.
Bestandesdichte und Stärke des aus-
scheidenden Bestandes. Daneben
ließ sich für weitere Faktoren ein Ein- ter gemischter Modelle eine sehr gute können, erklärt das Modell die beob-
fluss auf die Entstehung von Rinden- Möglichkeit. Dieser analytische Ansatz achtete Streuung der Schadprozente
schäden nachweisen. Hierzu gehörten ermöglicht es, die nach der Erklärung nahezu ideal (Abbildung 1).
beispielsweise Hangneigung, Durch- durch (signifikante) konkret gemesse-
forstungsturnus oder Abweichungen ne Faktoren noch verbleibende Rest-
zwischen Fäll- und Vorrückerichtung. streuung der Daten daraufhin zu unter- Rindenschäden – ein be-
Trotz statistischer Signifikanz war de- suchen, welcher Erhebungsebene der triebsspezifisches Problem?
ren Erklärungspotential jedoch ver- Daten sie zuzuordnen ist. Im konkreten
gleichsweise gering, so dass sie für Fall handelte es sich um die Aufteilung Nicht unerwartet wird die Entstehung
das entwickelte Prognosemodell ver- der Zuordnung auf folgende Datenebe- von Rindenschäden in nennenswer-
zichtbar erschienen. nen: Hiebsebene (Baum, Stichproben- tem Umfang durch konkret messbare,
Insgesamt ist festzuhalten, dass das punkt, Hieb), Betriebsebene (Revier, hiebsspezifische Rahmenbedingungen
entwickelte Prognosemodell die Wahr- Forstbezirk) sowie die nicht erklärbare beeinflusst. Zu diesen „hart messba-
scheinlichkeit des Auftretens von Rin- Reststreuung. ren“ Faktoren zählen u. a. Vorlieferent-
denschäden zwar recht gut und plausi- Interessant sind in diesem Zusam- fernung, Eingriffstärke, Ernteverfahren,
bel erklären konnte. Trotzdem blieb bei menhang die beiden folgenden Befun- Baumart etc. Das absolute Schad-
Berücksichtigung der gemessenen Ein- de: niveau wird durch solche „harten“
flussfaktoren im Prognosemodell ein •• Der Löwenanteil der nicht durch Hiebsfaktoren jedoch nicht unverän-
nennenswerter Anteil der in den Praxis- konkret messbare Einflussfaktoren derlich und zwangsläufig vorbestimmt,
Hieben zu beobachtenden Streuung im Modell erklärten Streuung entfiel sondern unterliegt einer relativ großen
der Rindenschadensprozente uner- auf die Betriebsebene; Hiebsebene Variationsbreite. Diese wird ganz of-
klärt. Diese Beobachtung lässt prinzi- und unerklärte Gesamtstreuung über fenkundig substantiell von betriebs-
piell zwei Hypothesen zu: Entweder alle Datenebenen hinweg spielten im spezifischen Eigenheiten geprägt, die
spielte echter Zufall bei der Entstehung Vergleich dazu eine untergeordnete einerseits keineswegs weitgehend dem
der Rindenschäden eine nennenswerte Rolle. Zufall überlassen sind, aber anderer-
Rolle oder nicht alle erklärenden Ein- •• Wird zusätzlich zu den konkret ge- seits auch nicht in Form „hart“ messba-
flussgrößen wurden im Rahmen der messenen Faktoren die Wirkung der rer Hiebsfaktoren konkretisiert werden
Untersuchung aufgenommen. Faktoren einbezogen, die aus der können.
Zur zumindest teilweisen Beantwor- Datenbasis zwar nicht näher diffe- Bei der Holzernte scheint es also
tung dieser Frage bot der für die Da- renziert, aber eindeutig konkreten ähnlich zuzugehen wie beim Einsatz
tenanalyse gewählte Ansatz sogenann- Datenebenen zugeordnet werden von Beton: Es kommt darauf an, was18 FVA-einblick 1/2012
entwickelnden Rindenmerkmale später
grundsätzlich zu einer Qualitätsabstu-
fung bei höherwertigem Buchenstamm-
holz führen.
Abb. 2: Rindenschäden an einer Fichte
man (Betrieb) daraus macht. Oder den verbundene hohe Wundfäulerisiko
anders ausgedrückt: Aus vergleichba- und Entwertungspotential. Mutmaß-
ren „harten“ Hiebsvoraussetzungen lich stehen diese Schäden zumindest
können betriebsspezifisch ganz offen- gleichrangig neben den durch Sturm,
kundig sehr unterschiedliche Schad- Kernfäulen oder Borkenkäfern verur-
prozente entstehen. Inwieweit dies auf sachten Ertragseinbußen.
Faktoren wie Motivation, Setzung von Andere Nadelbaumarten erscheinen
(ökonomischen) Prioriäten oder Sorg- dagegen weniger empfindlich. Bei-
falt im Umgang mit Ernteverfahren be- spielsweise liegt bei Tanne zusätzlich
ruht, sei der Spekulation der geneigten zur vergleichsweise robusten Rinde
Leserschaft überlassen. das Infektionsrisiko nach Rindenverlet-
zungen deutlich unter demjenigen der
Fichte (Kohnle & Kändler 2007, Metzler
Ökonomische Folgen et al. 2012). Bei Buche ist zwar festzu-
von Rindenschäden stellen, dass sich das von einem Rin-
denschaden ohne Verletzung des Holz-
Möglicherweise bietet sich hier ein körpers ausgehende Infektionsrisiko
neuer Ansatz für betriebliche Strategi- auf einem ähnlich (niedrigen) Niveau
en zur Reduktion des gegenwärtig an wie bei Tanne zu bewegen scheint.
sich inakzeptabel hohen Niveaus von Trotzdem ziehen bei dieser Baumart
Rindenschäden durch Holzernte. Aus Rindenverletzungen ein erhebliches
ökonomischen Gründen scheint dies Entwertungspotential nach sich: So
insbesondere in der Fichtenwirtschaft hat eine Stützpunkt-Untersuchung im Prof. Dr. Ulrich Kohnle
dringend geboten. Aus Praxis und Wis- Bereich der Schwäbischen Alb gezeigt, FVA, Abt. Waldwachstum
senschaft sattsam bekannt sind das dass bei den aktuellen Sortiergepflo- Tel.: (07 61) 40 18 - 2 51
bei dieser Baumart mit Rindenschä- genheiten die sich aus Rindenschäden ulrich.kohnle@forst.bwl.de
Literatur
Landesforstverwaltung Bd. 53, 159. J.-Ztg. (in Vorbereitung).
Kohnle, U., Kändler, G. (2007): Is Silver Metzler, B., Hecht, U., Nill, M., Brü- Nill, M. (2011): Rindenschäden durch
fir (Abies alba) less vulnerable to ex- chert, F., Fink, S., Kohnle, U. (2012): Holzernte in Baden-Württemberg -
traction damage than Norway spruce Comparing Norway spruce and silver Ursachen und Prognose. Freiburger
(Picea abies)? Eur J For Res 126, fir regarding impact of bark wounds. Forstl. Forschung Bd. 50, Freiburg,
121-129. For Ecol and Manage (eingereicht). 161 S.
Meng, W. (1978): Baumverletzungen Nakou, A., Nill, M., Sauter, U.H., Kohn- Nill, M., Kohnle, U., Sauter, U.H. (2011):
durch Transportvorgänge bei der le, U. (2012): Rindenschäden durch Rindenschäden mit mutmaßlichem
Holzernte - Ausmaß und Verteilung, Holzernte: Analyse, Modellierung Bezug zur Holzernte im Spiegel der
Folgeschäden am Holz und Versuch und Evaluierung auf der Basis zweier Betriebsinventuren in Baden-Würt-
ihrer Bewertung. Schriftenreihe der Praxis-Großversuche. Allg. Forst- u. temberg. Forstarchiv 82, 216-224.Sie können auch lesen