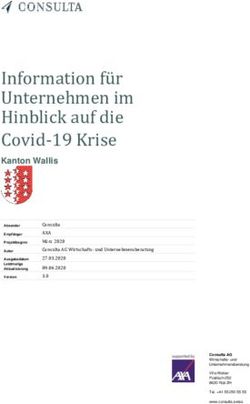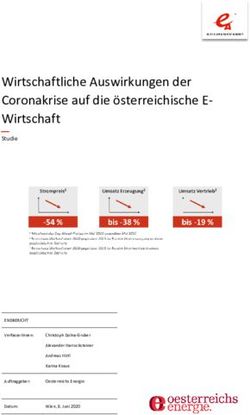Ergebnisse Mittelstandsradar - Digitalisierung Volkswirtschaft-licher Rahmen Stimmung Finanzierungs-bedingungen Summary - Die LBBW
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bereit für Neues Ergebnisse Mittelstandsradar. Research für Unternehmen Digitalisierung Seite 05 Volkswirtschaft- licher Rahmen Seite 13 Stimmung Seite 20 Finanzierungs- bedingungen Seite 29 Summary Seite 41
Der neue LBBW Mittelstandsradar ist da: Was hat sich verändert? Seit diesem Jahr präsentiert sich der LBBW Mittelstandsradar in neuem Gewand. Das bisherige Format des Mittelstandsradars beruhte vollumfänglich auf den Ergebnissen unserer Unternehmensbefragung. Nun fokussiert sich die Umfrage auf ein Sonderthema. In dieser Aus- gabe geht es um die Frage »Wie lang ist der digitale Wunschzettel im Mittelstand?« Hierzu haben wir mittelständische Unternehmen zu Digitalisierung, Cloud-Computing und Portalnutzung befragt. Darüber hinaus ist das Ziel des neuen Mittelstandsradars, auf Basis von Sekundärdaten detaillierte Einblicke in mittelstandsspezifische An- liegen zu gewinnen. Dabei werden zahlreiche Themenfelder abgedeckt. Diese reichen von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Mittelstand über die Stimmung der Unternehmer bis hin zu Finanzie- rungsbedingungen der Mittelständler. Über eigens von uns entwickelte Scorings werden die Inhalte übersichtlich aufbereitet und schlussend- lich zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Das LBBW Research wünscht Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Inhalt
Ergebnisse Mittelstandsradar
01
04
Digitalisierung:
Wo steht der deutsche
Mittelstand?
Seite 05
Finanzierungsbedingungen
im Mittelstand.
02
Seite 29
05
04
Volkswirtschaftliche
Rahmenbedingungen
im Mittelstand.
Seite 13 Summary:
Der LBBW Mittelstandsradar
in Kürze.
03
Seite 41
Stimmung im Mittelstand.
Seite 20
Inhalt01
Ergebnisse Mittelstandsradar
Digitalisierung:
Wo steht der deutsche
Mittelstand?
01.1 | Die Digitalisierung im Mittelstand gewinnt an Fahrt.
Digitalisierungsstand der Unternehmen Unser Lagebarometer reflektiert hierzu die Selbst-
auf gutem Niveau. einschätzung der Unternehmen zu ihrem Digitali-
sierungsgrad. Die Mittelständler ordnen den Digi-
talisierungsstand ihres Unternehmens im Ver-
Die Corona-Krise dürfte für Unternehmen gleich zur Branche auf einer sechsstufigen Skala
unterschiedlicher Branchen der letzte Warn- von 1 (= voll entwickelt) bis 6 (= überhaupt nicht
06
ruf gewesen sein, dass die Digitalisierung entwickelt) ein.
keine Aufgabe unter vielen ist, sondern ab-
solute Priorität haben sollte. Die bisherigen Der Durchschnittswert der Einstufung liegt auf
dem Lagebarometer bei rund 3 Punkten. Bei vo-
Erkenntnisse aus dem Corona-Schock haben
rangegangenen Umfragen erreichte das Lageba-
gezeigt, wie fragil die operativen Tagesge- rometer ein ähnliches Niveau. Die Unternehmen
schäfte in einigen Branchen sind. des Produzierenden Gewerbes stufen sich dabei
mit 3,1 Punkten etwas schlechter als die Dienst-
Es ist daher umso erfreulicher, dass Digitalisie- leister (2,9 Punkte) ein. Somit schätzen die Unter-
rung – die neue oder ergänzende Prozesse und Ge- nehmen ihren aktuellen Digitalisierungsstand im
schäftsmodelle ermöglicht – das absolute Top- Vergleich zur eigenen Branche nach wie vor im
thema für mittelständische Unternehmen ist und guten Mittelfeld ein.
bleibt. Dies zeigt das Ergebnis der diesjährigen
LBBW Kundenbefragung zum Sonderthema Digi-
talisierung, Cloud-Computing und Portalnutzung.
»Wie schätzen Sie den aktuellen
Digitalisierungsstand in Ihrem Unternehmen
im Vergleich zu Ihrer Branche insgesamt ein?«
voll Stand der Digitalisierung überhaupt
Digitalisierung
entwickelt nicht entwickelt
1 2 3,1 4 5 6
Quelle: LBBW ResearchErgebnisse Mittelstandsradar
»Worauf wollen Sie künftig Ihren
Investitionsschwerpunkt legen?«
Prozentualer Anteil der Nennungen der jeweiligen Kategorie (Mehrfachnennungen möglich)
Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen
Erneuerung IT-Infrastruktur (Hard- und Software)
Forschung und Entwicklung
Logistik, Transportsysteme
Grundstücke, Gebäude
Geschäftsausstattung
Anderes
Weiß nicht / keine Angabe
70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
Quelle: LBBW Research
Künftige Investitionsschwerpunkte liegen Willen haben, dieses wegweisende Thema aktiv
klar auf der Digitalisierung und Erneuerung anzugehen. Dabei setzen rund 59 % aller Indus
der IT-Infrastruktur. trieunternehmen die Digitalisierung auf die In-
vestitionsagenda. Dem steht ein Anteil von 73 %
07
Die Digitalisierung genießt auf der Agenda der Un- bei den Dienstleistern gegenüber.
ternehmen einen hohen Stellenwert, wie die Prio-
ritätenrangfolge verdeutlicht. Die Unternehmen In den nächsten drei Jahren plant fast die Hälfte
legen ihre zukünftigen Investitionsschwerpunkte der befragten Unternehmen jährlich durchschnitt-
auf »IT-Infrastruktur (Soft- und Hardware)« sowie lich 250.000 bis 1.000.000 EUR in die Digitalisie-
»Digitalisierung (Prozesse und Geschäftsmodelle)«. rung und in die Erneuerung der IT-Infrastruktur
Die erreichten Werte zeigen, dass mehr als die zu investieren. Lediglich bei 0,83 % der Befragten
Hälfte der befragten Mittelständler den klaren sind keine derartigen Investitionen vorgesehen.
»Wie hoch Digitalisierungs-Investitionen von
schätzen Sie bis zu 1 Mio. EUR jährlich geplant.
die geplanten Prozentualer Anteil der Nennungen der jeweiligen Kategorie
jährlichen 0,8 % 3,3 %
Investitionen
Ihres Unter- 15,7 %
< 250.000 EUR
nehmens in die 250.000 – 1 Mio. EUR
Digitalisierung/ 32,2 %
> 1 Mio. EUR
IT-Erneuerung Keine Investitionen
bis 2023 ein?« vorgesehen
47,9 %
Digitalisierung
Weiß nicht / keine Angabe
Quelle: LBBW Research01.2 | Cloud-Nutzung: Vorteile, nicht nur in Corona-Zeiten.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Eine erarbeitete IT- und Digitalisierungsstrategie, die eine cloudbasierte IT-Landschaft in
den Mittelpunkt stellt und Lösungen auf den unterschiedlichen Ebenen (PaaS, IaaS, SaaS)
berücksichtigt, könnte in den kommenden Jahren vor allem für Mittelständler sehr inte
ressant sein.
Diese haben einerseits den Anspruch, agil, flexibel und effizient
zu arbeiten sowie dynamisch zu wachsen, anderseits verfügen sie
oftmals nur über ein limitiertes IT-Budget. Je nach Bedarf werden
Software-Anwendungen (SaaS, Software as a Service) sowie die
Nutzung von Speicherplatz und Rechenkapazität (IaaS, Infrastruc-
ture as a Service) über das Internet bezogen. Zusätzlich zur Hard-
ware und dem Betriebssystem bei IaaS wird den Unternehmen
Anwendungsinfrastruktur in Form von Datenbanken oder Entwick-
lertools über das Internet bereitgestellt (PaaS, Platform as a Service).
Darüber hinaus zeigte sich, dass Unternehmen nicht nur in norma- Unternehmen profitieren
len Zeiten, sondern auch in Ausnahmesituationen von einer diver- von einer diversifizierten
sifizierten IT-Landschaft profitieren. Unternehmen, die beispiels- IT-Landschaft – gerade in
weise während den Quarantäne- und Sicherheitsmaßnahmen Ausnahmesituationen.
zur Corona-Pandemie über skalierbare Cloud-Kapazitäten und
Cloud-Anwendungen verfügten, dürften die besten Grundvoraus-
setzungen für das mobile Arbeiten von zu Hause aus gehabt ha-
ben. Somit dürfte ihr operatives Tagesgeschäft weniger stark be-
einträchtigt worden sein als das jener Unternehmen, die keine oder
nur begrenzte Remote-Zugänge anbieten konnten.
08
Mit einer bedarfsorientierten und strukturierten Cloud-Transfor-
mation im unternehmenseigenen Tempo bliebe darüber hinaus
zukünftig mehr Zeit, um sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren,
da der Betrieb und die Verwaltung der IT-Ressourcen durch den
Cloud-Anbieter abgewickelt würden. An einer Cloud – sei es Public,
Private oder Hybrid – dürfte auf lange Sicht kein Weg vorbeiführen.
DigitalisierungNutzung des Cloud-Computing wird zunehmen.
Doch wo stehen Mittelständler im digitalen Transformationspro-
zess, wenn es um Cloud-Computing geht und welche Erfahrungen
haben sie bisher gemacht? Was sind die treibenden Gründe für
die Cloud-Nutzung und was sind die möglichen Hindernisse? Auch
hierauf gibt unsere Befragung Antworten.
Der Anteil der Unternehmen, die Cloud-Computing bereits nutzen
liegt bei 57 %, weitere 12 % wollen es in absehbarer Zeit tun.
Als Bereitstellungsart nutzen Mittelständler, die bereits in der
Cloud operieren, überwiegend die Private Cloud (57 %), gefolgt von
der Public Cloud (21 %). Die Private Cloud ist eine Cloud-Umgebung,
die ausschließlich für eine Organisation betrieben wird. Das Hos-
ten und Verwalten der Cloud-Plattform kann intern (beispielsweise
durch firmeneigene Rechenzentren), aber auch durch Dritte erfol-
gen. Im Gegensatz dazu bietet die Public Cloud Zugang zu abstra-
hierten IT-Infrastrukturen für die breite Öffentlichkeit
57% der Unternehmen nutzen bereits
Cloud-Computing oder wollen es
in absehbarer Zeit tun.
09
IaaS und SaaS sind die beliebtesten Cloud-Services.
Offensichtlich entdeckt der Mittelstand die Vorteile von Cloud-Computing und findet
Gefallen an den unterschiedlichen Servicemodellen. So benutzen 57 % der befragten
Unternehmen SaaS (Software as a Service) und 60 % beziehen IaaS (Infrastructure as
a Service)-Cloud-Dienste. Darüber hinaus werden PaaS (Platform as a Service) und
BPaaS (Business Process as a Service = Outsourcing von Geschäftsprozessen in eine
Cloud) gerne genutzt.
»Auf welcher Ebene nutzt Ihr
Unternehmen Cloud-Computing?«
60 57 25
%
23
%
11
%
% %
Weiß nicht /
IaaS SaaS PaaS BPaaS keine Angabe
Digitalisierung
Prozentualer Anteil der Nennungen der jeweiligen Kategorie (Mehrfachnennungen möglich)
Quelle: LBBW ResearchErgebnisse Mittelstandsradar
»Was sind die Gründe für die Cloud-Nutzung?«
Prozentualer Anteil der Nennungen der jeweiligen Kategorie (Mehrfachnennungen möglich)
Ortsunabhängigkeit (Mobiles Arbeiten)
Niedrige Investitionskosten
Skalierbarkeit von Cloud-Computing-Kapazitäten
Konzentration auf Kernkompetenzen
Rasche Umsetzung (kürzere Time-to-Market)
Pay-per-Use (Bezahlung nur für genutzte Leistung)
Benutzerfreundlichkeit
Andere
Weiß nicht / keine Angabe
70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
Quelle: LBBW Research
10
Ortsunabhängigkeit dominiert die Gründe Den deutschen Mittelständlern ist der Standort
für die Cloud-Nutzung. des Cloud-Rechenzentrums äußerst wichtig. Die
Unternehmen mit Cloud bevorzugen eindeutig
Die wesentlichen Treiber der Cloud-Nutzung – eine deutsche Cloud (rund 83 %). An zweiter Stelle
welche im weitesten Sinne auch als Vorteile oder steht alternativ die Möglichkeit einer Cloud in-
Chancen zu verstehen sind – sind vornehmlich nerhalb der EU. Ein Drittland als Cloud-Standort
die Ortsunabhängigkeit, welche mobiles Arbei- kommt für die meisten nicht infrage.
ten ermöglicht, sowie niedrige Investitionskos
ten und die Skalierbarkeit von Cloud-Computing- Für Unternehmen, die noch keine Cloud nutzen,
Kapazitäten. kommt ebenfalls hauptsächlich nur Deutschland
als Standort infrage, gefolgt von der restlichen EU.
Bei denjenigen Unternehmen, die eine geplante
Cloud-Nutzung avisieren, wurden ebenfalls die Festzuhalten ist, dass die digitale Transformation
Chancen im Hinblick auf Ortsunabhängigkeit und und vor allem der Bereich Cloud-Computing kein
Skalierbarkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit vorübergehender Trend ist. Auf lange Sicht kann
als Gründe zur Einführung genannt. Cloud-Computing eine Notwendigkeit darstellen,
um frühzeitig einen Wettbewerbsvorteil aufzu-
Doch die Einstellung zu Cloud-Computing erfährt bauen und um das eigene Unternehmen auf ei-
auch eine bestimmte Zurückhaltung bei den Un- ner wettbewerbsfähigen Marktposition zu halten.
ternehmen. Die Bedenken zu möglichen Nach- Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass
teilen oder Risiken kreisen um das Thema Ab- Cloud-Computing mehr und mehr fester Bestand-
hängigkeit von Fremdfirmen (z. B. Abgabe der teil der Unternehmensstrategie werden wird und
Datenhoheit, Störanfälligkeit). Aber auch die Si- sich der deutsche Mittelstand auf einem guten
cherheit der Unternehmensdaten, welche mögli- Weg in die Cloud befindet.
cherweise nicht ausreichend gewährleistet wer-
den könnte, bereitet den Unternehmen Sorgen,
wenn es um die Cloud-Einführung geht.
Digitalisierung01.3 | Portalnutzung inmitten
Ergebnisse Mittelstandsradar
digitaler Ökosysteme ist im Kommen.
Einhergehend mit diversen Cloud-Anwendungen findet auch die Nutzung von Unterneh-
mens- und Firmenportalen immer mehr Akzeptanz bei den Mittelständlern.
Fast drei Viertel der befragten Unternehmen nutzt Jedoch verwenden nur rund 19 % der befragten
bereits Portallösungen und immerhin 42 % der Un- Unternehmen bereits die digitale Signatur. Die-
ternehmen, die bisher noch keine Portallösungen se Unternehmen nutzen die digitale Signatur für
verwenden, planen dies in den nächsten drei Jah- interne Freigaben, Entscheidungsvorlagen und
ren zu tun. Genehmigungen sowie für externe Verträge mit
Kunden und Lieferanten in gleichem Maße.
Vor allem die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
gehört für Unternehmen zu den Basisfunktiona Rund 81 % der Unternehmen verwenden bisher
litäten. Darüber hinaus wird neben einem Kom- keine digitale Signatur. Als Hauptgrund wird mehr
munikationskanal (elektronisches Postfach, Doku- heitlich die fehlende Akzeptanz der digitalen Sig
ment-Sharing/-Signing) auch die Möglichkeit zum natur genannt. An zweiter Stelle steht die Res-
Mitarbeiter-Onboarding und der Rechteverwal- sourcenknappheit (Personal, Budget, Expertise)
tung von vielen Nutzern geschätzt. Unternehmen, innerhalb des Unternehmens. Aber auch die feh-
die hingegen mit dem Gedanken spielen, Portallö- lende Basisinfrastruktur (Dokumentationsmanage-
sungen zu nutzen, würden dies hauptsächlich aus mentsystem/elektronische Akte) wiegt schwer,
Gründen der elektronischen Kommunikation tun. wenn es um die Nutzung der digitalen Signatur geht.
Die Mehrheit der Unternehmen präferiert dabei Somit dürfte für Mittelständler in Zukunft noch
eine konsolidierte Plattformlösung mit einem viel Nachholbedarf bestehen, wenn sie sich als
Single Sign-On (Einmalanmeldung), um alle Ein- Teil eines digitalen Ökosystems mit ihren Zulie-
zellösungen anzusteuern. ferern, Kunden und Finanzierungspartnern ver-
netzen möchten. Dabei ist die Einführung der
11
digitalen Signatur oftmals komplex und kann ent-
sprechend Zeit benötigen. Daher gilt es abzuwä-
gen, ob sich die Einführung, vor dem Hintergrund
der entstehenden Aufwendungen und der Anzahl
der in Zukunft abzuschließenden Rechtsgeschäfte,
lohnt.
Im Bereich des Zahlungsverkehrs nutzen immer-
hin 80 % der Unternehmen bereits digitale Au-
thentifizierungsmethoden zum Log-In und zur
Zahlungsfreigabe. Die meistverwendete Authen-
Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die tifizierungsmethode für den Log-In ist dabei die
meisten Unternehmen bevorzugen würden, ihre Desktop-Datei, also ein Token (beispielsweise für
Mitarbeiter eigenständig für die Portallösungen Windows-PC), gefolgt von der mobilen App auf
freizuschalten. Nur ein Drittel der Unterneh- dem Smartphone.
men bevorzugt die Variante einer Freischaltung
der Mitarbeiter durch einen Administrator des Zusammenfassend zeigt sich, dass im deutschen
Portalanbieters. Mittelstand die Akzeptanz und Adaption von
Portallösungen durchaus schon gegeben ist. Die
Die Digitalisierung sollte jedoch auch in ande- Unternehmen dürften auch in Zukunft mehr Ge-
ren Bereichen der Unternehmen Einzug halten. fallen daran finden und die Notwendigkeit er-
In Unternehmen jeglicher Größenklassen wird kennen, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre
die digitale Barrierefreiheit stetig wichtiger und digitalen Ökosysteme gegenüber Stakeholdern
es zeigen sich die Vorteile digitalisierter Prozes- zu öffnen – wie es bei Firmenportalen, Zahlungs-
se und Systeme im Vergleich zu ihren veralteten verkehrslösungen und digitalen Signaturen der
analogen Pendants. Fall ist. Die Verankerung solcher strategischen
Entwicklungen sollte daher unbedingt in eine IT-
Digitalisierung
So auch in der Verwendung digitaler Signaturen als bzw. Digitalisierungsstrategie einfließen, damit
die wohl sicherste Variante elektronischer Unter- im Wettbewerb um die knappen finanziellen Res-
schriften, ohne dabei auf Rechtssicherheit ver- sourcen die Investitionen in die digitale Transfor-
zichten zu müssen. mation nicht vernachlässigt werden.01.4 | Untersuchungsdesign
Ergebnisse Mittelstandsradar
Die Ergebnisse der Impuls-Befragung basieren auf den Antwor-
ten von 123 Unternehmen. Die Online-Umfrage wurde durch das
LBBW Research durchgeführt und erstreckt sich über einen Zeit-
raum vom 10. März bis 10. April 2020. Somit fiel die Feldzeit
direkt in die Lockdown-Eskalation der Corona-Krise.
Die befragten Unternehmen stammen aus dem Kundenkreis der
LBBW, der regionale Schwerpunkt liegt somit auf Baden-Würt-
temberg. Berücksichtigt wurden mittelständische Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von mindestens 15 Mio. EUR.
Verteilung nach Umsatz:
1,8 % 2,7 %
8,1 % 27,0 % 0 – 15 Mio. EUR
16 – 50 Mio. EUR
51 – 100 Mio. EUR
16,2 %
101 – 250 Mio. EUR
251 – 500 Mio. EUR
501 Mio. – 2 Mrd. EUR
24,3 %
12
19,8 % > 2 Mrd. EUR
Quelle: LBBW Research
Verteilung nach Branche:
36,0 %
Produzierendes Gewerbe
Dienstleistungsbereich
64,0 %
Quelle: LBBW Research
Digitalisierung02 Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen im Mittelstand.
02
Ergebnisse Mittelstandsradar
Volkswirtschaftliche
Rahmenbedingungen
im Mittelstand.
02.1 | Schwerste Rezession seit der
Weltwirtschaftskrise erwartet.
Die konjunkturellen Herausforderungen in gen, dass das globale Wirtschaftswachstum suk-
der jetzigen Lage sind hoch, doch die volks- zessive wieder anspringen kann, sobald die Aus-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im breitung des Coronavirus unter Kontrolle ist.
Mittelstand trübten sich bereits seit gerau-
14
Auch wenn der Weg aus dem Stillstand bereits be-
mer Zeit ein. gonnen hat, werden die Eindämmungsmaßnahmen
einen drastischen Konjunktureinbruch im Jahr
Das Verarbeitende Gewerbe befindet sich seit dem 2020 provozieren. Für den Euroraum gehen wir
Sommer 2018 in einer Rezession und die Konjunk- nunmehr von einer BIP-Schrumpfung von 7,5 %
tur in Deutschland blieb im letzten Jahr schwach. aus, für Deutschland erwarten wir ebenfalls – 7 %.
Auch die US-Wirtschaft dürfte einer Rezession im
Noch bis vor kurzem standen die Zeichen für laufenden Jahr nicht entkommen (Prognose: – 7 %).
die deutsche Konjunktur auf »Bodenbildung«,
da das Konjunkturtal zum Jahresende 2019
scheinbar erreicht war. Nach den teils schlech- »Ein drastischer
ten Zahlen 2019 waren sowohl ein Anstieg des
ifo-Geschäftsklimaindex als auch ein leicht ver- Konjunktureinbruch ist
bessertes BIP-Wachstum im dritten und vierten
Quartal 2019 zu verzeichnen. Das preisberei-
zu befürchten.«
nigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg 2019 um
0,6 % im Vergleich zum Vorjahr.
Doch spätestens mit dem Auftreten und der Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in vielen
Regionen der Welt flammten die Rezessions-
und Krisenängste der Vergangenheit wieder
Volkswirtschaftlicher Rahmen
auf. Die eingeleiteten Quarantäne-, Schutz- und Mithin dürften die konjunkturellen Erschütterun-
Sicherheitsmaßnahmen im ersten Quartal 2020 gen für alle großen Industriestaaten das Ausmaß
und die damit einhergehenden Unterbrechun- der Finanz- und Wirtschaftskrise übersteigen,
gen globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten sodass unseres Erachtens auch die Weltwirtschaft
sowie Zulieferengpässe und Produktionsstill- mit einem BIP-Rückgang von 2,8 % insgesamt vor
stände haben zu schwerwiegenden wirtschaft- einer schweren Rezession steht. Der Internatio-
lichen Auswirkungen geführt. Die zahlreichen nale Währungsfonds (IWF) erwartet sogar die
weltweit ergriffenen geld- und fiskalpolitischen schlimmste ökonomische Krise seit der Weltwirt-
Stimulierungsmaßnahmen dürften dazu beitra- schaftskrise der Zwanziger- und Dreißigerjahre.02.2 | LBBW Mittelstandsampel leidet unter
Ergebnisse Mittelstandsradar
ungünstigen Nachfragebedingungen.
Für Deutschland lassen sich die ersten Anzeichen der Auswirkungen
44
auf die Rahmenbedingungen des Mittelstands exemplarisch an der
LBBW Mittelstandsampel ablesen, welche die Unterfaktoren Nach-
frage, Kosten und Finanzierung zu einem Indikator aggregiert und
auf einer Skala von 0 bis 100 darstellt. Die LBBW Mittelstandsam-
pel sank im vergangenen Jahr bis auf 44 Punkte im Dezember,
was dem niedrigsten Stand seit Februar 2017 entspricht. Ein In- Punkte.
dikatorwert unter 40 signalisiert eine Belastung des Mittelstands.
Derzeit schwingt die Ampel um das 50-Punkte-Niveau. Werte in Niedrigster Stand
der Bandbreite von 40 bis 60 können mit vergleichsweise neu- seit Februar 2017.
tralen Rahmenbedingungen gleichgesetzt werden, während Werte
größer als 60 positive Rahmenbedingungen signalisieren. Ein de-
taillierter Blick auf die Unterfaktoren liefert mehr Aufschlüsse über
die bisherige Marktlage.
LBBW Mittelstandsampel.
90
80
15
70
60
50
40
30
20
10
0
Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
LBBW Mittelstandsampel Kostenkomponente
Nachfragekomponente Finanzierungskomponente
Volkswirtschaftlicher Rahmen
Quelle: LBBW ResearchErgebnisse Mittelstandsradar
Nachfrageausfall kann zeitlich nicht wieder eingeholt werden.
Seit Beginn 2019 schwächte sich die Konjunktur in der Industrie
zunehmend ab, die Nachfragekomponente trübte sich fast monat-
lich weiter ein. Erst zum Jahresende 2019 stabilisierte sich die
Nachfrage dann wieder und zog zu Jahresbeginn 2020 etwas an.
Mit Beginn der Pandemie dürften die vom Coronavirus stark be-
troffene Volkswirtschaften auf absehbare Zeit ihre Nachfrage nach
deutschen Vorprodukten, Investitions- und Konsumgütern reduzie-
ren. Dies trifft Deutschland aufgrund der Wirtschaftsstruktur und
internationalen Verflechtung besonders, da die Exporte 47 % des
deutschen BIP ausmachen. Hinzu kommt der Rückgang des sozia-
len Konsums durch die eingeleiteten Quarantäne- und Sicherheits-
maßnahmen. Somit kommt es zu Ausfällen bei Restaurant-, Kino-,
Theater- und Messebesuchen. Ebenso wird der Inlandstourismus Kaufkraft stark in
samt Passagierluftfahrt, Hotelaufenthalten und Einkaufstätigkeiten Mitleidenschaft gezogen.
drastisch zurückgefahren. Dieser Nachfrageausfall kann zeitlich
nicht wieder eingeholt werden.
Zusätzlich werden verunsicherte Konsumenten größere und kapi-
talintensivere Anschaffungen aufschieben oder gar vor dem Kauf
langlebiger Konsumgüter zurückschrecken. Hierbei sind mögliche
Nachholeffekte nur zu erwarten, wenn kein permanenter Einkom-
mensverlust durch die Corona-Krise zu befürchten ist und die wirt-
schaftlichen Belastungen des exogenen Corona-Schocks wieder
abklingen. Jedoch dürfte die Kaufkraft in Zeiten von Kurzarbeit
und/oder drohender Arbeitslosigkeit stark in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Hinzu kommt die tendenziell höhere Sparquote in
Krisenzeiten, welche die Nachfrage ebenfalls einschränkt.
16
Eintrübung der Wirtschaftsaussichten durch den Nachfrage-
schock.
Im Gegensatz zur Nachfrage hellten sich vor allem die Kostenbe-
dingungen in ihrer Tendenz seit Juni 2018 auf. Das derzeit güns-
tige Niveau (günstiger Bereich: > 60) ist jedoch auf den exogenen
Schock der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Eintrübung der
Wirtschaftsaussichten durch den Nachfrageschock sowie ein sich
entwickelnder realwirtschaftlicher Angebotsschock (verursacht
durch niedrige Lagerbestände, Störung der Infrastruktur und Lo-
gistikketten, Ausfall von Beschäftigten, Stillstand im Produktions-
prozess etc.) hat die Nachfrage und damit die Preise für Rohöl,
Basismetalle und Energie in jüngster Vergangenheit stark fallen
lassen. Die rückläufigen Notierungen wirken zwar positiv auf die
Kostenampel, jedoch müssen diese immer im gesamtwirtschaft Realwirtschaftlicher
lichen Kontext betrachtet werden. Angebotsschock lässt
Nachfrage fallen.
Finanzierungsbedingungen nach wie vor zwischen neutralem
und günstigem Terrain.
Volkswirtschaftlicher Rahmen
Die Finanzierungsbedingungen oszillieren seit einem Jahr stark
im neutralen und günstigen Terrain. Dabei steht das Niedrig- und
Negativzinsumfeld sowie die expansive Geldpolitik und die zeit-
weise lockeren Kreditvergaberichtlinien der deutschen Banken im
Spannungsverhältnis zu temporär sehr hohen Marktvolatilitäten,
straffen Kreditvergaberichtlinien, steigender Entmutigung bei der
Aufnahme eines Bankkredits sowie abnehmender Dynamik bei der
Mittelverwendung im Hinblick auf Anlageinvestitionen.02.3 | Auf die gescheiterte Bodenbildung folgt der Kollaps.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Die Handelskonflikte, das Brexit-Chaos und die schwächere Weltkonjunktur haben die ex-
portabhängige deutsche Industrie deutlich belastet und zuletzt in die Rezession gedrückt.
Ein holpriger Jahresstart mit geopolitischen Un- über 22 Jahren. Erst ab 50 Punkten wird Wachs-
sicherheiten hielt unseren Blick auf eine belast- tum signalisiert. Die Teilindikatoren für Dienst-
bare Verfestigung der Konjunkturfrühindikatoren leister und Industrie fielen hierbei drastisch. Beim
gerichtet. Die Frühindikatoren schienen vor dem Service-Sektor ging es auf ein Rekordtief von 15,9
Ausbruch der Coronavirus-Krise eine Bodenbil- (März: 31,7) Punkten bergab und im Verarbeiten-
dung zu versuchen und stabilisierten sich allmäh- den Gewerbe auf 34,4 (März: 45,4) Punkte – das
lich. Jedoch war das Gesamtbild noch zu fragil ist der tiefste Wert seit über elf Jahren.
und störanfällig. Ab März schlug die Corona-Kri-
se auf die viel beachteten Konjunkturindikatoren Die Corona-Krise drückt darüber hinaus die
ein und drückte sie zu Boden. Die Welle schlech- Stimmung in den deutschen Chefetagen auf ein
ter Indikatoren-Daten rollte auch im April mit un- historisches Tief und lässt die Hoffnung auf eine
verminderter Wucht weiter und zeigte die vollen rasche Wirtschaftserholung schwinden. Die ka-
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der tastrophale Stimmung unter den deutschen Un-
damit verbundenen Beschränkungen, Ausgangs- ternehmen spiegelt sich im ifo-Geschäftsklima
sperren, globalen Nachfragerückgänge sowie Eng- index für April wider. Der Index fiel auf 74,3 von
pässe bei Personal und Produktionsmaterialien 85,9 Punkten im März. Dies ist der niedrigste je-
auf die deutsche Wirtschaft. mals gemessene Wert. Im Verarbeitenden Gewer-
be ist der Geschäftsklimaindex auf den niedrigs-
Der deutsche Einkaufsmanagerindex (IHS Markit/ ten Wert seit März 2009 gefallen (– 44,4 Punkte).
BME-Einkaufsmanagerindex), der Industrie und Die Dienstleister beurteilten ihre Lage so schlecht
Dienstleister zusammenfasst, fiel im April von wie nie zuvor (– 12,7 Punkte) und auch bei den
35 Punkten auf 17,1 Punkte und damit auf den Erwartungen herrscht beispielloser Pessimismus
tiefsten Wert seit Beginn der Datenerhebung vor (– 53,3 Punkte).
17
Frühindikatoren auf Talfahrt.
65 110
105
60
100
55 95
90
50
85
45
80
40 75
70
35
65
30 60
Volkswirtschaftlicher Rahmen
Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Einkaufsmanagerindex, Deutschland (linke Achse) ifo-Geschäftsklimaindex,
(Verarbeitendes Gewerbe) Deutschland (rechte Achse)
Quellen: Refinitiv, LBBW ResearchGfK-Konsumklimaindex, ZEW Konjunkturerwartung
Ergebnisse Mittelstandsradar
und Sentix-Konjunkturindex.
12
50
10
30
8
10
6
- 10 4
- 30 2
- 50 0
Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sentix-Konjunkturindex, Eurozone (linke Achse) GfK-Konsumklimaindikator, Deutschland (rechte Achse)
Quellen: Refinitiv, LBBW Research
Verunsicherung unter den Konsumenten ist derzeit riesig.
Das GfK-Konsumklima für Deutschland ist für Mai zwei Aprilwochen stattfand, spürten die Men-
auf einen historischen Tiefstand von – 23,4 abge- schen in Deutschland bereits das volle Ausmaß
stürzt – von 2,7 Punkten für April, dem bis dato der Eindämmungsmaßnahmen, wie Schul- und
niedrigsten Wert seit Mai 2009, als der Index Geschäftsschließungen, Produktionsstilllegungen
nach der Finanzkrise bei 2,6 Punkten lag. Wäh- sowie Ausgangsbeschränkungen. Die Konjunktur-
18
rend der Lebensmitteleinzelhandel im Februar erwartungen sind dadurch stark gesunken und
und März aufgrund von Hamsterkäufen vorüber- Verbraucher befürchten eine Rezession. Die Ver-
gehend hohe Umsatzzuwächse verzeichnete, sind unsicherung bei der Beschäftigungslage schlägt
bzw. waren weite Teile des Non-Food-Handels sich in einem Einbruch der Einkommenserwar-
von Geschäftsschließungen direkt betroffen. Still- tung nieder. Das hat auch Auswirkungen auf die
gelegte Produktion und geschlossene Geschäfte Anschaffungsneigung, die ebenfalls fällt. Beide
bzw. Gastronomiebetriebe haben die Wirtschafts Komponenten sind von zuvor noch eher hohen
tätigkeit in vielen Bereichen fast zum Stillstand Niveaus sehr deutlich eingebrochen.
gebracht. Da die GfK-Erhebung in den ersten
GfK: Erwartungen zu Einkommen, Anschaffung und Konjunktur.
65
45
25
5
Volkswirtschaftlicher Rahmen
- 15
- 35
00
5
00
6
00
7
00
8
00
9
01
0
01
1
01
2 13 01
4
01
5
01
6
01
7
01
8
01
9
02
0
r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 20 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2 r. 2
Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap
Anschaffungsneigung Einkommenserwartung Konjunkturerwartung
Quellen: Refinitiv, LBBW Research02.4 | Unsicherheiten erschweren die Planung.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Die bereits bestehenden Makro-Risiken und Belastungsfaktoren – Handelskonflikte, kon-
junkturelle Schwäche und Strukturwandel in diversen Branchen – in Kombination mit den
durch die Corona-Krise eintretenden Nachfrage- und Angebotsschocks verstärken für den
Mittelstand die Planungs- und Absatzunsicherheiten weiter.
Mit Ausbruch des Virus in China und der dorti- dass die deutsche Industrie zu Jahresbeginn auf
gen Produktionsunterbrechung hatten die deut- Erholungskurs war. Der Auftragseingang lag im
schen produzierenden Unternehmen einen An- Februar 2020 saison- und kalenderbereinigt 1,9 %
gebotsschock zu verkraften. Somit konnte trotz höher als im Vorjahresmonat und markiert damit
Nachfrage nicht produziert werden, woraus ein das erste positive Wachstum seit Juli 2018.
Angebotsrückgang resultierte. Mit der Corona-
virus-Ausbreitung und der weitgehenden Still- Doch der Tragödie erster Teil begann im März:
legung des öffentlichen Lebens wurde dieser Aufgrund der Corona-Krise brach das Neugeschäft
Angebotsschock durch einen Nachfrageschock der deutschen Industrie in einem nie dagewese-
überlagert, sodass die Nachfrage nicht mehr nen Tempo weg. Diese sammelte im März rund
wirksam werden konnte. Damit wurde entweder 16 % weniger Aufträge ein als im Vorjahresmonat.
die Dienstleistung nicht mehr notwendig oder Auch ein Unterschied zwischen In- und Ausland
die Produktion eingestellt. ist bei den Auftragseingängen nicht mehr erkenn-
bar. Trotz der Annahme, dass – ohne erneutes Auf-
Die weltweiten Handelskonflikte seit 2018 sowie flammen der Pandemie – weitere Lockerungen
die globalen Quarantänemaßnahmen, Unterbre- stattfinden, ist eine Besserung vor den Mai-Zahlen
chungen von Lieferketten und mögliche Produk- (Veröffentlichung im Juli) nicht zu erwarten.
tionsausfälle schlagen sich in den Auftragsbü-
chern der deutschen Industrie nieder und geben Für einigermaßen belastbare Investitionspläne
bisher keine Hoffnung auf eine schnelle Wieder- sowie zukünftige Investitionsentscheidungen
belebung. Dabei hatte die Corona-Pandemie im müsste sich die Stimmungslage in der Industrie
19
Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf erst festigen, was durch eine spürbare Orderbe-
die Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe in lebung signalisiert werden könnte. Derzeit sind
Deutschland. Die guten Februar-Zahlen zeigen, die Auftragseingänge jedoch noch zu labil.
Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe.
Veränderung Y – Y, kalender- und saisonbereinigt Insgesamt Inland Ausland
15 %
10 %
5%
0%
-5%
- 10 %
Volkswirtschaftlicher Rahmen
- 15 %
- 20 %
März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez.
2015 2016 2017 2018 2019
Quellen: Destatis, LBBW Research03 Stimmung im Mittelstand.
03
Ergebnisse Mittelstandsradar
Stimmung
im Mittelstand.
03.1 | Extreme Stimmungsdivergenzen im Mittelstand.
Brexit-Verhandlungen, Handelskriege, Deadlines, Zölle und
Vergeltungszölle, Wirtschaftssanktionen sowie weltweite
Demonstrationen und Protestbewegungen sorgten 2019 für
ein Jahr voller geopolitischer Unsicherheiten und Risiken.
Die Stimmungsachterbahnfahrt verlief dabei zwischen Konjunk-
tursorgen über eine mögliche Rezession und Entspannungssigna-
21
len mit Hoffnung auf eine baldige Erholung. Doch dann sorgte der
2020«
Beginn der Coronavirus-Pandemie in der ersten Jahreshälfte für
eine noch größere Verunsicherung. Die existenzbedrohenden Um-
stände trafen die Unternehmen hart, und letztendlich wurde so-
»
gar das öffentliche und wirtschaftliche Leben komplett beeinflusst. Existenzbedrohende Umstände.
In der Retroperspektive waren sich die Mittelständler (max. 500
Beschäftigte und max. 50 Mio. EUR Jahresumsatz) über die Rich-
tung der Konjunktur uneinig. Das Geschäftsklima sowie die Lage-
beurteilung und die Erwartungen des Mittelstands lagen im histo-
rischen Verlauf stets dicht beieinander. Dabei ist das von der KfW
ermittelte Geschäftsklima als ein Mittelwert von Lage und Erwar-
tung zu betrachten.
Zum Jahresanfang 2017 begann eine leichte Stimmungsdivergenz
im Mittelstand einzusetzen, also eine steigende Differenz zwischen
Lage und Erwartung. Diese Divergenz erreichte im März 2019
vor dem Hintergrund des Brexit-Dilemmas ihren Höhepunkt und
befand sich fast auf dem Niveau von Oktober/November 2009.
Der Unterschied lag 2009 jedoch darin, dass die Lage eindeutig
schlechter war als die Erwartung.
Im vergangenen Jahr war jedoch die wahrgenommene Lage der
mittelständischen Unternehmen positiver als deren Annahmen für Erwartung Lage
die Zukunft. Zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 dominier-
te weiterhin ein hoher Unterschied zwischen Lage und Erwartung, Hoher Unterschied zwischen
und der Klimaindikator schaffte es nicht, aus dem engen Korridor Erwartung und aktueller Lage.
rund um die 50-Punkte-Marke, die das historische Durchschnitts-
Stimmung
niveau und damit das konjunkturelle Niemandsland markiert, nach
oben auszubrechen.Ergebnisse Mittelstandsradar
Stimmung im Mittelstand. Die 50-Punkte-Linie markiert den »konjunkturneutralen« lang
fristigen Durchschnitt seit Januar 2005. Indikator-Werte größer/
Dreimonatiger Mittelwert, auf 100 normiert kleiner als 50 weisen auf eine überdurchschnittliche (bzw. positi-
ve)/unterdurchschnittliche (bzw. negative) Konjunktursituation hin.
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r.
Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Geschäftsklima Geschäftslage Geschäftserwartungen
Quellen: KfW, LBBW Research
22
Konjunkturelle Verunsicherung noch nicht vorbei.
Seit 2017 kann die Geschäftsklima-Verschlechterung vorwiegend
auf pessimistische Erwartungen zurückgeführt werden, welche
sich zunehmend eintrübten. Im vergangenen Jahr verschlechterte
sich dann auch die Lageeinschätzung immer stärker. Im März des
laufenden Jahres folgte dann der große Paukenschlag und die Er-
wartungen fielen ins Bodenlose. Gleichzeitig herrschte bei der Ge-
schäftslage in der Dreimonatsbetrachtung noch ein sich stabilisie-
render Trend vor, bevor (ebenfalls im März) ein rapider Absturz
folgte. Ein Großteil der März-Daten wurde jedoch vor den schärfs-
ten Eindämmungsmaßnahmen und dem nationalen »Lockdown«
in Form des bundesweiten Kontaktverbots (22. März) erhoben. Im
April zeigten sich dann die vollen Auswirkungen auf die Geschäfts-
erwartungen und -lage. Wie in der Betrachtung des Dreimonats-
durchschnitts zu erkennen ist, befindet sich die Geschäftserwar- Geschäftserwartung
tung aktuell auf dem Niveau der Finanzkrise zwischen Ende 2008 auf Niveau der globalen
und Anfang 2009. Somit blickt der Mittelstand sehr pessimistisch Finanzkrise 2008/2009.
in die Zukunft. Im Gegensatz dazu hält sich die Geschäftslage trotz
des beispiellosen Absturzes über ihrem Tiefstand während der Fi-
nanzkrise. Dies dürfte für eine relativ solide Verfassung der Mittel-
ständler sprechen. Somit könnte der Mittelstand am Tiefpunkt des
Corona-Tals angekommen sein. In der Gesamtbetrachtung ist die
konjunkturelle Hängepartie jedoch noch nicht vorüber.
Ein tieferer Blick in das Geschäftsklima der Mittelständler verdeut-
licht eine weitere und außergewöhnliche Entkopplung: Mit Jahres-
beginn 2019 divergierte das Geschäftsklima in zwei Wirtschaftsbe-
Stimmung
reichen enorm. Das Klima im Verarbeitenden Gewerbe entkoppelte
sich dramatisch vom Klima im Bereich der Dienstleistungen und
der Unterschied vergrößerte sich monatlich. Dabei schien der Ab-Ergebnisse Mittelstandsradar
schwung im Verarbeitenden Gewerbe in dieser Zeit grenzenlos –
bis sich der Indikator im Februar 2020 bei 44,4 Punkten stabili
sierte. Das Dienstleistungsgewerbe dagegen konnte sich diesem
Abwärtssog entziehen und markierte bei 51,4 Punkten. Dies än-
derte sich jedoch radikal, als die Eindämmungsmaßnahmen zur
Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung das öffentliche Le-
ben zum Stillstand brachten. Kleine und mittlere Einzelhändler
sowie Dienstleistungsunternehmen, welche bisher von einer so-
liden Binnennachfrage profitierten, wurden von den Einschränkun-
gen besonders stark getroffen. Durch den Absturz im März und
April schloss sich gezwungenermaßen die Geschäftsklima-Diver-
genz und beide Wirtschaftsbereiche notieren in der Betrachtung
der Dreimonatsdurchschnitte bei 37,3 Punkten.
Eine Reihe von konjunkturellen Frühindikatoren deuteten zu Jahres- Stabilisierung und
beginn darauf hin, dass eine makroökonomische Bodenbildung in Aufhellung des
greifbarer Nähe gewesen war, die sich bereits gegen Ende des ver- Geschäftsklimas
gangenen Jahres abzeichnete. Mit der Abnahme der Unsicherheiten infolge einer
im Hinblick auf das Coronavirus und einer Zunahme der Zuversicht Normalisierung
für die Konjunktur nach einem Exit aus dem Lockdown bzw. Shut- in Aussicht.
down, könnte sich das generelle Geschäftsklima der Mittelständler
infolge einer Normalisierung wieder stabilisieren und aufhellen. Ob
die nächste Runde der Frühindikatoren aus der gewerblichen Wirt-
schaft wieder steigende Werte bringen wird und die Stimmungs-
divergenzen der Vergangenheit angehören, kann derzeit vermu-
tet, aber noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Hoffnung
macht der Sachverhalt, dass sich die Frühindikatoren analog der
Ausbreitung und Stärke des Coronavirus entwickeln: Zuerst Chi-
na, dann Europa und USA. Die Konjunkturindizes in Europa und
Deutschland sind bereits zwei Monate in Folge stark gefallen. Für
23
die kommenden Werte wäre so mit eine erste Stabilisierung zu er-
warten.
Geschäftsklima der KMU. Die 50-Punkte-Linie markiert den »konjunkturneutralen« lang
fristigen Durchschnitt seit Januar 2005. Indikator-Werte größer/
Dreimonatiger Mittelwert, auf 100 normiert kleiner als 50 weisen auf eine überdurchschnittliche (bzw. positi-
ve)/unterdurchschnittliche (bzw. negative) Konjunktursituation hin.
60
50
40
30
20
r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r.
Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dienstleistungen Verarbeitendes Gewerbe
Stimmung
Quellen: KfW, LBBW Research03.2 | Hoffnungslose Exporterwartungen
Ergebnisse Mittelstandsradar
im Verarbeitenden Gewerbe.
Seit 2018 wird die konjunkturelle Entwicklung im Euro-
raum durch die Eintrübung der Exportnachfrage belastet.
In Deutschland entwickelten sich die Ausfuhren bereits 2018
schwunglos und im vergangenen Jahr gab es einige Rücksetzer.
Letztendlich hat der Außenhandel den Aufschwung im vorigen
Jahr gebremst. Die Exporte wuchsen 2019 nur noch um 0,9 % und
damit weniger als halb so stark wie 2018. Dies war vor allem auf
den Handelskonflikt zwischen USA und China, den Brexit und die
daraus resultierenden politischen Unsicherheiten zurückzuführen.
11,7%
Das Wachstum der deutschen Wirtschaft wurde zuletzt von binnen-
wirtschaftlich orientierten Branchen getragen, während die export-
orientierte Industrie schwächelte. Dabei gehört vor allem der Ex-
port zur DNA des deutschen Mittelstands. Solange dieser nicht flo-
riert, brummt der Mittelstandsmotor nicht wie gewohnt. Mit Blick Ausfuhr-Rückgang im März.
auf die Entwicklung in der deutschen Industrie kamen Anfang 2020
etwas Rückenwind und positive Impulse aus dem Ausland, wie ein
Anstieg der Exporte im Februar nahelegte. Doch diese Erholung
wurde von den Corona-Folgen vereitelt. Die deutschen Exporte
brachen aufgrund der Corona-Krise so drastisch ein wie seit min-
destens 30 Jahren nicht mehr. Die Ausfuhren sanken im März um
11,7 % zum Vorjahresmonat. Auch im April dürfte die Corona-Krise
einen massiven Einbruch der Exporte zur Folge gehabt haben. Der
Abschwung in der exportorientierten Industrie wird sich höchst-
24
wahrscheinlich in diesem Jahr weiter fortsetzen.
Deutsche Exporte. Exporte, in Mrd. EUR
(kalender- und saisonbereinigter Wert) (linke Achse)
Veränderung Exporte Y – Y (rechte Achse)
115 15 %
10 %
110
5%
105 0%
-5%
100
- 10 %
95 - 15 %
März Juli Nov. März Juli Nov. März Juli Nov. März Juli Nov. März
2016 2017 2018 2019 2020
Quellen: Destatis, LBBW Research
StimmungErgebnisse Mittelstandsradar
Exporterwartungen verschlechtern sich stark.
Im Rückblick signalisierten die dreimonatigen Mittelwerte zur Ex-
porterwartung der Mittelständler und Großunternehmen im Verar-
beitenden Gewerbe von September 2019 bis Februar 2020 eine
leichte Erholung. Ab diesem Zeitpunkt nach vorne blickend waren
die Aufhellungstendenzen schon fast hinreichend belastbar, um
bereits von einer positiven Trendwende zu sprechen. Allerdings
befanden sich die Erwartungen noch weit unter der 50-Punkte-
Marke. Mit dem Einbruch der internationalen Nachfrage und Stö-
rung der globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ab März 2020 Großunternehmen im Vergleich
zeigt sich jedoch ein rasanter Rückgang der Exporterwartungen. zum Mittelstand pessimistischer.
Die Großunternehmen sind dabei im Vergleich zum Mittelstand
(wie bei vorherigen Konjunkturschocks) viel pessimistischer, da sie
stark international ausgerichtet und vom Wegbrechen der Absatz-
möglichkeiten sowie vom Fehlen von Vorleistungsgütern unmittel-
bar und schwer betroffen sind.
Exporterwartungen im Die 50-Punkte-Linie markiert den »konjunkturneutralen« lang
fristigen Durchschnitt seit Januar 2005. Indikator-Werte größer/
Verarbeitenden Gewerbe. kleiner als 50 weisen auf eine überdurchschnittliche (bzw. positi-
ve)/unterdurchschnittliche (bzw. negative) Konjunktursituation hin.
Dreimonatiger Mittelwert, auf 100 normiert
60
55
25
50
45
40
35
30
r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r.
Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap Ok Ap
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Großunternehmen KMU
Quellen: KfW, LBBW Research
Für die nächsten Monate sind die entscheidenden Fragen, ob es
gelingt, die Wirtschaftstätigkeit und die Produktion wieder weit-
gehend hochzufahren, ohne dass es durch die Lockerungsmaß-
nahmen wieder zu einem Anstieg der Neuinfizierten-Zahlen
kommt. Davon wird das mittelfristige Wachstumspotenzial so-
wohl der Gesamtwirtschaft als auch der Exporte abhängen. Die
Ansteckungswelle scheint sowohl in Europa als auch in den USA –
wenngleich dort auf anhaltend hohem absoluten Niveau – weiter Hoffnung auf erfolgreiches
Stimmung
abzuebben, sodass die Hoffnung auf ein erfolgreiches Wiederan- Wiederanfahren der
fahren der Wirtschaft in den kommenden Monat wächst. Wirtschaft wächst.03.3 | Handelspartner infizieren heimische Mittelständler.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Die außenwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen verbesserten sich um die Jahres-
wende leicht.
Das erste Teilabkommen zwischen den USA und
EU
China brachte etwas Ruhe in den Handelskonflikt
und mit Beginn Februar ist das Vereinigte König-
reich vertraglich geordnet aus der EU ausgetre-
ten. Doch in diesem Jahr stehen die Verhand-
lungen zu den künftigen britisch-europäischen
Beziehungen bis Ende 2020 an und die USA könn-
ten den handelspolitischen Druck auf die EU ver-
stärken.
Ein Blick unter die Oberfläche zeigt, dass seit Stützend wirkte dabei bisher die Eurozone, die
dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 die deut- wichtigste Region für die deutsche Exportwirt-
schen Exporte in das Vereinigte Königreich merk- schaft, auf die seit fünf Jahren ein durchschnitt-
lich und kontinuierlich gesunken sind. Der Export- licher Anteil von 37 % der Ausfuhren entfällt.
anteil nach Großbritannien lag 2015 noch bei Somit wird der Mittelstand durch die stärke-
7,5 % und schrumpfte bis 2019 auf nur noch 5,9 %. re Fokussierung auf den Binnenmarkt des Euro-
Währenddessen blieb der Anteil der Ausfuhren raums prinzipiell weniger stark von den globalen
in die USA relativ stabil und China wurde immer Entwicklungen getroffen. Das heißt jedoch nicht,
relevanter. Da China – nach den USA und Frank- dass der deutsche Mittelstand gegen das Corona-
reich – das drittwichtigste Zielland für deutsche virus immun ist. Insbesondere das Lahmlegen
Exporte ist (7 % der Ausfuhren), sind die negativen der italienischen, französischen und spanischen
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft auf- Wirtschaft durch die Ausbreitung des Virus dürf-
grund der quarantänebedingten Nachfrageaus- te die deutsche Industrierezession nur noch ver-
26
fälle absehbar. längern.
Anteil der deutschen Exporte in ausgewählte Länder
im Verhältnis zu gesamten deutschen Exporten.
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stimmung
USA UK China
Quellen: Destatis, LBBW ResearchErgebnisse Mittelstandsradar
Anteil der deutschen Importe aus ausgewählten Ländern
im Verhältnis zu gesamten deutschen Importen.
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USA UK China
Quellen: Destatis, LBBW Research
27
China war im vergangenen Jahr – vor den USA und Der Blick nach China zeigt bereits Hoffnungs-
Frankreich – das wichtigste Ursprungsland von signale und ein sukzessives Wiederanfahren der
deutschen Importen (10 % der Einfuhren). Auf- Produktion sowie eine Erholung des Einkaufs-
grund der bisherigen und kommenden Ausfäl- managerindex für das Verarbeitende Gewerbe
le von Zulieferern aus diesen Ländern, welche (Caixin PMI (Verarbeitendes Gewerbe): Februar:
Vorleistungen für die Produktion in Deutschland 40,03; März: 50,1; April: 49,4). Mit einer zeitli-
herstellen, sind die wirtschaftlichen Auswirkun- chen Verzögerung dürften in den kommenden
gen des neuen Coronavirus für Deutschland ge- Monaten Konjunkturhoffnungen auch im Euro-
genwärtig noch schwer abschätzbar. raum und in den USA aufkommen.
10 %
China wichtigstes Ursprungsland von
deutschen Importen (10 % der Einfuhren).
Stimmung03.4 | Welthandel im Rückwärtsgang.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Auf globaler Ebene zeigt sich der wirtschaftliche Shutdown im Baltic Dry Index (BDI), der
die Kosten für Zeitcharter und Reisecharter für vier Schiffsklassen (Capesize, Panamax,
Supramax und Handysize) im Trockenschüttgutverkehr abbildet.
Der BDI gilt als Frühindikator für den Welthandel weiten Warenhandels zu. In der jüngsten Erhebung
und gibt die Transportkosten für das Verschiffen zeichnete sich in diesem Index ein ähnlich düste-
der Hauptfrachtgüter wie Kohle, Eisenerz, Ze- res Bild ab. Die leichte Aufwärtstendenz im Hin-
ment, Kupfer, Kies, Dünger, Kunststoffgranulat blick auf den Containerumschlag der vergange-
und Getreide an. Die Transportkosten hängen nen Monate wurde unterbrochen und der Index
vom zur Verfügung stehenden Frachtraum, von verlor bereits im Dezember an Dynamik. Im Fe-
Hafenkapazitäten, Erntezyklen und Jahreszeiten bruar fiel der Index schlagartig um 7,0 % im Ver-
ab. Da die wirtschaftlichen Aktivitäten in China gleich zum Vorjahresmonat – der stärkste Rück-
aufgrund des Coronavirus ins Stocken geraten gang seit September 2009. Im März kehrten in
sind, spiegelt sich die Verlangsamung des Welt- China die Häfen zum Normalbetrieb zurück, wäh-
handels ebenfalls in diesem Indikator wider. Die- rend in der übrigen Welt Maßnahmen gegen die
ser fiel Anfang Februar mit 415 Punkten auf ein Pandemie die Handelsaktivitäten dämpften. Mit
Tief, welches dem Allzeittief von Februar 2016 111 Punkten befindet sich der Index auf dem Ni-
extrem nahekam (291 Punkte). veau von März 2018. Ein Wiederanziehen des
weltweiten Warenverkehrs dürfte sich erst zei-
Da der internationale Warenverkehr hauptsäch- gen, wenn die großen Volkswirtschaften den
lich über Seeschiffe mit Containern erfolgt, lässt Ausgang aus dem realwirtschaftlichen Stillstand
der RWI/ISL-Containerumschlag-Index ebenfalls finden.
gute Rückschlüsse auf die Entwicklung des welt-
28
Welthandel mit Abwärtstendenz.
120 10 %
8%
115
6%
110
4%
105 2%
100 0%
-2%
95
-4%
90
-6%
85 -8%
März Juli Nov. März Juli Nov. März Juli Nov. März Juli Nov. März Juli Nov. März
2015 2016 2017 2018 2019 2020
RWI/ISL-Containerumschlag-Index Veränderung Y – Y (rechte Achse)
(saison- und arbeitstäglich bereinigt) (linke Achse)
Quellen: Refinitiv, LBBW Research
Stimmung04
Finanzierungsbedingungen
im Mittelstand.04
Ergebnisse Mittelstandsradar
Finanzierungsbedingungen
im Mittelstand.
04.1 | Leitzinsen in Krisenzeiten.
Die schwache konjunkturelle Dynamik, die Rezession im
Verarbeitenden Gewerbe sowie die geopolitischen Un-
sicherheiten trafen vor der Corona-Pandemie auf eine
zunehmende Beschäftigung, steigende Löhne und eine
EZB-Geldpolitik, die sich im Expansionsmodus befand.
30
Das Resultat: Trotz Niedrigzinsen und historisch günstiger Finan-
zierungskonditionen war der Kreditappetit der Unternehmen ein-
getrübt, da die Investitionsneigung der Unternehmen durch die
kraftlose Konjunktur belastet wurde.
Mit Beginn der Corona-Pandemie und deren globaler Ausbreitung
war die sich langsam aber sicher erholende Industriekonjunktur
urplötzlich mit unterbrochenen Lieferketten, Kurzarbeit und ei-
nem rückläufigen Verbrauchervertrauen konfrontiert. Infolge der Notenbanken als Krisenlöser.
schockbedingten Angebots- und Nachfrageeinbrüche dürfte sich
die Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionsentscheidun-
gen verstärkt haben. Vor allem die durch die Corona-Krise betroffe-
ne exportorientierte Industrie dämpft die Ausrüstungsinvestitionen.
Somit dürften Unternehmen im Gesamttrend trotz Niedrigzins-
umfeld, ultra-expansiver Geldpolitik und merklich stützender Fi-
nanzpolitik ihre Investitionen und damit auch ihre Nachfrage nach
langfristigen Krediten für Ausrüstungsinvestitionen zurückfahren,
da sie derzeit nur bedingt Wachstumsperspektiven sehen dürften.
Um den durch die Corona-Krise verursachten wirtschaftlichen Ab-
sturz abzumildern, wurden rund um den Globus geld- und fiskal-
Finanzierungsbedingungen
politische Stimuli ohne historisches Beispiel auf den Weg gebracht.
Dabei sind die großen Notenbanken als Feuerlöscher gefragt, um
den Kreditfluss am Laufen zu halten und sicherzustellen, dass es
nicht zu Finanzierungsengpässen infolge der Krise kommt. Die in
Aussicht gestellten Liquiditätsspritzen sollen vor allem den wegen
der Virus-Pandemie-Krise in Bedrängnis geratenen Mittelständlern
zugutekommen.Globale Benchmark-Zinsentwicklungen seit Beginn 2020.
Ergebnisse Mittelstandsradar
Zinssenkung Zins unverändert Zinserhöhung
Stand: 04.05.2020
Quellen: Bloomberg, LBBW Research
31
Zentralbanken im Krisenmodus.
Weltweit haben
Die US-Notenbank hat bereits am 3. und 15. März 2020 angesichts
weltweiter Rezessionssorgen mit zwei außerplanmäßigen und über-
Notenbanken
raschenden Zinssenkungen ein Ausrufezeichen im Kampf gegen vieler Volkswirt-
die Folgen der Corona-Krise gesetzt und den Schlüsselsatz auf die
Spanne von 0,0 % bis 0,25 % gekappt. Derartig große Schritte hatte
schaften bereits
es zuletzt in der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren gegeben. Um reagiert und die
die Konjunktur zu stützen, legte die Fed (Federal Reserve System) Leitzinsen und/
zudem unter anderem ein 2,3 Billionen US-Dollar schweres Not-
programm auf. oder ähnliche
Benchmark-Zins-
Wie andere große Zentralbanken hat die Europäische Zentral-
bank (EZB) in den vergangenen Wochen ebenfalls umfangreiche
sätze seit Beginn
Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der 2020 gesenkt.
Virus-Krise beschlossen. Im Gegensatz zur Fed oder zur Bank of
England behielt die EZB den Leitzins bei 0,0 % (seit März 2016)
und den bereits negativen Einlagesatz unverändert bei – 0,5 %. Die
Bank of Japan und die Schweizerische Nationalbank ließen ihre
im internationalen Vergleich extrem niedrigen Leitzinsen ebenfalls
Finanzierungsbedingungen
unverändert.
Diese Entscheidungen dürften unterstreichen, dass der Grenz-
nutzen weiterer Zinssenkungen im Euroraum, ähnlich wie in Ja-
pan oder der Schweiz, bei null liegt. Die Währungshüter kündigten
stattdessen Liquiditätsspritzen für Banken und umfangreiche An-
leihekaufprogramme an, um den Kreditfluss an die Wirtschaft zu
stützen.Sie können auch lesen