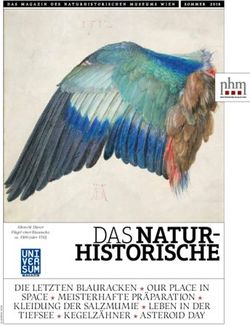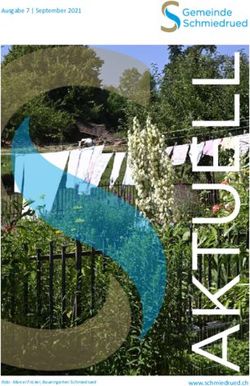Eustress - Distress - Extremstress/ traumatischer Stress - und was dann? Folgestörungen und Behandlungsansätze
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eustress – Distress – Extremstress/
traumatischer Stress – und was dann?
Folgestörungen und Behandlungsansätze
Eustress – Distress – Extreme Stress/Traumatic Stress – And What Next?
Aftereffects and Treatment Approach
Eva Münker-Kramer
Stresspsychologie
Zusammenfassung gerten Begriffes „Trauma“ (=medizinische Verletzung) zu
verwenden.
In diesem Beitrag geht es darum, die „pathologischen“ Er- Dies macht es teilweise holprig, dafür inhaltlich kor-
scheinungsformen von Stress – jenseits von Distress – auf rekter. Lediglich in der Beschreibung des Grundkonzep-
Basis der klassischen psychologischen Stresstheorie von Hans tes ist „traumatischer Stress“ geblieben, weil hier nahezu
Selye zu beleuchten sowie dann die wichtigsten Behand- ein „terminus technicus“ entstanden ist. Außerdem war
lungsprinzipien auf diesem Hintergrund darzulegen. Diese das Konzept zunächst historisch im Jahr 1981 zum Zeit-
Beschäftigung mit „toxischem“ Stress (auch Extremstress, punkt der WHO-Anerkennung der Posttraumatischen
traumatischer Stress), der nach potentiell psychisch trau- Belastungsstörung als „Mutter der Diagnosen im Kon-
matisierenden Ereignissen/Erlebnissen akute bis chronische text toxischen Stresses logischerweise medizinnahe. Die
Folgen haben kann, soll in Anlehnung an die die aktuellen Anerkennung der Störung basierte auf Selyes Stress-
Erkenntnisse der Psychotraumatologie erfolgen. konzept und erfolgte aufgrund der Zusammenschau der
Symptome bei Opfern aus kriegerischen Auseinander-
setzungen und Opfern aus familiärer Gewalt nach ca. 150
Abstract Jahren nach den ersten Symptombeschreibungen (mehr
in Herman, 2003, S. 17-51 und Münker-Kramer, 2005, S.
293f).
This article wants to point out the pathological forms of stress
Eine wichtige Botschaft des Artikels soll somit sein,
– going beyond distress based on the pioneering work of Hans
den Konnex zwischen den historischen Wurzeln der Psy-
Selye. Furthermore it aims to describe the most important
chologie des Stresses und den modernen Konzepten der
treatment principles on this background. This concern – wor-
Psychotraumatologie bzw. Psychotherapie und klinisch-
king on the consequences of so called “toxic” stress in its acute
psychologischen Diagnostik und –Behandlung von Fol-
and chronic manifestations takes recent findings of psycho-
gen traumatischem Stress, Stressforschung und Psy-
traumatology into consideration.
chotraumatologie explizit herzustellen. Sie liegen eng
beieinander und bringen zwei Forschungsrichtungen,
die sich lange in getrennte Richtungen entwickelt haben
1. Die Begriffe – Körper vs. Seele/Geist wieder zusammen.
In den letzten 15 Jahren bieten die modernen bildge-
Dieses Thema „toxischer Stress“ in dieser Schwerpunkt- benden Verfahren darüber hinaus in beiden Bereichen
nummer zu platzieren, macht es kurz notwendig, Psycho- faszinierende Ergebnisse, die sowohl die Alltagserfah-
logie des Stresses und als Begriffsklärung und Definition rungen im Kontext traumatischen Stresses (siehe unten)
von Psychologie herzuleiten: Psychologie ist die Wissen- als auch das klinische Wissen und die klinische Beob-
schaft vom Erleben und Verhalten des Menschen – in achtung bestätigen.
dem Fall „unter Stress bzw. richtig im Erleben und im
Umgehen mit Stressoren verschiedensten Ausmaßes“.
Wichtig ist, Sprache und Beschreibungen einerseits
im Sinne des erwähnten Stresskonzeptes zu benutzen
und andererseits den Begriff „Psychotrauma“ anstatt des
inhaltlich eigentlich falschen Begriffes aber eingebür-
54 Psychologie in Österreich 1 | 2009Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
2. Entstehung von Extremstress chend werden Hormone wie Noradrenalin und Cortisol
bzw. „toxischem Stress“, ausgeschüttet, um Kampf oder Flucht optimal zu ermög-
lichen (z.B. Muskeltonus, Atmung…). Dies ist, wenn es
semantische Abgrenzung zu Stress
„gut ausgeht“, im klassischen Stresskonzept von Selye
und Parallelen zu Stress und auch den Weiterführungen von Lazarus beschrieben
(Lazarus & Folkman, 1984)
2.1. Was ist nun ein „potentiell traumatisierendes Wenn aber nun keine dieser beiden natürlichen Re-
Ereignis“? aktionen möglich ist und wir weder adäquat reagieren
noch das Erlebte einordnen können, bleibt der Körper
Es ist wichtig, nicht beim Ereignis per se schon von „Psy- ohne cortikale Einordnungsmöglichkeit des Erlebten
chotrauma“ zu sprechen. Es ergibt sich erst bei einem sozusagen „in der nicht zu Ende gebrachten Stressreak-
ungünstigen Verhältnis zwischen Ressourcen und sub- tion stecken“ – Huber nennt dies „traumatische Zange“
jektiven Bewältigungsfaktoren und dem Ausmaß der Be- – „no fight, no flight“ führt zu „freeze“(Huber, 2003a, S.
lastung sowie anderen intervenierenden Variablen – von 39ff). Hier liegt u.a. der Ursprung des ersten PTBS-Leit-
Fischer/Riedesser „der traumatische Prozess“ (Fischer symptoms „Übererregbarkeit“ in all seinen Facetten, das
& Riedesser, 2003, S. 61ff) genannt. An dieser Stelle die teilweise auf sogenannte Trigger (Auslöser) hin bis über
Originaldefinition: „Ein psychisches Trauma (besser: Jahrzehnte bestehen bleiben kann (siehe unten – hier
„potentiell traumatisierendes Ereignis“, s.o.) ist ein vi- auch der Bezug zum „vitalen Diskrepanzerlebnis“ in der
tales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situ- obigen Definition von Fischer/Riedesser.
ationsfaktoren und subjektiven Bewältigungsfaktoren, Darüber hinaus passiert aber auch mental etwas im
das mit einem Gefühl von Hilflosigkeit und schutzloser Zusammenhang mit dem oben Genannten: Die oft star-
Preisgabe einhergeht und zu einer dauerhaften Erschüt- ken sensorischen Erlebnisse – visuell (z.B. verstümmelte
terung des Selbst-und Weltverständnisses führt.“ (Fi- Leichen), auditiv (z.B. Reifenquietschen vor dem Unfall),
scher & Riedesser, 2003) olfaktorisch (z.B. Geruch des Rasierwassers des Verge-
Diese sprachliche Klarheit ist wie beim Umgang mit waltigers oder des Täters bei lang andauernder sexueller
dem Begriff Stress wichtig: auch hier sagt man im All- Gewalt), gustatorisch (z.B. Blutgeschmack bei einem Un-
tag schnell: „ich bin im Stress“ und meint noch nicht das fall), kinästhetisch (z.B. Berührung eines Toten im Zuge
Ergebnis, sondern die Ursache, im Sinne von „ich bin einer Bergung als Feuerwehrmann) werden aufgrund der
diversen Stressoren ausgesetzt, die mich derzeit desta- „Überflutung“ (Neurobiologie siehe unten) kortikal nicht
bilisieren und Symptome machen aufgrund eines Miss- entsprechend weiterverarbeitet und daher nicht im so
verhältnisses von Bedrohlichkeit und Copingmechanis- genannten expliziten Gedächtnis (sprachlich erinnert,
men“. chrono(logisch) und in die Biographie eingeordnet in
Das Konzept des traumatischen Prozesses mit dem Zeit und Zusammenhang) integriert.
ungünstigsten Endergebnis „Psychotrauma“ entspricht Sie bleiben stattdessen fragmentiert im so genann-
der korrekten Beschreibung von Stressentstehung nach ten impliziten Gedächtnis (nicht integriert, Bilder, Ein-
Selye in den bekannten drei Stufen, nur sozusagen „ei- drücke, Körpererinnerungen). Aufgrund dessen sind sie
nige Oktaven tiefer, stärker und mit tieferen und in man- dann unwillkürlich und ungesteuert jederzeit auslösbar
chen Fällen chronischen neurobiologischen Spuren und wiedererlebbar. Sie stellen damit das zweite Leit-
(„The body keeps the sore“ – van der Kolk, 2007). symptom der akuten und chronischen Belastungsreak-
Auswirkungen von Extremstress können sich dem- tion/-störung dar: die realistisch wirkenden Wiederer-
nach auf vier Repräsentationsebenen zeigen: Verhalten, innerungen (Flashbacks, Intrusionen), die wie im „Hier
Gedanken, Gefühle und Körper – die drei letzten kom- und Jetzt“ erlebt werden, sobald sie aktiviert sind und
men in der obigen Definition vor und werden weiter un- dadurch extrem angst- und schamauslösend. Sie werden
ten als Alltagsphänomene und klinische Symptome in von den Betroffenen und leider teilweise auch von Fach-
den verschiedenen Krankheitsbildern noch einmal auf- leuten manchmal mit Halluzinationen u.ä. falsch oder
gegriffen bzw. auch in der neurobiologischen Erklärung auch gar nicht adäquat diagnostiziert.
thematisiert. Daraus können sich Folgen wie z.B. sozialer Rück-
zug und Substanzmissbrauch als Sekundärsymptome
aus Scham und zur Betäubung bzw. Eindämmung der
3. Neurobiologie des Extremstresses und (scheinbar) sensorischen Symptome ergeben.
„blockierte Informationsverarbeitung“ Exkurs Dissoziation: Eine weitere „Möglichkeit“, Aus-
löser und somit Symptome zu reduzieren, ist es, diese
konsequent zu vermeiden. Dieses Vermeidungsverhal-
Grundsätzlich begegnen wir Situationen, die durch vi-
ten ist das dritte Leitsymptom der PTBS.
tale Bedrohung oder anderen Extremstress gekenn-
Auch das Phänomen der Dissoziation (Abspaltung,
zeichnet sind, durch zwei reflexhafte Möglichkeiten, die
Gegenteil von Assoziation, auseinandergeben dessen,
nicht „kortikal“, sondern rein „limbisch“ gesteuert sind:
was eigentlich zusammengehört, im Falle von toxischem
Nach einer kurzen Orientierungsreaktion reagieren wir
Stress „das Ereignis“, s.o.) hat zunächst als Bewälti-
automatisch mit Kampf oder Fluchttendenzen, entspre-
gungsmechanismus in einer „unaushaltbaren Situation“
Psychologie in Österreich 1 | 2009 55Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
hier den Ursprung. erfolgen – es ist eingeordnet und abgelegt – und „ruhig“
Es ist ein neurobiologischer Reflex (kein neurotischer – eine erfolgreiche Informationsverarbeitung.
Abwehrmechanismus, wie oftmals missverstanden) un- Anders ist es bei den bisherigen subjektiven Er-
ter Extremstress wie die körpereigene Analgesie sich bei fahrungen oder das objektiv „Ertragbare, Erwartbare“
für das volle Bewusstsein unaushaltbaren Schmerzen sprengenden Erlebnissen: Hier beginnt es ähnlich – der
quasi einschaltet – beides in der Situation segensreiche Thalamus nimmt die Information auf, leitet sie schnells-
Mechanismen, um Unaushaltbares auszuhalten. tens zur Amygdala weiter. Diese identifiziert den Reiz
„Chronisch zu viel und zu lange jedoch als „Bewälti- als „heiß“, gibt generellen Alarm und aktiviert dabei als
gungsmechanismus eingesetzt“, kann das Gesamtgefüge erstes und sehr massiv die reflexartige Schreckreaktion
der Persönlichkeit letztlich daran zerbrechen (komplexe unseres Körpers – Kampf/Flucht (vor der Hormonaktivie-
Dissoziation bis hin zu dissoziativer Identitätsstörung). rung) und setzt dann die Stresskaskade (Selye, 1976 zit.
Hier sei nur am Rande erwähnt, dass diese Gefahr umso nach Huber, 2003a) mit dem bekannten „Hormoncock-
größer ist, je früher z.B. eine sequentielle Traumatisie- tail von Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol in Gang.
rung beginnt und je weniger sprachliche Verarbeitungs- Der „kühle Kopf“ ist verloren (vgl. Kapitel Alltagssprache
möglichkeit und Integration im Broca-Areal, d.h. je höher und klinische Einordnung).
die Sprachlosigkeit, desto höher die Gefahr der komple- Diese Erkenntnisse werden bei sämtlichen Behand-
xen Dissoziation. lungsansätzen im Bereich der akuten und chronischen
In diesem Kontext können also Intrusionen sozusa- Belastungsreaktion – wenn auch verschieden intensiv
gen als „Stressoren aus der Vergangenheit“ über aktu- und auf verschiedenen Ebenen – aufgegriffen.
elle Trigger aktiviert verstanden werden. Diese aktuellen Aus den o.g. Ausführungen ergeben sich zwingend
Trigger müssen per se (unkonditioniert!) keine Stresso- sowohl die Prinzipien der Akuthilfe und der Weiterbe-
ren sein. handlung bis hin zur Therapie: in Sicherheit bringen, die
Speziell in den letzten Jahren wurden mittels PET Ereignisse „kortikal“ fassen und ordnen, Psychoeduka-
(Positronen Emissions Tomografie) oder MRT (Magnet tion und Stabilisierung bzw. „Reprozessieren und Neu-
Resonanz Tomografie) – Untersuchungen bei Personen, ordnen“ des „hängengebliebenen Materials“ und somit
die gezielt an die traumatischen Ereignisse erinnert wer- Integration – dazu unten Genaueres.
den („Trauma Skript“), große Fortschritte zu den neuro- „Die besondere Qual der Trauma-Überlebenden be-
anatomischen und neurobiologischen Repräsentanzen steht darin, dass sie zuviel oder zuwenig fühlen“ (Onno
der Traumafolgestörungen gemacht (van der Kolk, 2003, van der Hart, in Huber, 2003). Dies ist tägliche Erfahrung
1994, Yehuda et al., 2001) Laut dieser Forschung stehen von BehandlerInnen traumatisierter Menschen und hat
folgende topografische Strukturen mit folgenden spezifi- viel mit dem Thema Extremstress zu tun. Unter einer be-
schen Aufgaben bei den gegenständlichen Phänomenen stimmten Schwelle bleibt die Übererregung im Körper
im Vordergrund: einerseits das limbische System mit stecken, über dieser Schwelle springt der neurobiologi-
Amygdala („Mandelkern – „Zuordnung von Signifikanz sche Schutzmechanismus der Dissoziation an. Zu den
von Reizen“), Hippocampus („Seepferdchen“ – „kognitive körperlichen Spuren findet sich bei Rothschild (2005)
Weltkarte“) und Thalamus („Schaltstelle für sensorische unter dem Titel „Der Körper erinnert sich“ sehr viel Wei-
Informationen“), andererseits der vor allem für die Inter- terführendes.
pretation und Integration verantwortliche frontale Cor- Inzwischen weiß man u.a., dass traumatischer Stress
tex, aber auch das so genannte Broca-Areal, das Sprach- die Neubildung von Nervenzellen besonders im Hippo-
zentrum im linken frontalen Cortex (nach van der Kolk, in campus unterdrückt und somit sogar strukturelle-mor-
Hofmann (2005) und Huber (2003a). Informationen und phologische Auswirkungen zu verzeichnen sind.
Reize, die das Gehirn aufnimmt, werden zum Thalamus
und von dort aus zur Amygdala weitergeleitet. Sie akti-
viert dann je nach „Bedeutung“ des Reizes die Prozesse 4. Mögliche Folgestörungen von
für neurochemische Vorgänge für jegliche Reaktion des Extremstress – Systematik, klinische
Organismus (Kampf, Flucht, Ruhe…).
Diagnosen und Behandlung
Nun wird bei einem normalen (= in den individuellen
relativen normativen Bezugsrahmen einzuordnenden…)
Reiz einerseits das so genannte „cool system“ in Gang Um die Abstufungen der Auswirkungen traumatischen
gesetzt, das so aussieht, dass die Information von der Stresses klinisch genauer zu beleuchten, möchte ich
Amygdala in den Hippocampus (auch „kognitive Welt- mich zweier einander ergänzender Systematiken poten-
karte, Bibliothek“ genannt) weitergeleitet wird, dort mit tiell traumatisierender Ereignisse bedienen, die im Fol-
Bedeutung versehen – interpretiert – wird und ihren wei- genden dargestellt werden:
teren Weg wieder über den Thalamus in die kortikalen Zunächst sei eine Systematik der Psychiaterin Le-
Verarbeitungszentren – vor allem den frontalen Cortex nore Terr erwähnt (siehe auch in Abb. 1, ganz oben), die
(Integration und Planung) und das Broca-Sprachzent- zwischen so genannten Typ I Traumata – Folgen eines
rum („narrative Einordnung“) findet. Hier kann dann die unerwarteten Einzelereignisses wie z.B. Vergewaltigung,
raumzeitliche Integration des Erlebten in das vorhan- Überfall, Unfall, Naturkatastrophen, Unglücksfälle und
dene Material aus Erfahrungen und Lebensgeschichte Typ II Traumata als Folgen mehrmaliger, sich wiederho-
56 Psychologie in Österreich 1 | 2009Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
lender oder auch andauernder – kumulativer Traumata, tombereiche:
z.B. andauernder sexueller Missbrauch, länger dauernde Typ II Trauma als Außenereignis + Störungen der Af-
Entführung u.ä. unterscheidet (Herman, 2003, S. 167). fektregulation (hier ist der Bezug zu toxischem Stress
Die wesentlichen potentiellen Folgen von „Typ I Ereig- wie bei der einfachen PTBS) + Bewusstseinsverände-
nissen“ sind in der PTBS-Diagnose F43.1 (Dilling, Mom- rungen wie u.a. Amnesien und dissoziative Phasen +
bour & Schmidt, 2005) beschrieben: gestörte Selbstwahrnehmung + gestörte Wahrnehmung
• Intrusionen im Sinne von intrusivem Erinnern. Dies des Täters + Beziehungsprobleme + Veränderungen des
kann über visuelle, affektive, taktile, olfaktorische, Wertesystems.
auditive, gustatorische oder situative Auslöser (siehe Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung
auch oben, Kapitel Neurobiologie) kommen, fühlt sich oder Störung nach Extremstress, die anderweitig nicht
„wie real“ an, da herausgehoben aus einem Raum-Zeit spezifiziert wurde, ist in der klinischen Wirklichkeit oder
Kontext und die Unterscheidung „hier und jetzt“ und z.B. auch in Einrichtungen von Jugendwohlfahrt etc. als
„dort und damals“ ist nicht möglich. Diese Erinnerun- diagnostische Kategorie nicht mehr wegzudenken und
gen kommen aus dem so genannten „impliziten Ge- ist daher hier erwähnt. Auch in der psychiatrischen Ver-
dächtnis“. sorgung wäre hier sicher einiges anders zu sehen, wenn
• vermeiden der Auslöser (situativ und intrapsychisch! diese diagnostische Brille „öfter aufgesetzt würde“. In
Hieraus können sich Komorbiditäten wie Sozialängste, einem exzellenten Artikel dazu gehen Driessen, Beblo,
generalisierte Angststörungen – auch Suchtprobleme Reddemann und Kollegen (2002) im deutschen Fachma-
ergeben. gazin „Nervenarzt“ sogar so weit, die Annahme eines Di-
• In dem dritten Bereich, der chronischen Übererre- athese-Stress-Modells der Borderline-Persönlichkeits-
gung, die sich klinisch über Schlafstörungen, Reizbar- störung mit Traumatisierung als notwendige, aber nicht
keit, Konzentrationsstörungen, verstärkte Schreckre- hinreichende Bedingung zu postulieren.
aktion, Tachykardie, Schwitzen, Erröten u.ä. zeigt, ist In folgender Darstellung (Abbildung 1) werden nun
die Basis in der sympatikotonen steckengebliebenen einerseits die potentiellen Folgestörungen nach psy-
Erregung und somit im toxischen Stress klar. chischer Traumatisierung (siehe ICD Nummern in Ab-
bildung 2, um diagnostische Klarheit zu haben), ande-
Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass bei den rerseits auch die über die Unterscheidung in Typ I und
Typ I Traumata oft die „Stressstörung“ im Erleben, Ver- Typ II hinausgehende, noch einmal pragmatisch aufge-
halten und in Betreuung und Behandlung im Vorder- schlüsselte Klassifizierung potentiell traumatisierender
grund steht. Damit ist ein wesentlicher Teil des Umgan- Ereignisse/Erlebnisse in Mono-, Multi-, sequentielles
ges damit Psychoedukation und Stresscoping. Dies ist, und Entwicklungstrauma dargestellt.
wie an anderer Stelle bereits erwähnt, wieder ein Beleg Diese Unterteilung bezieht sich einerseits auf die
dafür, dass grundsätzliches „umgehen Können mit Dist- Anzahl der Ereignisse (Mono-Multitrauma) und hat
ress“, im Sinne von eigenen Fähigkeiten und Fertigkei- andererseits Implikationen bezüglich der „Systematik“
ten, das Erleben und Entstehen traumatischen Stresses (sequentiell – immer wieder dasselbe) und des Beginns
reduzieren kann (= Vorhandensein „subjektiver Bewäl- (Entwicklungstrauma – Beginn in der Kindheit) der Be-
tigungsmechanismen“ im Sinne von Fischer/Riedessers lastungen (Besser, 2004). Es ist nachvollziehbar, dass
Definition). diese Bedingungen von der kognitiv-emotional-körper-
Beim Typ II Trauma, das nicht selten im Kontext von lichen Verarbeitung her verschiedene Schwerpunkte
Beziehungen stattfindet und somit ungleich komplexere und somit verschiedene Behandlungsschwerpunkte bei
Dynamiken von Bindung, Schuld, Scham, „Lebenskon- Überschneidungen genau im Bereich des Stresscopings
zept“, Attributionen etc. in Gang setzt, kommt im Sinne nahe legen.
der so genannten Trauma-Dynamik das „veränderte
Selbst- und Weltverständnis“ massiv erschwerend dazu.
Hier ist neben dem Stresscoping, um den Sympathikus 4.1. Darüber hinaus liegen der Darstellung
überhaupt soweit „herunterzufahren“, damit überhaupt folgende Überlegungen zur Behandlungsplanung
Ressourcen wahrnehmbar sind – intensive Ressoucen- zugrunde:
aktivierung (soweit vorhanden, z.B. bei sequentiellem
Trauma „von vorher“) oder Ressourcenaufbau vonnöten. Sie sollen die Rolle der Psychoedukation, die Rolle der
In diesem Kontext findet sich seit einigen Jahren eine Stabilisierung, die Platzierung der Traumakonfrontation
pragmatisch wichtige so genannte „neue Diagnose (Her- visualisieren, andererseits die verschiedenen Arten von
man, 2003, S. 161 ff und Huber, 2003, S. 255ff), die mit Belastungen in ihrem Charakter und ihrer Wirkung auf
umständlicher anglo-amerikanischer Bezeichnung DES- die Persönlichkeit demonstrieren. Aus diesen Gründen
NOS (= disorder of extreme stress not otherwise speci- sollte jede/r TraumabehandlerIn grundsätzlich zunächst
fied – Störung nach Extremstress, die anderweitig nicht eine Grobeinschätzung machen – die eine Maßnahme
spezifiziert wurde) im Deutschen als komplexe posttrau- zum Zeitpunkt x bei Traumatyp y kann zum einen Zeit-
matische Belastungsstörung Einzug in die Fachlitera- punkt genau richtig und zum anderen Zeitpunkt kom-
tur genommen hat. Sie bezeichnet über die klassischen plett kontraindiziert sein. Alle Implikationen dessen im
Symptome der „einfachen“ PTBS hinaus folgende Symp- Rahmen dieses Beitrages zu erläutern, ist unmöglich.
Psychologie in Österreich 1 | 2009 57Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
Die Darstellung soll lediglich zur Sensibilisierung für das „Ertragen, Aushalten, Überleben“ irgendeine Erklä-
die Vielfältigkeit des Themas und damit zur Sorgfalt in rung brauche („man kann alles ertragen, wenn man weiß,
Diagnose, Behandlungsplanung und Behandlung die- warum“. Bettelheim, 1982), dann hilft immer noch, die
nen. Im Kontext des vorliegenden Artikels soll die Logik Schuld und Verantwortung bei sich selbst zu suchen „ich
der Unterscheidung des behandlungstechnischen Fokus bin schuld, ich bin nicht gut genug…“
auf Stresscoping und somit Wiederermächtigung der Dies wird von den Tätern in diesem Bereich perfide
durch die Symptomatik oft in dieser Hinsicht hilflos ge- genutzt und gefördert. Hilfreich ist, wenn diese Belas-
wordenen PatientInnen und Reduktion des unmittelba- tungen zumindest auf Menschen treffen, die schon ein
ren Leidensdruckes einerseits (einfache PTBS) und zu- Grundkonzept, eine Grundpersönlichkeitsstruktur ha-
sätzlicher Behandlung der Traumadynamik andererseits ben, eine Grundidee im Sinne von „ich bin wertvoll“, „ich
übersichtlich verdeutlicht werden. bin liebenswert…“. Je mehr hier Ressourcen sozusagen
All dies hat Auswirkungen auf das Ausmaß der Beein- vor Beginn der Belastungen an da sind, je voller das Res-
trächtigung und Selbstbildschädigung, wobei selbstver- sourcennetzwerk ist, desto schneller kann man diese
ständlich in allen Bereichen Behandlungsbedarf besteht aktivieren und die Person stabilisieren, indem man sie
und nicht zwischen „weniger schlimm und schlimmer“ wieder in Kontakt damit bringt.
gewertet werden soll. Für die betroffene Person ist das Der wichtigste Unterschied zum Charakter des Ent-
jeweils Erlebte das schlimmste Vorstellbare und soll wicklungstraumas und dessen Behandlungsimplikatio-
selbstverständlich auch so gewürdigt werden. nen ist nun einerseits das Alter beim Beginn der Trau-
Der nächste Bereich im Schaubild macht Aussagen matisierung und damit das Ausmaß der Grundstabilität
über die Behandlungsplanung. Bei diagnostisch „abge- als Person. Ist schon eine Person vorhanden, die grund-
sicherten“ Monotraumata (= Einzelereignisse), wo die sätzlich irgendwann von irgendwem das sichere Gefühl
Belastung auf eine relativ stabile Grundpersönlichkeit hatte, in dieser Welt willkommen zu sein? An dieser
mit Ressourcen und guter Einbettung trifft, kann relativ Stelle kann und soll (siehe oben, andere Beiträge) hier-
bald eine Traumakonfrontation mit den verschiedensten auf nicht näher eingegangen werden, nur soviel sei ge-
Methoden erfolgen (vgl. auch Münker-Kramer, 2006, S. sagt – je früher der Beginn der Traumatisierung, je länger
307-317 und Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Auch Psy- dauernd und je weiter der/die TäterIn im eigenen engs-
choedukation (den Betroffenen in angemessener Weise ten Bindungssystem ist, desto fataler, schwerwiegender
die Hintergründe ihres Erlebens und ihrer Reaktionen sind die Folgen und desto länger dauert die Stabilisie-
erklären, um sie zu informieren und zu entlasten und die rung und der Ressourcenaufbau. Auch in diesem Bereich
eigenen Handlungsschritte transparent zu machen) al- ist ein fundamenteller Teil der Behandlung das Stress-
leine ist hier schon sehr hilfreich und wirksam. coping wie z.B. Skills-Training (vgl. dazu sehr ausführlich
Nach dem Erleben von Multitrauma ist häufig natür- Sendera, 2005) – sehr oft finden sich bei diesen Patien-
lich „mehr desselben“ nötig und es bedarf mehr Stabili- tInnen Selbstverletzungen. Diese fügen sie sich u.a. zu,
sierung, da sich mitunter sehr belastende blockierende um die durch die Erlebnisse häufig „not-wendig“ gewor-
Überzeugungen herausbilden (vgl. auch Ehlers, 1999) denen körpereigenen Analgesierungen, die dann chro-
„ich bin vom Pech verfolgt“, „das ist mein Schicksal“. nisch oder auf Trigger leicht auslösbar als sogenannte
Auf der anderen Seite hilft die Art der Attribution auch dysfunktionale Symptome bestehen, zu lösen.
wieder, weil es nach mehreren verschiedenen Ereignis- In etlichen Fällen ist Traumakonfrontation lange bis
sen zwar auf der Metaebene diese Blockierungen geben nie Thema, da Alltagsstabilisierung, kompetenter Um-
kann, im Detail aber durchaus unterschiedliche Erklä- gang mit dem eigenen Stress und ein grundsätzliches
rungsmuster – häufig auch mit „äußeren Auslösern oder „ja“ zu sich selbst im Vordergrund stehen und nicht
„Schicksal“ im Vergleich zu interpersoneller Gewalt (s.u.) wenige PatientInnen damit sehr zufrieden sind, weil es
– in der Behandlung herauszuarbeiten sind (Verkehrsun- mehr ist, als sie je hatten.
fall, schwere Krankheit, Naturkatastrophe…). Oft kom-
men die Erklärungen aus unterschiedlichen Bereichen
und Kontrollüberzeugungen („das ist Schicksal“, „da war
ich zur falschen Zeit am falschen Ort,…“…) und so ist
die Bedrohung im Sinne der dauerhaften (siehe Defini-
tion Fischer/Riedesser oben) Selbstbilderschütterung
geringer.
Ganz anders hingegen ist es bei sequentieller Gewalt:
anhand der o.g. konkreten Beispiele wird deutlich, dass
hier die Betroffenen oft interpersoneller Gewalt und gro-
ßer Hilflosigkeit ausgesetzt sind und hier die Gefahr der
dauerhaften (siehe Definition Fischer/Riedesser) Selbst-
bilderschütterung – „ich bin nicht ok, so wie ich bin“, „ich
bin wertlos“… außerordentlich groß ist. Wenn es keine
äußeren Erklärungsmuster für ein Geschehen gibt, ich
aber für die Bewältigung bzw. zunächst nur einmal für
58 Psychologie in Österreich 1 | 2009Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
Abbildung 1: Überblick zum Thema Traumafolgestörungen
Abbildung 1: Überblick zum Thema Traumafolgestörungen
Abb. 1: Überblick zum Thema Traumafolgestörungen sehr wichtig, diese Hilfe in Setting, im
Angebot und in der Kooperation der
Überblick zum Thema Traumafolgestörungen Versorgenden an der Bedürftigkeit zu
„Typ I“-Trauma „Typ II“-Trauma orientieren, da es bei Folgestörungen
Überblick zum Thema Traumafolgestörungen von potentieller psychischer Traumati-
Monotrauma Multitrauma sequentielles Tr. Entwicklungstr. sierung um Wiederermächtigung nach
„Typ I“-Trauma „Typ II“-Trauma Außenursachen geht und jegliche Art
von vorschneller Pathologisierung ver-
Psychoedukation
Monotrauma Multitrauma sequentielles Tr. Entwicklungstr.
Traumakonfrontation Stabilisierung, mieden werden soll. Ein Vorschlag ei-
Ressourcenaufbau ner guten Platzierung von Hilfe nach
Psychoedukation
Stabilisierung, vor allem einfacher PTBS mit der hohen
Traumakonfrontation DESNOS
Ressourcenaufbau Stresssymptomatik, der sich in den letz-
akute ten Jahren in der Fachliteratur und auch
Angst, Depression,
DESNOS dissoziative, komplexe
Belastungsreaktion, PTSD somatoforme in der Arbeit von Experten (z.B. auch
Traumafolgestörungen
Anpassungsstörungen
akute Störungen, Sucht.. ähnlich Arbeitsgruppe Akuttrauma der
Angst, Depression, dissoziative, komplexe
Belastungsreaktion, PTSD somatoforme DeGPT (deutschsprachige Gesellschaft
Traumafolgestörungen
als Komorbiditäten
Anpassungsstörungen Störungen, Sucht.. für Psychotraumtologie, www.degpt.de)
als Komorbiditäten t etabliert hat, soll im Folgenden darge-
Zeit, Zunahme an Symptomatik, Zunahme an Stabilisierungsnotwendigkeit stellt werden.
t
Zeit, Zunahme an Symptomatik, Zunahme an Stabilisierungsnotwendigkeit
In Abbildung 1 finden sich die konkreten möglichen Fol- 5.1. Psychische Erste Hilfe
gediagnosen und in Abbildung 2 dieselben noch einmal (PEH, vgl. auch Lasogga & Gasch, 2002)
als ICD Codierung mit jeweils einigen Screening- oder
Testverfahren. Die Zahlen in Klammern weisen auf die PEH ist eine erste Unterstützung parallel zur sonstigen
Abbildung 2: ICD-10
Stelle hin, an der dieseKodierungen
Verfahren bzw. Bezüge dazu bei Erstversorgung und soll eine Reduktion von Zusatzstres-
Abbildung
in einem2:Buchbeitrag
ICD-10 Kodierungen
zum Thema F43.0 und F43.1 zu fin- soren durch sogenanntes „psychologisch angemessenes
den sind (Münker-Kramer, 2006). Verhalten“ bewirken, z.B. Sprache, Informationsgabe,
keine Vorwürfe, kein Pathologisieren von Akutreaktio-
Abb. 2: ICD-10 Kodierungen
Monotrauma Multitrauma sequentielles Tr. Entwicklungstr.nen, etc. Diese Betreuung bietet auch
Monotrauma Multitrauma sequentielles Tr. Entwicklungstr. meistens ein erstes wichtiges Bindungs-
angebot für die oft total destabilisier-
Psychoedukation ten Betroffenen und passiert nebenbei.
Psychoedukation
Traumakonfrontation Stabilisierung,
Traumakonfrontation RessourcenaufbauDieses „nebenbei“ soll keine Abwer-
Stabilisierung,
Ressourcenaufbau tung dieser wichtigen Tätigkeit sein,
F43.0, F43.1, F.62 DESNOS DIS (F44.81),sondern im Gegenteil – es ist oft genau
F43.0,
F43.2... F43.1, F.62 DESNOS DIS (F44.81), BPS das Richtige niederschwellige und so-
F43.2... F43.1 und Komorbiditäten BPS
F43.1 und Komorbiditäten zusagen „mitgelieferte Angebot“ für die
(F41..., F42..., F44...,
(F41..., F42..., F44..., Betroffenen, wenn alles andere (noch)
F45...)
F45...) zuviel wäre bzw. u.U. auch per se unnö-
Akutscreening vgl. S. 305ff + PTSS10, IK-PTBS Verfahren zurtig wäre. Bespiele im Sinne von Stress-
Akutscreening vgl. S. 305ff + PTSS10, IK-PTBS Verfahren zur
(vgl. SEA3, Dissoziationsscreening
S. 304), Dissoziationsscreening Dissoziations-
Dissoziations-
(vgl. SEA3, S. 304), coping bzw. Vermeidung von Stressoren
IES, (FDS, (FDS,
DES DES
– – S.306)
S.306) Diagnostik,
Diagnostik, z.B. z.B.wären:
IES,
Risikofaktoren- Diagnostik von Diagnostik von SKID-DSKID-D
Risikofaktoren-
Komorbiditäten
abschätzung Komorbiditäten (vgl. S.306)
(vgl. S.306)
abschätzung
5.2. Psycho-Soziale Notfall-Hilfe
Zunahme
Zunahme an Symptomatik,
an Symptomatik, Zunahme
Zunahme an Stabilisierungsnotwendigkeit (PSNH)
an Stabilisierungsnotwendigkeit
5. Setting von Betreuung und Behandlung PSNH (vgl. genauer auch das gleichnamige Buch von
Lasogga & Münker-Kramer, 2009) trägt ebenfalls dazu
zur optimalen Stressreduktion bei
bei, zusätzliche Belastungen und potentielle psychische
Typ I-Traumafolgen Traumatisierungen (z.B. durch Verhöre…) aktiv zu ver-
meiden und auch „Übersetzungshilfe“ zu sein im „sozia-
Um den oben erläuterten Systematiken, Logiken und Ur- len System des Notfalls“, wie z.B. Rettungskräfte, Fami-
sprüngen von potentieller psychischer Traumatisierung lie, Schulklasse…
adäquat begegnen zu können, hat sich in den letzten Geleistet wird diese Tätigkeit oft durch sogenannte
20-30 Jahren von Betreuung, Versorgung, Diagnostik, KIT (Kriseninterventionsteams) von Rettungsorgani-
Behandlung und Therapie Betroffener her sehr viel ge- sationen und NotfallseelsorgerInnen, aber es ist auch
tan. Wie erwähnt ist es auch im Sinne der Betroffenen möglich, dass sich vor Ort schnell genug Fachkräfte (z.B.
Psychologie in Österreich 1 | 2009 59Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
NotfallpsychologInnen) einfinden. Die PSNH soll erste 5.3.4. SozialarbeiterInnen
Erklärungen in angemessener Form für das geben, was
die Betroffenen erleben (Vorstufe von Psychoedukation), Der Beitrag der Sozialarbeit nach Notfallsituationen
das erste Erfassen von situativen und sozialen Risikofak- kann eminent wichtig und indirekt stressreduzierend
toren soll erfolgen, die Organisation praktischer Hilfen sein, wenn z.B. der Ernährer einer Familie bei einem Un-
kann in Gang gesetzt werden. PSNH können in Kennt- fall ums Leben kommt und die Schuldenlast beim neu
nis der Übergabeindikationen und bei guter Netzwerk- gebauten Haus erdrückend ist oder wenn aufgrund von
kompetenz eine inhaltliche und persönliche Brücke zu Verletzungen ein Notfallopfer pflegebedürftig wird. Diese
Fachkräften darstellen und somit den Stress der Opfer Arbeit kann bis zur Heranziehung von Juristen gehen (ge-
deutlich reduzieren. nauer auch Aufreiter, 2006, Hörmann & Münker-Kramer,
2002, Lasogga &Gasch, 2004, Münker-Kramer, 2003).
5.3. Diagnostik und Trauma“beratung“/
-behandlung durch Fachkräfte 5.4. Traumaspezifische Psychotherapie
(z.B.: (Notfall-)psychologInnen, und klinisch-psychologische Behandlung
dipl. SozialarbeiterInnen, MedizinierInnen,
SeelsorgerInnen,…) Psychotraumaspezifische Psychchotherapie ist spezifi-
sche Heilbehandlung der o.g. krankheitswertigen Stö-
Hier geht es um die Zeit nach den ersten Stunden bis 1,5 rungen mittels 4-stufigenVorgehens (vgl. auch Huber,
Tagen bis hin zu ca. 4 Wochen, in der ganz verschiedene 2003b).
Fachkräfte, je nach Schwerpunktproblematik, „not-wen- Dies kann sich entweder auf die Chronifizierung im
dig“ sind, d.h. mit ihrem jeweiligen spezifischen Angebot Sinne einer PTBS aufgrund eines ungünstigen Ressour-
Abhilfe schaffen können. cen-Risikofaktorenverhältnisses beziehen oder auch
darauf, dass hinter dem aktuellen Ereignis liegende
Multi- oder auch Typ-II-Traumatisierungen liegen, die
5.3.1. Notfall-PychologInnen anlässlich dessen zum Tragen kommen und die die Akut-
und Nachbehandlung sprengen.
Dies kann aus psychologischer Sicht zeitraumspezifische
Diejenigen Aspekte dieses Vorgehens, die sich im
Differentialdiagnostik sein (Bsp. Im Hochwasser bei
engeren Sinne auf den Teil der Stressstörung beziehen,
manchen älteren Betroffenen – „Ist die depressive Re-
seien im Folgenden kurz skizziert (Münker-Kramer &
aktion Anpassungsstörung oder prämorbid?“), Erfassen
Wintersperger, 2004 für www.zap-wien.at)
klinischer (in Ergänzung zu „situativ“, was auch durch
Es ist ein sehr strukturiertes Gesamtbehandlungs-
Laien erledigt werden kann und soll) Risikofaktoren und
konzept. Alle Verfahren wurden spezifisch vor dem Hin-
ggf. Weitervermittlung in traumaspezifische Psychothe-
tergrund der psychischen und neurophysiologischen
rapie, Stabilisierung (Stresscoping, Ressourcenaktivie-
Besonderheiten der Vorgänge bei traumatischem Stress
rung, medizinisch, sozial), gezielte Psychoedukation,
(siehe oben) entwickelt und erprobt und die Grundhal-
weitere Übersetzungsarbeit, Hilfe bei der Rückkehr in
tung ist geprägt von parteilicher Abstinenz.
den Alltag.
Dem Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung wird
im Aufbau und in einer speziellen Haltung in der the-
5.3.2. TheologInnen rapeutischen Beziehung Rechnung getragen. Dies ist im
Wesentlichen gekennzeichnet durch sehr viel Informa-
Bei Notfällen im Zusammenhang mit Tod und Sterben tion über alles, was im Hier und Jetzt geschieht, durch
wie bei Suizid und Suizidversuch, wenn Rituale und frühzeitige Aufklärung über die Vorgänge bei Psycho-
Sinnfragen und spirituelle Bedürfnisse im Vordergrund trauma im Sinne einer kognitiven Stärkung und „ Nor-
stehen, sollte die Unterstützung durch TheologInnen malisierung“ der Symptome (Psychoedukation). Weiters
angeboten werden. Es kann auch im Zuge der Übergabe werden zu allen Zeiten der Therapie die PatientInnen als
in das engere soziale Netz der PastorIn/Pfarrer vor Ort PartnerInnen und „ExpertInnen“ für ihre belastenden
sein. und Extremstresserfahrungen und die TherapeutInnen
als ExpertInnen für die Methoden und wissenschaftli-
5.3.3. MedizinierInnen chen Hintergründe der Reaktionen/Störungen gesehen.
Viele psychotraumapezifische Symptome sind in der
Wenn z.B. körperliche Erschöpfung oder körperliche Regel durch herkömmliche Therapieverfahren nicht zu-
Beschwerden im Vordergrund stehen (beispielsweise gänglich bzw. kaum beeinflussbar.
„Hyperarousal“) und nicht mit anderen Möglichkeiten Auf dieser Basis erfolgt in allen Phasen eine transpa-
wie Entspannungs- und Distanzierungstechniken gelöst rente gemeinsame Behandlungsplanung, wobei dieses
werden können oder andere körperliche Auswirkungen Vorgehen auch immer gleichzeitig immanent ressour-
im Vordergrund stehen, sind Mediziner, auch u.U. Psych- censtärkend ist. Hier wird die Haltung beibehalten.
iaterInnen gefragt. Psychotherapie von von traumatischem Stress Be-
troffenen ist keineswegs eine neue „Schule“ unter den
60 Psychologie in Österreich 1 | 2009Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
zahlreichen Psychotherapie-Methoden oder den Metho- Literatur
den der klinisch-psychologischen Behandlung, vielmehr
ist sie eine spezifische Ergänzung. Sie ist aufgrund der AUFREITER, C. (2007) Die Sozialarbeit in der mulitprofessionellen Be-
psychotraumatologischen Theorienbildung notwendi- treuung von Traumabetroffenen am Beispiel des PsychoSozialen
AKUTteams NÖ – Eine Positionierung, eingereicht an der Fachhoch-
gerweise und konsequenterweise schulenübergreifend
schule St. Pölten, (unveröffentl. Arb.)
und erfordert klare und fundierte Konzepte und persön- BESSER, L. (2004) Seminarunterlagen im Curriculum Traumaspezifi-
lich reflektierte und inhaltlich-methodisch gut ausgebil- sche Psychotherapie am Zentrum für Angewandte Psychotrauma-
dete Experten in den zugelassenen Heilberufen. In der tologie Wien www.zap-wien.at
Traumatherapie sollen jene wie abgekapselt vorhande- BETTELHEIM, B. et al. (1982) Kinder brauchen Märchen, München:
dtv.
nen traumatischen Erlebnisfragmente in kontrollierter
DILLING H., MOMBOUR W. & SCHMIDT M. H. (2005). Internationale
und „portionierter“ Form der Verarbeitung zugänglich Klassifikation psychischer Störungen ICD 10. Huber. Bern.
gemacht werden. DRIESSEN, M., BEBLO, T., REDDEMANN, L. et al. (2002) Ist die Bor-
Dazu ist es notwendig, in der ersten Phase der Sta- derline-Persönlichkeitsstörung eine komplexe posttraumatische
bilisierung eine Minimalkontrolle über die inneren Vor- Störung. Zum Stand der Forschung, Nevernarzt, 73, 820-829.
EHLERS, A. (1999) Posttraumatische Belastungsstörung. Verhaltens-
gänge wiederzuerlangen. Das geschieht durch gezielte
therapeutische Behandlungsansätze. Göttingen: Hofgrefe.
körperliche, kognitive und imaginative Übungen. Ziel FISCHER, G. & RIEDESSER, P. (2003) Lehrbuch der Psychotraumatolo-
ist die Wiederermächtigung über das eigene Innenleben gie. München, Basel: Reinhardt Verlag.
und die Überwindung des Gefühls der Ausgeliefertheit HERMAN, J., (2003) Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen
an intrusive Symptome. verstehen und überwinden, Paderborn: Junfermann.
HOFMANN, A. (2006) EMDR in der Behandlung posttraumatischer Be-
In der Phase der Konfrontation mit den Extrem-
lastungssyndrome. Stuttgart, New York: Thieme.
stresssituationen und Erlebnissen werden einzelne re- HÖRMANN, R., MÜNKER-KRAMER, E. (2003) Expertinnenbeitrag
präsentative Erlebnisse von Extremstress aus der Trau- – PsychoSoziales Akutteam NÖ Kooperation Sozialarbeit – Not-
mageschichte wiederholt in sehr standardisierter und fallpsychologie – Hochwasser August 2002. In: G. Pantucek (Hrsg.),
kontrollierter Weise bearbeitet. Es erfolgt aus dem stabi- Hochwasser 2002 – eine Text- und Bilderchronik (S. 127-131). Wien:
Holzhausen Druck und Medien.
lisierten Zustand heraus eine schrittweise Konfrontation
HUBER, M. (2003a) Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabe-
und fraktionierte Begegnung mit Bildern, Gefühlen und handlung, Teil I., Paderborn: Junfermann.
kognitiven Leitsätzen aus der individuellen „Psychotrau- HUBER, M. (2003b): Wege der Traumabehandlung. Trauma und Trauma-
mageschichte“. behandlung, Teil II., Paderborn: Junfermann.
Es wurden hierfür in den letzten Jahren verschiedene LASOGGA, F. & GASCH, B. (2006). Das Akutteam Niederösterreich. Eva-
luation. Unveröffentlichter Abschlussbericht.
Techniken auf der Basis verhaltenstherapeutischer, hyp-
LASOGGA, F. & GASCH, B. (2006). Psychische Erste Hilfe bei Unfällen.
notherapeutischer (Screentechnik) und psychodynami- Edewecht: Stumpf und Kossendey.
scher (PITT) Ansätze heraus entwickelt. Mit EMDR steht LASOGGA, F. & GASCH, B. (2007). Notfallpsychologie. Wien, New York:
hier auch eine neu entwickelte Technik zur Verfügung Springer.
(hierzu Genaueres www.emdr-institut.at, www.emdr- LASOGGA, F. & MÜNKER-KRAMER (2009). Psychosoziale Notfallhilfe.
Edewecht: Stumpf und Kossendey.
netzwerk.at, Münker-Kramer, Hofmann & Wintersperger,
LAZARUS, R. & FOLKMAN, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New
2008, Hofmann, 2005). York: Springer.
Dieser Prozess, naturgemäß auch begleitet von Trauer, MITCHELL, J. & EVERLY, G. (1998). Streßbearbeitung nach belastenden
führt in die vierte Phase, die Phase von Trauer und Neu- Ereignissen. Edewecht: Stumpf und Kossendey.
orientierung. MÜNKER-KRAMER, E. & LASOGGA, F. (2008). Das PsychoSoziale Akut-
team Niederösterreich. In F. Lasogga & B. Gasch (Hrsg.), Notfallpsy-
Zusammenfassend geben Fischer und Riedesser
chologie (S. 243-266). Wien, New York: Springer.
(1998) eine klinische und pragmatische Definition von MÜNKER-KRAMER, E. & LASOGGA, F. (2009). Psychosoziale Notfall-
erfolgreicher Behandlung/Integration und schließen hilfe. Edewecht: Stumpf und Kossendey.
inhaltlich damit durchaus an die neuropsychologische MÜNKER-KRAMER, E. (2003). Disaster and Crisis Psychology and So-
Forschung an (z.B. Broca-Areal-Wiederermächtigung). cial Work – a cooperation model. Vortrag beim 7. Europäischen Psy-
chologenkongress in Wien (7.7.2003), Österreich.
„Personen, die ihre traumatischen Erfahrungen erfolg-
MÜNKER-KRAMER, E. (2006). F.43.0 (ABR) und F.43.1 (PTBS) – Grund-
reich durchgearbeitet haben, sprechen mit adäquatem lagen, Diagnostik, Behandlungsansätze. In: W. Beiglböck, S. Fesel-
Affekt von den Erlebnissen und sind in der Lage, einen mayer & E. Honemann (Hrsg.), Handbuch klinisch-psychologischer
vollständigen Bericht zu geben.“ Behandlung (S. 293-322). Wien, New York: Springer.
Hier wird eine klinische Beschreibung davon gegeben, MÜNKER-KRAMER, E., HOFMANN, A. & WINTERSPERGER, S. (2007).
Zum Verständnis von EMDR als Behandlungsmethode für PTSD auf
wie es aussehen kann, wenn neben den dysfunktionalen
dem Hintergrund der modernen Psychotraumatologie. Psychologie
Gedanken, den Gefühlen und dem Verhalten auch der in Österreich, 27(1), 53-60.
toxische Stress erfolgreich reguliert werden kann. Das ROTHSCHILD, B. (2002). Der Körper erinnert sich. Die Psychophysiolo-
ist Integration und das Ziel jeder Begleitung, Betreuung, gie des Traumas und der Traumabehandlung. Essen: Synthesis.
Behandlung und Therapie in diesem Bereich. SELYE, H. (1976). Stress in health and disease. Reading: Butterworth.
SENDERA, A. (2005). Skills-training bei Borderline und Posttraumati-
scher Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.
SHAPIRO, F. (2005). EMDR – Grundlagen und Praxis. Handbuch zur Be-
handlung traumatisierter Menschen (2. Auflage). Paderborn: Jun-
fermann.
Psychologie in Österreich 1 | 2009 61Eva Münker-Kramer
Eustress – Distress – Extremstress/traumatischer Stress – und was dann?…
VAN der KOLK B. A., PELCOVITZ D., ROTH S., MANDEL F. S., McFAR- Autorin
LANE A. & HERMAN J. L. (1996). Dissociation, somatization, and
affect dysregulation: the complexity of adaptation of trauma. Ame-
Mag. Eva Münker-Kramer
rican Journal of Psychiatry, 153, 83-93.
geb. 1961, Klinische- und Gesundheits-
VAN der KOLK, B. (1997). The psychobiology of posttraumatic stress
psychologin, Notfallpsychologin,
disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 16-24.
Psychotherapeutin (VT, EMDR, Traumatherapie)
VAN der KOLK, B. (2007). Traumatic Stress. New York, London: Guild-
in eigener Praxis in Krems/D., EMDR Super-
ford.
visorin und Facilitatorin am EMDR Institut
YEHUDA, R. Halligan, S. L. & Bierer, L. M. (2001) Relationship of parental
Deutschland und Austria, Miteigentümerin
trauma exposure and PTSD to PTSD, depressive and anxiety disor-
des EMDR Institutes Austria und Zentrum für
ders in offspring. Journal of Psychiatric Research, 35, 261-270
Angewandte Psychotraumatologie Wien (www.emdr.institut.at, www.
zap-wien.at), Vorsitzende der österr. Fachgesellschaft EMDR-Netzwerk
Außerdem: Trauma – Tagungsband NÖ Kinder –und Jugendanwaltschaft, Österreich und österr. Vertreterin bei EMDR Europe, Mitgründerin
13.6.2006, erhältlich noch in begrenzter Anzahl über post@kija.noel. des PsychoSozialen Akutteams NÖ und Mitglied der Leitung
gv.at, mit Beiträgen von Lutz Besser, Eva Münker-Kramer, Petra Rau, 2001-2008, Mitgründerin des NDÖ und Vorsitzende 2000-2003,
Sylvia Wintersperger Mitglied der Arbeitsgruppe Akuttrauma der DeGPT (www.degpt.de),
Vortrags-, Seminartätigkeit, Supervision und Publikationen u.a. im
Bereich der Psychotraumatologie und traumaspezifischen
Psychotherapie, psychosozialen Notfallhilfe
muenker-kramer@zap-wien.at
62 Psychologie in Österreich 1 | 2009Sie können auch lesen