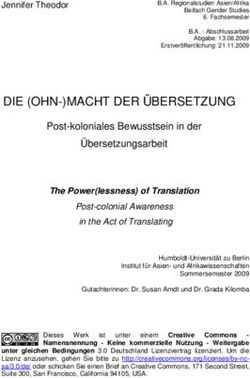François Villon und Charles Baudelaire - zwei verfemte Dichter
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
(Frank-Rutger Hausmann, Freiburg i.Br.)
Als verfemte Dichter (franz. poètes maudits) bezeichnet man seit Paul Verlaines
gleichnamigem Buch von 1884 alle Dichter, die als gesellschaftliche Außenseiter in ihren
Werken das Wertesystem der jeweils herrschenden Gesellschaft in Frage stellen und
deswegen gebrandmarkt und verfolgt werden. Sie legen sich dabei eine
nonkonformistische Biographie zu oder verstärken vorhandene Elemente, die ihr
Außenseitersein verdeutlichen und ihre dichterischen Provokationen legitimieren sollen. In
meinem Vortrag sollen zwei dieser Dichter aus unterschiedlichen Jahrhunderten zum
Sprechen gebracht werden: François Villon (15. Jhdt.) und Charles Baudelaire (1821-
1867). Villon ist vor allem durch seine beiden Gedichtsammlungen Das Kleine und Das
Große Testament bekannt geworden, in denen er namentlich benannten Zeitgenossen
wertlose Dinge hinterläßt, die ihre Schwächen in geistreicher Form bloßlegen. Baudelaire
wird als Dichter der Fleurs du mal (1857) vorgestellt, einer sechsteiligen Sammlung von
100 Gedichten, in denen er eine Poetik des Häßlichen entwirft und die dunklen Seiten des
Lebens aufdeckt. Von beiden Dichtern werden zwei Texte exemplarisch behandelt. Dabei
werden grundsätzliche Überlegungen zur Lyrikinterpretation und zum literarischen
Übersetzen mitgeteilt.
Beginnen wir mit Fragen der Lyrikinterpretation allgemein, wobei das, was hier gesagt
wird, vor allem für die Literatur bis etwa 1950 gilt: Wenn wir von Lyrik oder Gedichten
sprechen, denken wir zunächst an Liebesdichtung, in die häufig die Natur mit
einbezogen wird. Lyrik ist eine der sog. drei abendländischen Großgattungen (Epik,
Dramatik, Lyrik). In Europa finden wir die frühesten Zeugnisse der volkssprachlichen
Liebeslyrik im 11. Jhdt. in altprovenzalischer (okzitanischer) Sprache, danach sind die
Italiener, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer, die Spanier, die Portugiesen die
bedeutendsten Lyriker, doch gibt es Liebesgedichte in allen europäischen Sprachen, auch
des Ostens und Nordens. Die außereuropäische Lyrik folgt anderen Gesetzen. Liebeslyrik
ist niemals sexuell konnotiert, kennt keinen Liebesvollzug, sondern ist rein spirituell (sog.
Neuplatonismus). Der Liebende soll durch die geistige Liebe veredelt werden.
Neben der Liebeslyrik, der sog. Hohen Dichtung, in der meist in neuplatonischer
Ausrichtung die mit der veredelnden Liebe zu einer schöne edlen Frau
zusammenhängenden Stimmungen und Gefühle besungen werden, gibt es noch die sog.
Gelegenheitslyrik, die einem bestimmten Anlaß geschuldet ist (Geburtags-, Hochzeits-,
Todes-, Festtage, Krieg und Frieden, Alltagsleben etc.) oder eine Person des öffentlichen
Lebens feiert (Widmungslyrik).
Wiederum anders und lange Zeit geringgeschätzt ist eine weit verbreitete komisch-
satirische Dichtung, die das Häßliche, Normabweichende hervorhebt und
gesellschaftskritisch gemeint ist. Sie will provozieren, sie spart Sexualität, Derbheit,
Gotteslästerung usw. nicht aus. „Komisch” meint hier nicht etwa lustig, sondern ist eine
Stilfrage. Die ältere Literatur kannte einen hohen, mittleren und niederen Stil. Die komische
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
1Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Dichtung gehört zur niederen Stillage und darf Dinge ausdrücken und sich dabei
umgangssprachlicher Elemente bedienen, die der hohen Lyrik verwehrt sind. Für den
heutigen Abend wurden zwei Autoren aus diesem Bereich ausgewählt.
Lyrik hat gegenüber Epik und Dramatik den Vorteil, in sich abgeschlossene Texte zu
präsentieren, die bündigere Aussagen ermöglichen. Im vorliegenden Fall gilt das in
höherem Maße für Baudelaire als für Villon, wenngleich die Strophe, die aus Villons
Kleinem Testament ausgesucht wurdee, gemeinsam mit zwei anderen nachfolgenden
Strophen, die aus Zeitgründen fortgelassen wurden, ebenfalls eine Einheit bildet, denn das
Kleine Testament setzt sich aus einer ganzen Reihe derartiger Einheiten zusammen.
Lyrik wurde ursprünglich immer in gebundener Form verfaßt, d.h. jede Zeile hat ein festes
Metrum bzw. nach festen gesetzen wechselnde Metren (Versmaß), auch sind die Zeilen
zu regelmäßig gebauten Strophen zusammengefügt, die eine bestimmte Zeilenzahl und
ein festes Reimschema aufweisen. Heutige Lyrik ist meist „frei”, der Unterschied zur Prosa
nicht immer erkennbar. Die ältere Literatur unterschied streng zwischen Prosa und Reim,
Alltagssprache und lyrischem Sprechen. Reim und Strophe erleichtern nicht nur den
Vortrag und das Auswendiglernen, sie geben auch ein höheres Stilniveau vor. Die
metrischen Dichtungstechniken gelten allen hohen Gattungen (Drama, Epos und Lyrik), da
deren Inhalte sich von der Alltagsprosa unterscheiden sollen. Ein satirisch-komischer
Dichter begeht also bereits mit der Wahl von Reim und Strophe einen ersten Tabubruch.
Bei Villon handelt es sich um Achtsilber (franz. Octosyllabes) mit dem 8-zeiligen
Reimschema ababbcbc (sog. Huitains), ein im Mittelalter sehr verbreitetes
Strophenschema. Im Falle von Baudelaire haben wir paarweise gereimte Alexandriner
(12silber), die paarweise (sog. rimes plates) nach dem Schema aa, bb, cc …gereimt sind.
Sie wechseln sich mit dem immer gleichen Reim (misère) ab. Dadurch entsteht eine
gewollte Monotonie, gewollt deshalb, weil der Text sich als Litanei erweist. Eine Litanei ist
ein gemeinschaftliches Gebet, wobei der Vorbeter (Priester) die Passagen der Anbetung
skandiert und der Gemeinde die (hier einzeilige) stets gleichleutende Fürbitte überläßt. Es
fällt unmittelbar auf, daß es sich bei beiden ausgewählten Texten um Parodien handelt.
Das bedeutet, daß erkennbare Formen aufgenommen, aber dem Sinne nach in ihr
Gegenteil verkehrt werden. Im Fall Baudelaires ist dies leicht zu erkennen, denn nicht, wie
sonst in der christlichen Liturgie üblich, Gott oder die Heiligen werden angebetet, sondern
Satan. Die „Satanslitanei” ist also nicht nur Parodie des Kyrie eileison („Gott, erbarme
Dich”,vgl. Psalm 50 / 51) und des Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe”), sondern
zugleich Blasphemie, einer „schwarzen Messe” nicht unähnlich. Im Falle Villons ist die
Parodie für den Ungeübten nicht ganz so leicht zu verstehen. Es handelt sich um ein
fiktives Testament, parodiert wird also ein ursprünglich juristischer Text, der stets
formelhaft abgefaßt werden muß. In einem Testament hinterläßt ein Erblasser einem
Erben ein bestimmtes Gut (Erbe). Testamente bedürfen der Schriftform. Hier vermacht das
lyrische Ich, das wir mit Villon gleichsetzen dürfen, einem gewissen Robert Valee, der
selber am Gericht tätig ist, seine Hosen. Auf den Sinn und die Bedeutung dieser
Strophe(n) werden wir noch zu sprechen kommen, doch ist sofort zu vermuten, daß es
sich um ein eher ambivalentes Erbe handelt.
Lyrik ist häufig, wenngleich nicht immer, in der Ich-Form verfaßt. (bei Villon durchgehend;
bei Baudelaire tritt das Ich nur als kollektives Ich im Wiederholungsteil auf). Man hat in
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
2Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
früheren Zeiten das lyrische mit dem (auto-)biographischen Ich gleichgesetzt, was, wie
wir heute wissen, ein Trugschluß ist. Zwar verarbeitet ein Lyriker (wie andere Dichter und
Schriftsteller auch) durchaus persönliche Erfahrungen, aber er verändert sie, stilisiert
sie, spitzt sie zu und erfindet Neues hinzu. Anders wäre kaum der gewünschte Effekt der
Allgemeingültigkeit und des Nachvollzugs zu erzielen.
Wir halten also fest: beide Dichter bedienen sich in ihren Parodien bekannter Formen
(Testament, Litanei), die im Rechtswesen bzw. der christlichen Liturgie oder Theologie,
einen wichtigen Platz einnehmen. Sie verwenden sie jedoch in verzerrender oder
verkehrender Absicht, denn, wie zu zeigen sein wird, das Hinterlassene bringt dem Erben
keinen wirklichen Gewinn, und es werden nicht Gott und seine Heiligen angebetet,
sondern ihr Widerpart, Satan, der Herr der Mächte der Finsternis.
Wir wollen dies zum Anlaß nehmen, um ein paar knappe biographische Hinweise über
beiden Dichter mitzuteilen, ohne einem allzu großen Biographismus zu frönen: François
Villon ist eine nicht exakt zu fassende Dichterpersönlichkeit des Spätmittelalters. Villon ist
vermutlich der Name des Adoptivvaters des Dichters, eines Klerikers und Juristen mit
Namen Guillaume Villon. Unser Poet wird auch gelegentlich François de Montcorbier oder
François des Loges genannt, hat also mindestens drei ganz verschiedene Namen oder
Aliasnamen, was hellhörig machen sollte. Er ist vermutlich 1431 geboren, nach 1463
verlieren sich seine Spuren. Meine These ist, daß es sich bei ihm um eine „Ich-Figur”
handelt. Was heißt das? Es hat sicherlich einen Kleriker gegeben, der sich François Villon
nannte, vielleicht auch dichtete, aber er ist als Person nicht wirklich zu fassen, vermutlich
weil er als Krimineller (poète truand) seine Spuren verwischte. Er hat in Paris gelebt, hat
studiert, sein Studium nicht beendet, ist dann auf die schiefe Bahn geraten (Einbruch,
Totschlag), flieht aus Paris, kehrt zurück, wird inhaftiert, zum Tode verurteilt, begnadigt,
aber aus der Stadt verbannt. Seine Spuren verlieren sich. Das alles läßt sich mit viel Mühe
aus zeitgenössischen Dokumenten, vor allem aber aus den Dichtungen selber,
herauslesen. Wir haben hier einen interessanten Fall eines sog. Zirkelschlusses. Aus
dem dichterischen Werk in Ich-Form, das, wie wir zuvor sagten, nicht durchgehend mit so
stattgefundenen Erlebnissen identisch gesetzt werden sollte, wird eine Biographie
konstruiert, die wiederum dazu dient, das Werk zu deuten. Es ist hier keine Zeit, auf die
zahlreichen Anlehnungen in den Texten Villons einzugehen, die auf keinen Fall
persönlichem Erleben entstammen (können), sondern dichterischem Usus und
dichterischen Techniken zuzurechnen sind. Möglich und wahrscheinlicher ist, daß sich
jemand (man hat auf ein Mitglied der Basoche, der Pariser Juristenzunft getippt) des
Namens des notorischen Tunichguts François Villon, oder wie er auch immer hieß,
bedient hat, um unter seinem Namen ungestraft provokative Dichtungen zu veröffentlichen
oder zunächst in eingeweihten Pariser Kreisen zirkulieren zu lassen, und dies aus zwei
Gründen: die Dichtungen unter Villons Namen können eine höhere Authentizität
beanspruchen (biographischer Platonismus), zum anderen genießt ein Villon als
Verbrecher keinen Persönlichkeitsschutz. Dies erlaubt es dem wahren Dichter, sich an
verschiedenen sozialen Gruppen (Juristen, Kaufleute, Universitätsprofessoren,
Klerus) kritisch „abzuarbeiten”. Es muß allerdings daran erinnert werden, daß die sog.
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
3Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Ständesatire, die Verspottung von bestimmten Berufsgruppen, eine bis in die Antike
zurückreichende Traditon aufweist. Halten wir fest: Villon ist gebildet, in mehreren Pariser
Milieus zu Hause, kennt aber auch das Leben in der Provinz, und hat als Krimineller nichts
mehr zu verlieren.
Charles Baudelaire ist aus anderen Gründen ein sozial Gescheiterter. Er ist dies zwar
auch in der Realität, aber er hat diese Elemente kultiviert: Er litt unter dem frühen Tod
seines Vaters, der autoritären Behandlung durch seinen Stiefvater, einen späteren General
mit Namen Jacques Aupick, er war ein Schul-, und als er das Bac als Externer doch noch
erreicht hatte, auch Studienabbrecher (Jura), er konnte nicht mit Geld umgehen, zumal er
eine Zeitlang das kostspielige Leben eines Dandy führte, wurde unter Vormundschaft
gestellt, nahm Drogen, konsumierte Alkohol, hatte wechselnde Geliebte, manchmal
mehrere auf einmal, erkrankte an der Siphylis, nahm als Sozialist an der 48er Revolution
teil, alles Fakten, die sein nach bürgerlichen Maßstäben zu konstatierendes
Außenseitertum unterstreichen, aber von ihm überbetont wurden. Seine 1857
erschienene Gedichtsammlung Les fleurs du mal gehört längst zur Weltliteratur und zu
den bleibenden Leistungen der französischen Lyrik. Wenn die Schlüsselworte „Finsternis,
Abgrund, Angst, Öde, Wüste, Gefängnis, Kälte, schwarz, faulig” lauten, so verwundert das
angesichts seiner Biographie nicht. Einige Gedichte, u.a. das für heute Abend
ausgewählte, führten jedoch dazu, daß der Verleger (Auguste Poulet-Malassis)
gemeinsam mit dem Autor in einen Strafprozeß (sog. Immoralismusprozeß) wegen
„Beleidigung der öffentlichen Moral” verwickelt und jeder zu einer Geldstafe verurteilt
wurden. Die Parallelen zwischen unseren beiden Dichtern sind, bei allen Unterschieden,
unübersehbar.
Werfen wir noch einen Blick auf die Werke, aus denen die hier zur Diskussion stehenden
Texte bezogen wurden. Das Kleine Testament (auch: Lais oder Legs, Petit Testament)
ist ein um 1456 verfaßter Text mit 40 Strophen (Huitains). In Parodie eines Testaments
hinterläßt der Scholar oder Kleriker François Villon einer Gruppe von unterschiedlichen
Personen sein Hab und Gut. Anlaß des Testierens (Testamentverfassens) ist im
Unterschied zum Großen Testament nicht der nahende Tod, der dort mit allen physischen
Details beschrieben wird, sondern die Flucht aus Paris, für die der Dichter als Grund eine
unglückliche Liebe angibt (martyr d‘Amors / Liebesmärtyrer). Allerdings könnte ein von
ihm mit Spießgesellen begangener Einbruch im Collège de Navarre und die Angst vor
Verfolgung einen noch wichtigeren Grund für die Flucht darstellen. Schaut man die Legate
(Erbstücke) näher an, die der Kriminelle und Habenichts hinterläßt, so stellt sich deren
Wertlosigkeit erst bei näherem Hinblicken heraus, da sie zunächst den Eindruck von
etwas Wertvollem, aus dem Besitz eines Aristokraten oder Ritters Stammendem
erwecken: Villon vermacht zuerst seine „Ehre” und seinen „guten Namen” (die er als
Verbrecher gar nicht hat), dann seine ritterliche Ausrüstung (Kleidung, Zelte, Waffen,
Reitpferd, die er als Kleinkrimineller ohne festen Wohnsitz ebenfalls nicht besitzt oder die
schäbig und unbrauchbar sind), kurz, den Besitz und die Jagdutensilien eines
vermeintlichen Edelmannes. Die Auflistung der Erbstücke und Hinterlassenschaften bildet
eine schlüssige kohärente Sequenz, wobei der Witz darin besteht, daß Villon nur
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
4Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Wertloses hinterlassen kann und hinterläßt, aber so tut, als ob es sich um etwas
Wertvolles handele. Die Erben sind entweder wohlhabende Pariser Bürger, bei denen er
womöglich Schulden hatte, vor allem aber Vertreter der Pariser Justiz (Anwälte,
Polizeibeamte, Untersuchungsrichter, Notare, Gefangenenwärter), deren Weg er gekreuzt
hat und die damals stadtbekannt waren. Den Schluß der Verrmächtnisse bilden, wie sich
das für einen guten Christen gehört, Legate für die Bettler und Armen, die Kranken in den
Spitälern, die Bettelmönche, die Studenten, die Gefängnisinsassen, aber auch kleine
Handwerker (Barbier, Schuster, Höker) in bescheidenen Verhältnissen. Der wahre Sinn
der Legate erschließt sich allerdings erst, wenn man sie in Bezug zu dem Eigennamen,
dem Beruf, den körperlichen Gebrechen und Lastern der Bedachten in Beziehung
setzt.
Kommen wir zu unserem Textbeispiel: In Strophe XIII des Kleinen Testaments wird ein
„maistre Robert Valee” bedacht. Maistre ist auch heute noch ein juristischer Titel für den
Anwalt. Valee war selber nachweislich Anwalt und gehörte einer Juristenfamilie an.
Vielleicht war er ein Studiengenosse Villons, vielleicht auch hatte er von ihm einen Dienst
oder eine Gefälligkeit erbeten und nicht erhalten. Die Kohärenz der Strophe erschließt sich
allerdings erst, wenn man den Eigennamen Valee einer interpretatio nominis
(Namensdeutung) unterzieht. Dies ist ein rhetorisches Verfahren, bei dem man den
Eigennamen „ernst nimmt” oder re-etymologisiert. Valee heißt bekanntlich so viel wie
(tiefes) Tal. Der Anwalt Valee wird nun antiphrastisch zum „povre clergon en Parlement”
gemacht, dem (geistig) armen Parlamentsschreiberlein, das den Unterschied zwischen
Berg (mont) und Tal (valee), gemeint ist zwischen Oben und Unten, Hoch und Tief, nicht
kennt (Parlement / Gerichtshof wird damals wie par le mont gesprochen, was an die
Redewendung „über Berg und Tal”, „par mont et vaux, valées” erinnert). Valee ist entweder
zu beschränkt oder übergescheit. Villon vermacht ihm seine brayes, seine „kurzen Hosen”,
ein damals übliches Kleidungsstück, das auch unter der Ritterrüstung getragen wurde. Sie
sind allerdings nicht frei verfügbar, sondern befinden sich „aux Trumillieres”, im Gasthaus
„Zu den Beinschienen”. Die Beinschienen sind ebenfalls ein wichtiges Teil der eisernen
Ritterrüstung. Ein erster Gag besteht darin, daß man die Zeile auch übersetzen kann: „Die
vor den Beinschienen hängen”, denn die Hosen wurden (wozu wohl ?) heruntergelassen.
Damit ist aber wieder der Bereich des Unten (valee) angesprochen. Was soll der Erbe nun
damit anfangen? Er soll für eine gewisse Jeanne de Millieres, von der die Forschung
herausgefunden hat, daß am Parlement de Paris ein Prozeß gegen sie anhängig war, sie
also als nicht besonders ehrbar galt, „auf ehrbare Weise eine Haube daraus machen”
(millier heißt bekanntlich Tausende, so als ob gesagt werden sollte, daß Jeanne
Tausenden von Männern angehört habe!). Da die „Haube” die Kopfbedeckung der
Matronen, der verheirateten Frauen, war – damit ist jetzt immer noch der Bereich des
Oben anvisiert - , erklärt sich das honnestement („auf ehrbare Weise”) als Anspielung auf
den Lebenswandel von Valees Freundin Jeanne, die vielleicht seine juristischen Dienste in
Naturalien bezahlte. Oben und Unten könnte damit auch auf die soziale Zugehörigkeit des
Anwalts und der „Dame” (Dirne ?) anspielen. Kenner der mittelalterlichen Novellenliteratur
kennen jedoch auch einen Erzähltyp (er findet sich z.B. bei Boccaccio im Decameron), der
folgende Begebenheit berichtet: Eine strenge Äbtissin hält die ihr unterstellten Nonnen und
Novizinnen zu Keuschheit an und verbietet ihnen jeglichen Umgang mit Männern. Sie
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
5Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
selber hat jedoch einen Geliebten, der Nachts heimlich in ihre Zelle kommt. Eine hübsche
Nonne, der die Äbtissin Vorhaltungen wegen ihres Lebenswandels gemacht hat, kommt ihr
auf die Schliche. Als dich die Äbtissin mit ihrem Liebhaber trifft, klopft sie an die Tür und
ruft, Diebe seien ins Kloster eingedrungen. In aller Eile springt die Äbtissin aus dem
Liebesbett, kleidet sich an, erwischt im Dunkeln jedoch nicht ihre Haube, sondern die
Hose ihres Galans (Lovers), die sie sich als vermeintliche Haube um den Kopf bindet,
wodurch ihre Scheinheiligkeit ans Licht kommt. Last but not least spielt Villon auf das auch
heute noch gebräuchliche Sprichwort an, daß viele Frauen die Hosen anhaben, also die
Männerrolle ausüben, was wieder ein negatives Licht auf Valee werfen würde. Ich hoffe,
daß Sie die Vielschichtigkeit dieser Strophe nachvollziehen können, die dem Villon-Text
(wie seinem ganzen Werk) eine große Dynamik beilegt, denn fast jede Strophe oder jedes
Strophenpaar geht ähnlich vor.
Ohne Kommentar ist der Text kaum zu verstehen, d.h. in seinen Tiefenschichten
nachzuvollziehen. Dies stellt, wie wir noch sehen werden, an den Übersetzer sehr hohe
Anforderungen. Ich habe dieses Beispiel für Sie ausgesucht, weil Sie hier auch erkennen
können, was philologische Arbeit bedeutet bzw. was sie fordert: genaue Sprachkenntnis
(hier des Mittelfranzösischen, das eine Zwischenstellung zwischen Alt- und
Neufranzösisch einnimmt), Vertrautheit mit rhetorischen Figuren und Spielereien (hier
der interpretatio nominis, sodann der Phonetik, die keinen Ausspracheunterschied
zwischen -ment und mont macht, so daß sich Gegenwelten zu dem Eigennamen Valee
auftun, mit denen im weiteren gespielt wird), Vertrautheit mit (spät)mittelalterlicher Literatur
und Kulturgeschichte, Kombinationsvermögen. Bei einer Lyrik-Übersetzung ins Deutsche
sollte der Übersetzer auf den Reim und das entsprechende Versmaß verzichten. Eine
rhythmisierte Übersetzung (festes Rhythmusschema bei Verzicht auf den Reim) erlaubt
eine wesentlich größere Genauigkeit als eine gereimte, zumal das Französische die Silben
zählt, das Deutsche die Hebungen und Senkungen. Auch ist der französische Satzbau, vor
allem wegen der in der älteren Sprache häufigeren Partizipialkonstruktionen, knapper als
der deutsche. Ich habe Ihnen, unbescheiden, meine eigene Version mitgeteilt, die im
letzten Herbst nach 23 Jahren vom Reclam-Verlag erneut aufgelegt wurde, leider ohne
den französischen Text und ohne den ausführlichen Kommentar wie in der Erstausg. 1988
(François Villon, Das Kleine und das Große Testament. Aus dem Französischen übers. mit
einem Nachwort von Frank-Rutger Hausmann, Stuttgart, Reclam, 1988, 2011 [Reclam
Taschenbuch]).
Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Baudelaire-Text, der wesentlich länger, dafür aber
auch gewollt repetitiver und viel einfacher zu verstehen ist als der Villons. Zunächst ein
Wort zur Sammlung Les fleurs du mal. Der Begriff ist antinomisch, wie die deutsche
Übersetzung „Die Blumen des Bösen” verdeutlicht. Mit Blumen assoziieren wir im
allgemeinen etwas Schönes, Farbiges, Freundliches, Wohlriechendes, doch hier sind es
vergiftete Blumen, deren Farbe, Form und Duft nur ihre verderbenbringende Kraft
überdecken sollen. Fleurs ist jedoch auch ein rhetorischer Terminus, den Sie vielleicht von
einem Florileg (griech. Anthologie) kennen und der so viel wie „Sammlung” bedeutet.
Ursprünglich sollte diese Gedichtsammlung Les Limbes (Vorhölle) bzw. Les Lesbiennes
(Die Lesbierinnen) heißen, ohne daß zumindest die zweite Variante Entsprechungen in
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
6Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
den Gedichten findet, sondern offenbar als „Aufreißer” gedacht waren. Zu unserer
Satanslitanei hätten die Limben besonders gut gepaßt.
Die Sammlung gliedert sich in sechs Teile, die wie folgt überschrieben sind: Spleen et
Idéal (Spleen, zu gr. Milz, ist ein anderes Wort für Melancholie, nach älterer Auffassung
eine Voraussetzung für die Sensibilität des Dichters), Tableaux parisiens, Le Vin, Fleurs
du Mal, Révolte, La Mort. Das ergibt eine wohlgefügte Architektur, denn alle diese
Begriffe bedeuten Evasion, d.h. Flucht, ein Entkommen aus der banalen und als
bedrückend empfundenen Alltagswirklichkeit, sei es in die Sphäre der Kunst (Spleen et
Idéal), des Großstadtlebens (Tableaux parisiens), den Rausch (Le Vin), das Böse und
Satanische (Fleurs du Mal), Revolte und Empörung oder Tod. Unser Gedicht gehört zum
Teil der Révolte. Hugo Friedrich spricht in seiner Struktur der modernen Lyrik in diesem
Zusammenhang von „ruinösem Christentum”. Das uns interessierende Gedicht ist
gewollt blasphemisch und parodiert die Messe bzw. das Gebet. Der Teil „La Révolte”
umfaßt übrigens nur drei Gedichte: „Le Reniement de Saint Pierre”, „Abel et Caĩn” und
„Les Litanies”, die alle drei Akte der Empörung beschreiben, wie sie im Alten und Neuen
Testament bezeugt sind.
Satan wird fünfzehnmal angerufen (O Satan, prends pitié de ma longue misère), er solle
Mitleid mit dem Sprecher haben. Satan ist identisch mit Lucifer, dem empörerischen
Engel, der sich zum Herrn des Himmels aufschwingen wollte, den Gott zur Strafe vom
Himmel in die Hölle stürzt und der in der Mythologie mit dem Morgenstern (Venus)
identisch gesetzt wird (Jes. 14.1215: Ez. 28,14; Off 12, 3f. u.a.). Der „gefallene Engel”
wird seit Milton (Paradise lost) zu einem Lieblingsthema der Romantik, denken Sie z.B. an
E.T.A. Hoffmanns Elixire des Teufels und zahlreiche andere Text. Auch wenn er gestürzt
worden ist, gibt er nicht auf, sondern errichtet ein Gegenreich. Er ist also Symbol eines
unbändigen Behauptungswillens. Aber wenn der Dichter nicht mehr Gott, sondern
Satan anruft, ist dies zugleich Zeichen von Gottes Ohnmacht und Ausdruck einer
entgotteten Welt, womit die herkömmlichen Werte umgekehrt werden. In Baudelaires
Gedicht ist Satan nicht nur klug und schön, er ist trotz seiner Vertreibung auch stark, reich,
Herr im Erdreich verborgener Schätze, Alchemist, Magier, Wunderheiler, Schutzherr der
Verbrecher und aller Verdammten. Er verleiht Zugang zum höchsten Weltwissen und
damit zugleich zum irdischen Paradies. Der Tabubruch, den sich Baudelaire mit diesem
Gedicht (und den beiden anderen von La Révolte) leistet, ist gewollt, der Text schreibt die
Bibel um und verkehrt ihre Botschaft ins Gegenteil. Baudelaire hat nie offiziell mit der
Kirche gebrochen, und wenn er Satan vor dem Hintergrund der Bibel preist, erkennt er, so
mag man schließen, damit gleichzeitig Gott und die christliche Heilsbotschaft an. Wir
können und müssen sein Gedicht jedoch als einen Angriff auf seine Zeit deuten, die
autoritären Anfangsjahre der Herrschaft Napoleons III., die vom Bündnis zwischen Thron
und Altar, Kaisertum und Katholischer Kirche, getragen wurde, Zustände, die sich erst um
1860 liberalisierten. Baudelaire (und sein Zeitgenosse Rimbaud) prägen den Slogan des
„épater le(s) bourgeois”, des Schockierens und Aufschreckens der Bürger aus ihrer
behäbigen Ruhe.
Der Baudelaire-Text wird übrigens von der griechischen Heavy-Metal-Band Negromantia
in englischer Sprache „gesungen”. Eine „romantischere” Version stammt von dem
Gitarristen Clément Berthié, eine von mehreren gesanglichen Versionen, die gegenwärtig
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
7Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
auf dem Markt sind. Der Satanismus hat vor allem in der heutigen Sub- und Gothik-
Kultur Anhänger. Auch hier ist er eher provokativ als (anti-)religiös gemeint.
Die deutsche Übersetzung der Litanies, die ich Ihnen vorgelegt habe, stammt von dem
bekannten Baudelaire-Übersetzer Friedhelm Kemp (1914-2011), der vor allem
französische Lyrik übertragen hat. Kemp hatte 1939 in München über Baudelaire
promoviert und gilt als profilierter Baudelaire-Übersetzer, der nicht reimt, sondern textnah,
fast interlinear, übersetzt.
Zusammenfassung: Was haben wir gelernt aus der Interpretation und dem Vergleich
zweier so zeitverschiedener Autoren? Zunächst einmal, Dichtung, zumal ältere, muß
gedeutet werden. Man mag sie zwar still genießen, aber der Genuß wird umso größer, je
besser man sie versteht. Allerdings gibt es nicht das Verstehen an sich, sondern stets
sind mehrere Deutungen möglich. Die beiden, die ich Ihnen vorgetragen habe, stützen
sich auf eine lange Beschäftigung mit älterer Literatur, woraus sich die Hoffnung, ja die
Sicherheit ergibt, Ihnen etwas Probables und damit Nachvollziehbares vorgetragen zu
haben. Bei älterer Lyrik wie den Texten der heute besprochenen Dichter ist die
kommunikative Kraft der Sprache noch sehr stark, der Dichter will den Lesern noch
etwas „sagen”, um auf einen vielzitierten Satz der angeblichen Studienratsrhetorik zu
antworten („Was will der Dichter damit sagen?”). Es geht beiden nicht nur um die
Suggestion tönender Wortfolgen. Deutungen gelten aufgrund der Überzeitlichkeit der
Dichtung nicht für immer und ewig; jede Zeit liest Texte anders, aber es gibt, was das Werk
bedeutender älterer Dichter angeht, einen gewissen Grundkonsens. Was nun Villon und
Baudelaire betrifft, so läßt sich festhalten: Ihre Werke sind parodistisch, z.T. sogar
spielerisch, und gehören damit in den Bereich der häufig nach Inhalt und Gewicht
unterschätzten komisch-satirischen Dichtung, die Ausdruck des Protests und der
Provokation ist. Das Genus als solches ist überzeitlich, ist nicht orignell, sondern hat Teil
an einer langen Entwicklung; der Inhalt ist jedoch zeit- und ortsgebunden oder
zeitabhängig. Die jeweilige Originalität besteht also darin, wie der Dichter sein „Anliegen”
umsetzt und ob es ihm gelingt, die Gesellschaft, die er hinterfragt, zu verändern, aber
auch darin, wie einmal gefundene Formen weiterentwickelt und gesteigert werden. Die
harschen Reaktionen der Zeitgenossen auf die Werke beider Dichter bezeugen, daß sie
diese ins Mark getroffen haben. Abschließend möchte sei betont, daß das Verständnis
dieser und vieler anderer lyrischer Werke an Bildung gebunden ist und durch
Lektüreerfahrung erleichtert und verbessert wird.
Die beiden näher besprochenen Gedichte sind:
François Villon, Le lais Str. XIII
Et a maistre Robert Valee,
Povre clergot en Parlement,
Qui n'entend ne mont ne valee,
J'ordonne principalement
Qu'on luy baille legierement
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
8Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Mes brayes, estans aux Trumillieres,
Pour coyffer plus honnestement
S'amye Jehanne de Milliers.
Dem Anwalt, Herrn Robert Valee,
dem armen Schreiber beim Gericht
- was Berg, was Tal ist, weiß er nicht -,
bestimme ich als Hauptlegat,
daß man‘s ihm unverzüglich gibt,
die Hose, die Zum Beinschutz ist,
damit er draus Jeanne de Millieres
recht ehrbar eine Haube macht.
Charles Baudelaire, „Les Litanies de Satan” (aus: Les Fleurs du Mal, Révolte)
O toi, le plus savant et le plus beau des Anges,
Dieu trahi par le sort et privé de louanges,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
O Prince de l'exil, à qui l'on a fait du tort,
Et qui, vaincu, toujours te redresses plus fort,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines,
Guérisseur familier des angoisses humaines,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits,
Enseignes par l'amour le goût du Paradis.
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
O toi qui de la mort, ta vieille et forte amante,
Engendras l'Espérance, - une folle charmante!
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut
Qui damne tout un peuple autour d'un échafaud,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
9Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Toi qui sais en quels coins des terres envieuses
Le Dieu jaloux cacha les pierres précieuses,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux
Où dort enseveli le peuple des métaux,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi dont la large main cache les précipices
Au somnambule errant au bord des édifices,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui, magiquement, assouplis les vieux os
De l'ivrogne attardé foulé par les chevaux,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre,
Nous appris à mêler le salpêtre et le soufre,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui poses ta marque, ô complice subtil,
Sur le front du Crésus impitoyable et vil,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles
Le culte de la plaie et l'amour des guenilles,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Bâton des exilés, lampe des inventeurs,
Confesseur des pendus et des conspirateurs,
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère
Du paradis terrestre a chassés Dieu le Père,
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
10Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
O Satan, prends pitié de ma longue misère!
PRIÈRE
Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs
Du Ciel, où tu régnas, et dans les profondeurs
De l'Enfer, où, vaincu, tu rêves en silence!
Fais que mon âme un jour, sous l'Arbre de Science,
Près de toi se repose, à l'heure où sur ton front
Comme un Temple nouveau ses rameaux s'épandront!
DIE SATANSLITANEIEN
Übersetzung von Friedhelm Kempf
O du, der klügste und schönste DER Engel, Gott, vom Schicksal
verraten und der Lobpreisungen beraubt,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
O Fürst in der Verbannung, dem man Unrecht tat und der be-
siegt sich stärker stets erhebt,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du Allwissender, König der unterirdischen Dinge, ver-
trauter Heiler der menschlichen Ängste,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der du aus Liebe selbst die Aussätzigen, die verfluchten Pa-
rias die Lust des Paradieses kennen lehrst,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
O du, der mit demTode, deiner alten und starken Liebsten, du
die Hoffnung zeugtest – eine liebenswerte Närrin!
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der du dem Geächteten jenen gelassenen und hohen Blick
verleihst, der ein ganzes Volk rings um das Blutgerüst verdammt,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
11Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
Du, der du weißt, in welchen Winkeln neidischer Erde Gott eifer-
süchtig die Edelsteine verbarg,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, dessen helles Auge die tiefen Arsenale kennt, in denen be-
graben das Volk der Metalle schlummert,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, dessen breite Hand dem Schlafwandler die Abgründe ver-
deckt hält, der am Rand der Dächter irrt,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der mit Zauberkraft die alten Knochen des verspäteten Be-
trunknen schmeidigt, über den die Pferde trampeln,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der den schwachen Menschen, der da leidet, zu trösten
uns das Gemisch von Schwefel und Salpeter lehrtest,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der du dein Siegel, listiger Komplize, dem unbarmerzig
schönden Krösus auf die Stirne drücktest,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Du, der du den Dirnen in die Augen und ins Herz den Kult der
Wunde und die Liebe zu den Fetzen gabst,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Stab der Verdammten, Lampe der Erfinder, Beichtiger der Ge-
henkten und der Verschwörer,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Wahlvater jener, die in seinem schwarzen Zorn Gottvater aus
dem irdischen Paradies verjagt hat,
O Satan, erbarme meines Langen Elends dich!
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
12Frank-Rutger Hausmann: François Villon und Charles Baudelaire – zwei verfemte Dichter
GEBET
Ehre und Lob dir, Satan, in den Höhen des Himmels, wo du
herrschtest; und in den Tiefen der Hölle, wo du besiegt im Schwei-
gen sinnst! Gib, daß meine Seele einst unter dem Baum der Er-
kenntnis nahe bei dir ruht und Frieden findet, zur Stunde, da
über deiner StirnE als ein neuer Tempel sich seine Zweige brei-
ten werden!
Unveröffentlichter Text eines Vortrags im Rahmen der Vorlesungsreihe ‚Uni macht Schule’ des Gymnasiums
Neureut in Karlsruhe am 07.03.2012.
Die Veröffentlichung auf der Schulhomepage geschieht mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, Prof.
Dr. Frank-Rutger Hausmann.
13Sie können auch lesen