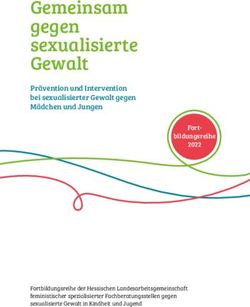Gewaltrückgang gegenüber Kindern als wichtiges Thema psychohistorischer Forschung (von Sven Fuchs)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gewaltrückgang gegenüber Kindern als wichtiges Thema
psychohistorischer Forschung
(von Sven Fuchs)
Vorbemerkung
Am 06.04.2019 durfte ich in Heidelberg - in Absprache mit den Verantwortlichen - bei
der 33. Jahrestagung der Gesellschaft für Psychohistorie und Politische Psychologie
(GPPP) im Plenum die Frage an die anwesenden Zuhörer und Zuhörerinnen stellen, wie
sie sich den bahnbrechenden Gewaltrückgang gegen Kinder in Deutschland und
Schweden seit den 1970er Jahren erklären? Als Reaktion bekam ich ein großes "Raunen"
und diverse abwehrende Zwischenrufe. Mit dieser Reaktion hatte ich ehrlich gesagt nicht
gerechnet. Ich möchte diesem „Raunen“ im Plenum hiermit entgegnen, nicht, damit ich
dastehe als jemand, der es besser weiß, sondern einfach als konstruktive Information.
Denn eigentlich hatte ich im Vorfeld sogar angeregt, dass zukünftig eine Jahrestagung der
GPPP das Thema Gewaltrückgang und Verbesserung der Lebensumstände von Kindern
in den Fokus nehmen sollte. Die stetige Verbesserung der Kindererziehungspraxis und
der Kinderfürsorge ist doch gerade im Konzept von Lloyd deMause1 zentral und muss
somit auch zentral in der psychohistorischen Forschung Beachtung finden.
Für alle psychohistorisch Interessierten ist es keine neue Erkenntnis, dass die
Geschichte der Kindheit ein Alptraum war, „aus dem wir gerade erst erwachen.“2 Es gibt
diverse Quellen, die diesen historischen Kindheitsalptraum nachgezeichnet haben.3 Ich
selbst habe sowohl historisches Kindheitsleid, als auch das aktuellere, weltweite Ausmaß
von Gewalt gegen Kinder umfassend analysiert.4 Das Wissen um dieses Kindheitsleid
sollte zum Allgemeinwissen dazugehören.
Aber: Auch die Trends und positiven Entwicklungen dürfen nicht ausgeblendet
werden! Auf positive Trends hinzuweisen, bedeutet nicht, dass alles gut ist oder dass wir
das historische wie auch aktuelle Kindheitsleid beiseiteschieben können. Die positiven
Trends sind aber von großer Bedeutung, denn die Kinder von heute werden in absehbarer
Zeit die Zukunft, die Politik und die Gesellschaften gestalten.
Empirische Untersuchungen
Bereits jetzt gibt es immer mehr Arbeiten, die unzählige positive Entwicklungen in
menschlichen Gesellschaften zentral in den Blick nehmen.5 Auch wenn uns die
Medienberichterstattung oft ein anderes Bild liefert: Die Welt wurde und wird
nachweisbar Stück für Stück in vielen Bereichen (z.B. Gesundheit, Wohlstand, Rechte,
Bildung, Frieden, Demokratie) immer besser.
Ich bin davon überzeugt, dass die sich stetig weiterentwickelnde
Kindererziehungspraxis und die Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände von
Kindern eine wesentliche Ursache auch für Teile des allgemeinen Positivtrends und auch
für rasante gesellschaftliche Veränderungen sind. Andererseits beeinflussen allgemeine
gesellschaftliche Positivtrends wiederum auch die Kindheiten positiv. Das Ganze scheint
1 deMause (1980), (2005).
2 deMause (1980), S. 12.
3 z.B. Radbill (1978), deMause (1980), Zenz (1981), Trube-Becker (1997), Rutschky (2001), Bensel et al. (2002), Frenken (2003),
deMause (2005), Grille (2008) und Pinker (2011).
4 Fuchs (2019).
5 Pinker (2011), Mingels (2017), Mingels (2018), Pinker (2018), Rosling (2018), Wüllenweber (2018), nicht zu vergessen das von
Max Roser gegründete Onlineprojekt Our World in Data: https://ourworldindata.orgalso auch miteinander verzahnt zu sein. Kommen wir nun aber zu dem Thema, um das es
hier wesentlich gehen soll: den Gewaltrückgang gegenüber Kindern. Beginnen wir mit
den USA.
USA und Kanada
In den USA wurden drei Studien aus den Jahren 2003, 2008 und 2011, für die insgesamt
10.183 Haushalte befragt wurden, ausgewertet. 50 spezifische Items (Erlebnisse
innerhalb von 12 Monaten vor der Befragung) für Kinder wurden erfasst, die große
Mehrheit davon waren Opfererfahrungen (z.B. Formen von Kindesmisshandlung,
Vernachlässigung und sexueller Gewalt, erlebte Eigentumsdelikte, Mobbing, Miterleben
von Gewalt und Überfällen, selbst erlittene außerfamiliäre Gewalt und Überfälle), aber
auch Delinquenz der Kinder (z.B. Graffiti sprühen, Gewalt gegen Kinder oder
Erwachsene oder Diebstahl). Von den 50 Items konnte zwischen 2003 und 2011 für 27
eine signifikante Abnahme der Belastungen und für kein Item eine signifikante Zunahme
festgestellt werden. Körperverletzungen gegen Kinder sanken in diesem Zeitraum
beispielsweise um 33 %, sexuelle Opfererfahrungen um 25 % und Formen von
Kindesmisshandlung sanken um 26 %. Gleichzeitig sanken die Raten für eigene
Delinquenz der Kinder rapide, z.B. halbierten sich die Rate für eigenes Gewaltverhalten
der Kinder gegen Andere beinahe.6
Dunkelfeldbefragungen in den USA zeigen einen Rückgang von sexueller Gewalt
gegenüber 12- bis 17Jährigen zwischen 1993 und 2008 um 69 %.7 In dem gleichen
Papier zeichnen sich auch seit den 1990er Jahren Rückgänge von körperlicher
Kindesmisshandlung und auch häuslicher Gewalt zwischen Partnern ab (letzteres
bedeutet dann wiederum, dass immer weniger Kinder hilflose Zeugen von Gewalt
zwischen Elternteilen werden).
Elizabeth T. Gershoff macht auf eine positive Entwicklung in den USA
aufmerksam. Noch in den 1960er Jahren waren 94 % der Erwachsenen für Köperstrafen
gegenüber Kindern. 1986 stimmten noch 84 % der erwachsenen Amerikaner dem Satz
zu, dass Kinder manchmal „good hard spanking“ nötig hätten. Bis 2004 sank diese
Einstellung immerhin auf einen Anteil von 71,3 %.8 Bis 2012 hat sich dieser Wert immer
noch bei um die 70 % gehalten.9 Es ist also bei Weitem nicht alles gut in den USA, aber
doch gibt es auch bei den Einstellungen zur Gewalt positive Trends.
Bleiben wir noch einmal in Nordamerika. In repräsentativen Befragungen wurden
kanadische Eltern im Zeitraum zwischen 1994 und 2008 bzgl. ihres Strafverhaltens
gegenüber Kindern erfasst. 1994 schlugen noch ca. 50 % der kanadischen Eltern ihre 2-
5jährigen Kinder, bis 2008 sank die Rate auf ca. 30 %. Bei den 6-9jährigen Kindern sank
die Rate von etwas unter 40 % im Jahr 1994 auf etwas über 20 % im Jahr 2008.
Gleichzeitig nahm die Häufigkeit des Strafverhaltens stetig ab. Die meisten kanadischen
Eltern, die ihre Kinder schlagen, tun dies eher selten.10
Speziell für die kanadische Provinz Québec wurden drei große Studien aus den
Jahren 1999, 2004 und 2012 miteinander verglichen. Abgefragt wurde jeweils das
elterliche Gewaltverhalten innerhalb eines Jahres gegen Kinder zwischen 0 und 18
Jahren. 1999 erlebten 47,7 %, 2004 42,9 % und 2012 34,7 % der Kinder mindestens
einmal körperliche Gewalt im Elternhaus. Gleichzeitig sank die Zustimmungsrate zu
6 Finkelhor et al. (2014).
7 Finkelhor & Jones (2012), S. 2.
8 Gershoff (2008), S. 11.
9 Enten (2014).
10 Fréchette & Romano (2015), S. 510, 512, 513.Körperstrafen. 1999 stimmten beispielsweise noch 29,2 % der Eltern in Québec zu, dass
manche Kinder geschlagen werden müssten, um eine Lektion zu lernen, 2004 war der
Wert auf 25,7 % und 2012 auf 15 % gesunken.11
Österreich
In Österreich wurden Daten von zwei repräsentativen Studien (Befragung der
Allgemeinbevölkerung über 15 Jahre) miteinander verglichen. 2014 stimmten 16 % der
Befragten dem Satz zu: „Ein kleiner Klaps ab und zu schadet keinem Kind“, 48 %
lehnten ihn komplett ab. Im Jahr 1977 stimmten diesem Satz noch 85 % der Befragten zu
und nur 4 % lehnten ihn ab. Dem Satz „Wenn einem hie und da die Hand ausrutscht,
wenn ein Kind schlimm ist, so ist gar nichts dabei.“ stimmten 2014 nur 3 % der
Befragten zu, 77 % lehnten ihn ab. 1977 stimmten dem Satz noch 57 % zu und nur 10 %
lehnten ihn ab. 2014 stimmten nur 1 % dem Satz „Es ist auch heute noch richtig, einem
Kind, das etwas angestellt hat, eine ordentliche Tracht Prügel zu verabreichen“ zu, 93 %
lehnten ihn ab. 1977 stimmten diesem Satz noch 7 % zu und nur 66 % lehnten ihn
komplett ab.12 Im weiteren Vergleich der beiden Studien zeigt sich auch eine deutlichere
Ablehnung von autoritärer Erziehung im Jahr 2014 als solches und ebenso eine im
Vergleich zu 1977 zunehmende Zustimmung zu – nennen wir es – demokratischer
Erziehung an sich.
Großbritannien
Großbritannien gehört zu einer Minderheit von europäischen Ländern, in denen es immer
noch kein generelles gesetzliches Verbot von Körperstrafen gegen Kinder im Elternhaus
gibt. Trotzdem zeichnet sich auch in Großbritannien – dem europäischen Trend folgend -
ein Rückgang der Gewalt gegen Kinder ab. Im Auftrag der National Society for the
Prevention of Cruelty to Children wurden 1998 (2.869 Befragte) und 2009 (1.897
Befragte) Befragungen von jungen Erwachsenen durchgeführt. 1998 ergab sich im
Schnitt eine Gewaltrate bezogen auf erlebte Schläge (durch Erwachsene im Elternhaus,
Schule oder anderswo) mit der Hand auf das Gesäß von 53,1 %, 2009 waren es dagegen
41 %. Schläge auf Beine, Arme oder Hände sanken im gleichen Zeitvergleich von 61 %
auf 43 %. Schläge ins Gesicht, an den Kopf oder Ohren nahmen von 21,3 % auf 13,4 %
ab. Schwere Misshandlungen in Form von Zusammenschlagen oder wiederholten
Schlägen gegen das Kind sanken von 6,6 % auf 4,3 %. Im Zeitvergleich sank auch für
fast alle Items die verbale Aggression gegen Kinder.13
Eine andere Studie aus Großbritannien konnte ebenfalls einen Rückgang der Gewalt
ermitteln. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 6.196 Eltern, Kinder und junge Erwachsene
befragt. Die 18 bis 24-Jährigen erlebten zu 8,4 % körperliche Misshandlungen durch
Elternteile oder Erziehungsberechtigte, die 11 bis 17-Jährigen zu 6,9 % und die unter 11-
Jährigen zu 1,3 %. Das Miterleben von häuslicher Gewalt sank von 23,7 % bei den 18 bis
24-Jährigen, auf 17,5 % bei den 11 bis 17-Jährigen und 12 % bei den unter 11-Jährigen.
Vernachlässigung sank von 16 % bei den 18 bis 24-Jährigen, auf 13,3 % bei den 11 bis
17-Jährigen und 5 % bei den unter 11-Jährigen. Emotionale Misshandlungen halbierten
sich fast im Vergleich zwischen den unter 11-Jährigen (auf 3,6 %) und den beiden
11 Clément & Chamberland (2014), S. 19-21.
12 Bundesministerium für Familie und Jugend (2014), S. 11-16.
13 Radford et al. (2011), S. 111+112.anderen Altersgruppen (ca. 6,9 %).14
Deutschland
Umfragen in Deutschland zeigten, dass im Jahr 1962 noch 85% der Eltern Schläge
gegenüber Kindern für ein notwendiges Erziehungsmittel hielten. Im Jahr 2005 war diese
Zustimmungsrate auf 8 % gesunken.15 Um den Gewaltrückgang gegen Kinder in
Deutschland aussagekräftig beurteilen zu können, macht vor allem der Blick auf eine der
größten deutschen Repräsentativ-Gewaltstudien von Deborah F. Hellmann (mit 11.428
Befragten)16 und deren ebenfalls repräsentativen Vorläuferstudie von Peter Wetzels (mit
3.289 Befragten)17 Sinn. In beiden Studien wurden Alterskohorten gebildet. Der Blick auf
die Geburtsjahrgänge und das entsprechende Ausmaß von Gewalt bzw. Gewaltfreiheit
belegt eindrucksvoll einen stetigen Gewaltrückgang, der sich vor allem ab den 1970er
Jahren stark beschleunigt hat:
Wetzels (1997): Es erlebten keinerlei körperliche Elterngewalt
1933 - 1942 = 22,9 %
1943 - 1952 = 22,8 %
1953 - 1962 = 23,1 %
1963 - 1971 = 29,1 %
1972 - 1976 = 30,5 %
Hellmann (2014): Es erlebten keinerlei körperliche Elterngewalt
ca. 1971 – 1980 = 44,9 %
ca. 1981 – 1990 = 53,6 %
ca. 1991 – 1995 = 61,7 %
Die Studie von Hellmann zeigte außerdem, dass sich die Prävalenz von schwerer Gewalt
in den beiden Extremgruppen nahezu halbiert hat: von 16,2 % (Geburtsjahrgänge ca.
1971 – 1980) auf 8,5 % (Geburtsjahrgänge ca. 1991 – 1995).18 Innerhalb der Studie von
Hellmann wurde auch eine Gruppe von 1.586 Befragten, die mit Kindern (eigenes,
Pflegekinder etc.) unter 18 Jahren in einem Haushalt leben, gesondert zu eigenem
Gewaltverhalten gegen Kinder befragt. Ca. 78 % (78,6 % hatten nie leichte Gewalt und
98,7 % nie schwere Gewalt angewandt) hatten bis zum Zeitpunkt der Befragung noch nie
körperliche Gewalt angewandt. Die befragten Eltern waren im Schnitt ca. 33 Jahre alt
(Geburtsdatum im Schnitt ca. 1978). Interessant ist, dass der Alterskohortenvergleich
zwischen den 21-30Jährigen (Geburtsjahrgänge ca. 1981-1990) und den 31-40Jährigen
(Geburtsjahrgänge ca. 1971-1980) nochmals einen weiteren Gewaltrückgang zeigt. Ca.
86 % der 21-30Jährigen Eltern hatte noch nie im Haushalt mitlebende Kinder
geschlagen.19
Dass wir in Deutschland mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen
können, dass deutlich über 70 % der Kinder keinerlei körperliche Elterngewalt erleben,
zeigen auch zwei weitere Studien: Einmal für die Geburtsjahrgänge ca. 1997-2007 in
14 Radford et al. (2013), S. 806.
15 Mingels (2017), S. 26.
16 Hellmann (2014).
17 Wetzels (1997).
18 Hellmann (2014), S. 82.
19 Hellmann (2014), S. 158.deutschen Großstädten20 und einmal für die Geburtsjahrgänge 1993-1996 in
Ostdeutschland21.
In der bereits genannten Studie von Hellman wurde ergänzend auch die Häufigkeit
von elterlicher Zuwendung („mich gelobt, wenn ich etwas besonders gut gemacht hatte“,
„mich in den Arm genommen und mit mir geschmust“, „mir ruhig erklärt, wenn ich
etwas falsch gemacht hatte“, „mich getröstet, wenn ich traurig war“) abgefragt. Bei
knapp der Hälfte der Befragten kann „von einer liebevollen Kindheit gesprochen werden:
Diese Befragten waren völlig gewaltfrei erzogen worden und hatten gleichzeitig ein
hohes Maß an elterlicher Zuwendung erfahren.“22 Dabei darf nicht vergessen werden,
dass dies ein Blick in die Vergangenheit ist (und zwar vor allem auf die Kindheiten der
1970er, 1980er und 1990er Jahre, bis teils Anfang des 21. Jahrhunderts). Zum einen wird
die heutige Kindergeneration vermutlich nochmals deutlich mehr Zuwendung erfahren
haben. Zum anderen ist für die Geburtenjahrgänge zwischen den 1930er und 1950er
Jahren nachgewiesen, dass diese Jahrgänge nur zu ca. 30 % ein hohes Maß an elterlicher
Zuwendung erfahren haben, bei den Jahrgängen ab 1990 sind dagegen mittlerweile Raten
von über 60 % nachgewiesen. Gesonderte Schülerbefragungen (mit hohen Fallzahlen) in
Niedersachen zeigen ergänzend, dass die Geburtenjahrgänge um das Jahr 2000
mittlerweile zu 78,6 % über ein hohes Maß an elterlicher Zuwendung berichten.23
Für eine weitere repräsentative Befragung wurden 2.524 Männer und Frauen in
Deutschland befragt. In der Studie wurde nicht ausgewiesen, wie viel Prozent der
Befragten keinerlei Elterngewalt erlitten haben. Allerdings wurden einzelne
Gewaltformen aufgeführt und für drei Alterskohorten ausgewertet. Für sieben von neun
abgefragten körperlichen Gewaltformen zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Gewalt.
So gaben beispielsweise 14,6 % der Befragten über 61-Jährigen (Geburtenjahrgänge
unter ca. 1955) an, als Kind mit einem Stock kräftig auf den Po geschlagen worden zu
sein. Bei den 31-60Jährigen (Geburtsjahrgänge ca. 1956-1985) waren es 6,5 % und bei
den 14 - 30Jährigen (Geburtenjahrgänge ca. 1986-2002) nur noch 2,7 %. Eine schallende
Ohrfeige hatten 24,5 % der über 61-Jährigen erlitten, dagegen 19,6 % der 31-60Jährigen
und 10,4 % der 14-30Jährigen.24
Auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern zeichnet sich in Deutschland ein
deutlicher Rückgang ab, was sich mit Blick auf die Geburtenjahrgänge nachfolgend
ablesen lässt:
Hellmann (2014):
Daten für die Frauen: Frauen (mit deutscher Staatsangehörigkeit), die sexuellen
Missbrauch mit Körperkontakt erlebten:
ca. 1971 – 1980 = 9,5 % der Frauen
ca. 1981 – 1990 = 7,2 % der Frauen
ca. 1991 – 1995 = 3 % der Frauen
Daten für die Männer: Männer (mit deutscher Staatsangehörigkeit), die sexuellen
Missbrauch mit Körperkontakt erlebten:
ca. 1971 – 1980 = 1,8 % der Männer
ca. 1981 – 1990 = 1,4 % der Männer
ca. 1991 – 1995 = 0,9 % der Männer.25
20 Ziegler (2013), S. 2.
21 Weller (2013), S. 2.
22 Hellmann (2014), S. 86.
23 Pfeiffer et al. (2018), S. 37+39.
24 Plener et al. (2016), S. 23.
25 Hellmann (2014), S. 104.Wie schon bei der körperlichen Gewalt (wie oben im Text gezeigt) wurden diese Daten
von Hellmann (Befragung aus dem Jahr 2011) mit den Daten der Vorgängerstudie von
Wetzels (Befragung aus dem Jahr 1992) verglichen. Bei Hellmann erlitten im
Durchschnitt aller befragten Frauen und Männer (mit deutscher Staatsangehörigkeit) 4,4
% sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt, bei Wetzels waren es im Durchschnitt 7,1
%.26 Dies entspricht einem Rückgang um ca. 38 %. Insofern zeichnet sich der Rückgang
von sexuellem Missbrauch nicht nur im Alterskohortenvergleich innerhalb einer Studie
ab, sondern auch im direkten Vergleich mit älteren Daten (und somit wiederum auch
älteren Geburtsjahrgängen) aus der Vorgängerstudie.
Vergleichsdaten
Für Länder außerhalb von Nordamerika und Europa ist es schwieriger, Vergleichsdaten
zu bekommen. Dies liegt daran, dass in diesen Regionen meist verhältnismäßig spät
damit begonnen wurde, das Ausmaß der Gewalt gegen Kinder zu erfassen und somit
Trendentwicklungen schwer einzuschätzen sind. Eine Ausnahme stellen Befragungen
dar, in denen Alterskohorten gebildet wurden. Ein Beispiel: In El Salvador (9.430
Befragte) und Guatemala (11.319 Befragte) wurde nach (schweren) Gewalterfahrungen
im Elternhaus vor dem 18. Lebensjahr gefragt. In Guatemala zeigt sich ein deutlicher
Rückgang der Gewalt vor allem bei den Mädchen. Körperliche Misshandlungen erlebten
in Guatemala ca. 44 % der 40- bis 49jährigen Frauen. Mit jeder jüngeren Altersgruppe
sanken die Misshandlungsraten bis zu schließlich ca. 30 % bei den 15- bis 24Jährigen.
Bei den Männern ist das Bild etwas uneinheitlicher, aber auch dort zeigte sich ein Trend
zum Gewaltrückgang. Am wenigsten Misshandlungen hatten mit ca. 39 % die jüngste
Gruppe der 15 bis 19jährigen Männer erlitten (im Vergleich zu z.B. ca. 57 % bei den 50
bis 59Jährigen oder ca. 44 % bei den 35 bis 39Jährigen). In El Salvador zeichnete sich
der Gewaltrückgang ebenfalls bei den befragten Frauen am deutlichsten ab. Die 40- bis
49jährigen Frauen erlitten noch zu ca. 50 % Misshandlungen. Die 20- bis 24Jährigen zu
38 % und die 15 bis 19Jährigen zu ca. 32 %. Bei den Männern war das Bild
uneinheitlicher und der Gewaltrückgang zeichnet sich deutlich - mit einer
Misshandlungsrate von ca. 48 %, im Vergleich zu ca. 60 bis 71 % bei den 20 bis
59Jährigen - erst bei der Gruppe der 15 bis 19Jährigen ab.27
Beide Befragungen wurden zwischen 2002 und 2003 durchgeführt. Insofern ist
damit zu rechnen, dass die Gewalt in diesen südamerikanischen Ländern seither weiter
zurückgegangen ist.
Schweden
Den eindrucksvollsten Gewaltrückgang hat weltweit verglichen bisher Schweden
vollzogen. Ein Vergleich zwischen verschiedenen schwedischen Studien zeigt einen
deutlichen Gewaltrückgang. In den 1960er Jahren wendeten noch über 90 % der
schwedischen Eltern körperliche Gewalt an. Danach sanken die Gewaltraten rapide auf
50 % in den 1970er Jahren, 35 % in den 1980er Jahren, 20 % in den 1990er Jahren und
ca. 12-14 % ab dem Jahr 2000. Auffällig, wie auch bzgl. der Bewertung möglicher
Folgeschäden bedeutsam, ist auch, dass die meisten der gewaltbetroffenen Kinder
(diesbezüglich verfügbare Daten erst ab 1994) nur gelegentlich geschlagen wurden. In
26 Hellmann (2014), S. 107.
27 Speizer et al. (2008), S. 252.einer ausgewerteten Studie aus dem Jahr 2011 berichteten beispielsweise nur noch 3 %
der Kinder, öfter geschlagen worden zu sein.28
Für eine andere schwedische Studie wurden Daten aus vier Befragungen
miteinander verglichen. Körperliche Gewalt im Elternhaus sank demnach von 35 %
(Befragungen im Jahr 1995), auf 17 % (2006), 14 % (2011) und 12 % (2016).29 (Wobei
die beiden letzten Zahlen nicht zu hundert Prozent mit den beiden vorherigen
vergleichbar sind, direkt vergleichbar sind aber die Daten zwischen 1995 und 2006, was
die Autoren betonen.) Die vorgenannten Daten stammen aus Schülerbefragungen. Bzgl.
der Geburtsjahrgänge muss entsprechend zurückgerechnet werden. So entstammten
beispielsweise die Schüler aus der Befragung 2016 den Geburtsjahrgängen zwischen ca.
1999 und 2002.
Es gibt nach meinen Recherchen kein anderes Land auf der Welt, das derart rasant
Stück für Stück körperliche Gewalt gegen Kinder reduziert hat. Vermutlich wird
Schweden in absehbarer Zeit das erste Land der Welt sein, das eine Gewaltrate gegen
Kinder erreichen wird, die nahezu gegen Null tendiert.
Weitere positive Trends
Es gibt weitere positive Trends, die erwähnenswert sind. Nur drei seien genannt: Der
bahnbrechende Rückgang der Kindersterblichkeit, die stetige Zunahme von
Alphabetisierung bzw. Schulbesuchen und die massive Zunahme vom wissenschaftlichen
Interesse am Gesamtthema Kindesmisshandlung.
Um das Jahr 1800 starben weltweit ca. 43 % der Kinder vor dem 5. Lebensjahr.
Noch im Jahr 1960 lag die weltweite Kindersterblichkeitsrate bei 18,5 %, fast jedes 5.
Kind starb. Im Jahr 2017 lag diese Rate bei ca. 4%.30 Noch im Jahr 1842 starb jedes
zweite deutsche Kind vor seinem 5. Lebensjahr, im Jahr 2013 starben von 1000
deutschen Kindern noch knapp 4 (also ca. 0,4 %).31 Interessant ist übrigens, dass
Schweden bzgl. der Kindersterblichkeitsrate um das Jahr 1800 sogar noch leicht über der
von Deutschland lag, seitdem gingen die Zahlen stetig auseinander bzw. wurden in
Schweden immer besser. 1842 starb in Schweden jedes vierte Kind, im Gegensatz zu
jedem Zweiten in Deutschland wie zuvor gezeigt. Im Jahr 1900 starben in Deutschland
immer noch 37,2 % der Kinder, in Schweden „nur“ noch 15,5%.32
Vor dem 17. Jahrhundert konnte nur ein kleiner Teil der Menschen in Europa lesen
und schreiben. Vor allem ab dem 20. Jahrhundert begann der steile Aufstieg der
weltweiten Alphabetisierungsrate auf nunmehr 83 % im Jahr 2010 (bezogen auf die
jüngeren Generationen ist diese Rate sogar noch höher). Im Jahr 1820 besaßen über 80 %
der Weltbevölkerung keine Schulbildung, die Zahlen haben sich seitdem umgedreht:
Heute verfügt über 80 % der Weltbevölkerung über eine Basisschulbildung.33 Dem
Menschenrecht auf Bildung wird für Kinder also immer mehr nachgekommen.
Eine weitere Entwicklung sollte uns freuen: Die Welt befasst sich immer intensiver
mit dem Gesamtkomplex Kindesmisshandlung. Zwischen 1916 und 1979 entstanden
weltweit ganze 500 englischsprachige, wissenschaftliche Artikel, die das Thema
Kindesmisshandlung behandelten. Zwischen den Jahren 2000 und 2018 entstanden
28 Ångman & Gustafsson (2011), S. 6, 7.
29 Jernbro & Janson (2017), S. 27.
30 Roser (2019).
31 Mingels (2017), S. 48.
32 Roser (2019), Hinweis: im Standartchart ist die Ergänzung der Daten um Deutschland nötig, um den Vergleich vorzunehmen.
33 Pinker (2018), S. 302f.38.411 englischsprachige Artikel zum Thema.34 Die Welt wacht immer mehr auf, wenn es
um den Schutz von Kindern geht.
Nachbemerkung…
Kommen wir gedanklich noch einmal zurück auf den 06.04.2019 in Heidelberg. Nach
der kurzen Diskussion und dem „Raunen“ im Plenum kamen im Foyer und draußen
vereinzelt auch Teilnehmer auf mich zu, die mir bzgl. der These vom Gewaltrückgang
zustimmten. Gleichzeitig kam oft ein „aber“ hinterher. Dominierend dabei war vor allem
die Sorge, dass die starke Institutionalisierung von Kindheit (verstärkte Krippen- und
Ganztagsbetreuung) sowie der starke Medienkonsum und soziale Netzwerke auch
Verschlechterungen bringen würden. Diese Sorgen halte ich für berechtigt und man sollte
diesen auch nachgehen.
… und Plädoyer für eines Jahrestagung der GPPP
Mein Schlusswort lautet insofern folgendermaßen: Ich plädiere hiermit für eine
Jahrestagung der GPPP, die sich das Thema Gewaltrückgang und Verbesserung der
Lebensumstände von Kindern auf die Fahnen schreibt und ergänzend dazu einlädt, über
mögliche gesellschaftliche Folgen dieser positiven Entwicklungen zu diskutieren.
Gleichzeitig könnten innerhalb der gleichen Tagung auch Rückschritte oder (neue)
problematische Entwicklungen von Kindheit besprochen werden, um deutlich zu
machen, dass Fortschritt nicht auf allen Gebieten eine Einbahnstraße ist. Dies wäre auf
der einen Seite spannend und aktuell, gleichzeitig würde dadurch sowohl das Interesse
bei Zuhörern wie auch potentiellen Referenten steigen (davon ausgehend, dass bei einer
Konzentration nur auf Verbesserungen weniger Interesse und vor allem auch weniger
potentielle Referenten zu erwarten wären). Ich bin mir sicher, dass sich vor allem beim
kritischen Blick auf die Ausweitung der Krippenerziehung schnell fachlich kompetente
Referenten finden lassen würden.
Aus einem Alptraum aufgewacht
Auf der Tagung könnte auch die Frage besprochen werden, wie all die aufgezeigten
positiven Entwicklungen in verhältnismäßig kurzer Zeit möglich waren? Was lief in
Schweden anders, was gab den Ausschlag? Warum findet der Gewaltrückgang gegenüber
Kindern in den USA deutlich langsamer statt als beim Nachbarn Kanada? Warum konnte
sich Deutschland in einigen Jahrzehnten zu einem der sichersten Länder der Welt für
Kinder entwickeln, obwohl es gerade einmal rund 80 Jahre her ist, dass von deutschem
Boden aus unfassbares Leid (auch) gegen Kinder ausging (sowohl kriegerischer, als auch
erzieherischer Natur) und auch noch die 1950er und 1960er Jahre hierzulande für Kinder
mehrheitlich von (erzieherischer) Gewalt geprägt waren?
Ich möchte mit dem Hinweis schließen, dass wir (zumindest in Europa) nicht mehr
– wie Lloyd deMause es vor einigen Jahrzehnten formulierte - dabei sind, aus dem
Alptraum der Geschichte der Kindheit zu erwachen, sondern dass wir bereits wach sind,
unseren Morgenkaffee getrunken haben und dabei sind, unsere Alpträume zu verarbeiten
und unsere Kinder besser zu behandeln, als alle Generationen zuvor.
34 Tran et al. (2018).Kurzbiografie Sven Fuchs: geb. 1977, Vater von zwei Kindern, seit 2004 selbstständiger Kaufmann (ausgebildeter Industriekaufmann) bzw. Unternehmer, Studium der Soziologie zwischen 2001–2004 an der Universität Hamburg (ohne Abschluss). 15 Monate Zivildienst in einer Hamburger Drogentherapieeinrichtung, was ihm sehr viel zum Nachdenken mit nach Hause gegeben hat. Mitglied der Gesellschaft für Psychohistorie und Politische Psychologie (GPPP). Seit 2008 Autor des Internetblogs: www.kriegsursachen.blogspot.de (mit Kontaktmöglichkeiten). Literaturverzeichnis Ångman, I. & Gustafsson, M. (2011): Combating child abuse and neglect in Sweden. (Regionförbundet Örebro 2011). http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Daphne_report_Sweden.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Bensel, R. T., Reihnberger, M., & Radbill, S. (2002): Kinder in einer Welt der Gewalt: Misshandlung im geschichtlichen Rückblick. In: Helfer, M. E., Kempe, R. S. & Krugman, R. D. (Hrsg.): Das misshandelte Kind. (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002), S. 10– 48. Bundesministerium für Familie und Jugend (2014): DAS RECHT AUF EINE GEWALTFREIE KINDHEIT. 25 Jahre gesetzliches Gewaltverbot – eine Zwischenbilanz. (Wien 2014). https://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2014/11/Das-Recht-auf-eine- gewaltfreie-Kindheit-25-Jahre-gesetzliches-Gewaltverbot-1.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Clément, M.-E. & Chamberland, C. (2014): Trends in Corporal Punishment and Attitudes in Favour of This Practice: Toward a Change in Societal Norms. In: Canadian Journal of Community Mental Health. Vol. 33, NO. 2. S. 13-29. deMause, L. (1980): Evolution der Kindheit. In: deMause, L. (Hrsg.): Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1980). S. 12– 111. deMause, L. (2005): Das emotionale Leben der Nationen. (Drava Verlag, Klagenfurt, Celovec 2005). Enten, H. (2014): Americans’ Opinions On Spanking Vary By Party, Race, Region And Religion. FiveThirtyEight. https://fivethirtyeight.com/features/americans-opinions-on- spanking-vary-by-party-race-region-and-religion/. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Finkelhor, D. & Jones, L. (2012): Have Sexual Abuse and Physical Abuse Declined Since the 1990s? (CV267), (Crimes Against Children Research Center, University of New Hampshire 2012). http://www.unh.edu/ccrc/pdf/CV267_Have%20SA%20%20PA %20Decline_FACT%20SHEET_11-7-12.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019.
Finkelhor, D., Shattuck A., Turner, H. A. & Hamby, S. L. (2014): Trends in Children’s Exposure to Violence, 2003 to 2011. In: JAMA Pediatrics 168(6), Online veröffentlicht: 28.04.2014. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1863909. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Fréchette, S. & Romano, E. (2015): Change in Corporal Punishment Over Time in a Representative Sample of Canadian Parents. In: Journal of Family Psychology. Vol. 29, Nr. 4. S. 507-517. Frenken, R. (2003): »Da fing ich an zu erinnern …« Die Psychohistorie der Eltern-Kind- Beziehung in den frühesten deutschen Autobiographien (1200-1700). (Psychosozial Verlag, Gießen 2003). Fuchs, S. (2019): Die Kindheit ist politisch! Kriege, Terror, Extremismus, Diktaturen und Gewalt als Folge destruktiver Kindheitserfahrungen. (Mattes Verlag, Heidelberg 2019). Gershoff, E. T. (2008): Report on Physical Punishment in the United States: What Research Tells Us About Its Effects on Children. (Center for Effective Discipline, Columbus 2008). Grille, R. (2008): Parenting for a Peaceful World. (The Children`s Project, Richmond 2008). Hellmann, D. F. (2014): Repräsentativbefragung zu Viktimisierungserfahrungen in Deutschland. Forschungsbericht Nr. 122. (KFN, Hannover 2014). https://kfn.de/wp- content/uploads/Forschungsberichte/FB_122.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Jernbro, C. & Janson, S. (2017): Violence against children in Sweden 2016. A National Survey. (The Children’s Welfare Foundation, Stockholm 2017). Mingels, G. (2017): Früher war alles schlechter. Warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht. (Deutsche Verlags Anstalt, München 2017). Mingels, G. (2018): Früher war alles schlechter 2. Neue Fakten, warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht. (Deutsche Verlags Anstalt, München 2017). Pfeiffer, C., Baier, D. & Kliem, S. (2018): Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland. Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer. (Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Institut für Delinquenz und Kriminalprävention 2018). https://www.bmfsfj.de/blob/121226/0509c2c7fc392aa88766bdfaeaf9d39b/gutachten-zur- entwicklung-der-gewalt-in-deutschland-data.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Pinker, S. (2011): Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit. S. (Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011). Pinker, S. (2018): Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung. (Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018).
Plener, P. L., Rodens, K. P. & Fegert, J. M. (2016). „Ein Klaps auf den Hintern hat noch niemandem geschadet“: Einstellungen zu Körperstrafen und Erziehung in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Themenheft (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. 2016). S. 20-25. https://www.stiftung-kind-und-jugend.de/fileadmin/pdf/BVKJ_Kinderschutz_0616_Beitr ag_Umfrage_2.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Radbill, S. X. (1978): Misshandlung und Kindestötung in der Geschichte. In: Helfer, R. E. & Kempe, C. H. (Hrsg.): Das geschlagene Kind. (Suhrkamp Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 1978). S. 37–65. Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N. & Collishaw, S. (2011): Child abuse and neglect in the UK today. (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, London 2011). Radford L., Corral, S., Bradley, C. & Fisher, H. L. (2013): The prevalence and impact of child maltreatment and other types of victimization in the UK: findings from a population survey of caregivers, children and young people and young adults. In: Child Abuse & Neglect. Volume 37, Issue 10. S. 801-813. Roser, M. (2019): Child Mortality. Onlineprojekt OurWorldInData.org, University of Oxford. https://ourworldindata.org/child-mortality. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Rosling, H. (2018): Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. (Ullstein Buchverlage, Berlin 2018). Rutschky, K. (2001). Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung. (Ullstein Taschenbuchverlag, München 2001). Speizer, I. S., Goodwin, M. M., Samandari, G., Kim, S.Y. & Clyde, M. (2008): Dimensions of child punishment in two Central American countries: Guatemala and El Salvador. In: Rev Panam Salud Publica, 23(4), S. 247–256. Tran, B. X., Pham, T. V., Ha, G. H., Ngo, A. T., Nguyen, L. H., Vu, T. T. M., Do, H. N., Nguyen, V., Nguyen, A. T. L., Tran, T. T., Truong, N. T., Hoang, V. Q., Ho, T. M., Dam, N. V., Vuong, T. T., Nguyen, H. Q., Le, H. T., Do, H. T., Moir, M., Shimpuku, Y., Dhimal, M., Arya, S. S., Nguyen, T. H., Bhattarai, S., Latkin, C. A., Ho, C. S. H. & Ho, R. C. M. (2018): A Bibliometric Analysis of the Global Research Trend in Child Maltreatment. In: International Journal of Environmental Research and Public Health. 15(7). pii: E1456. https://doi.org/10.3390/ijerph15071456. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Trube-Becker, E. (1997): Historische Perspektive sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen und die soziale Akzeptanz dieses Phänomens von der Zeit der Römer bis heute. In: Amann, G. & Wipplinger, R. (Hrsg.): Sexueller Missbrauch - Überblick zu Forschung, Beratung und Theorie. (dgtv-Verlag, Tübingen 1997). S. 39-45. Weller, K. (Hrsg.) (2013): PARTNER 4. Sexualität & Partnerschaft ostdeutscher Jugendlicher im historischen Vergleich. (Handout zum Symposium an der HS Merseburg am 23. Mai 2013), (Merseburg 2013).
https://www.ifas-home.de/downloads/PARTNER4_Handout_06%2006.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019. Wetzels, P. (1997): Gewalterfahrungen in der Kindheit – Sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und deren langfristige Konsequenzen. (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997). Wüllenweber, W. (2018): Frohe Botschaft: Es steht nicht gut um die Menschheit – aber besser als jemals zuvor. (Deutsche Verlags-Anstalt, München 2018). Zenz, G. (1981): Kindesmisshandlung und Kinderrechte. Erfahrungswissen, Normstruktur und Entscheidungsrationalität. (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981). Ziegler, H. (2013): Gewaltstudie 2013: Gewalt- und Missachtungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. (Universität Bielefeld 2013). https://xn-- kinderfrderung-1pb.bepanthen.de/static/documents/Abstract_Gewaltstudie_Prof.Ziegler- 1.pdf. Zugegriffen: 13. Mai. 2019.
Sie können auch lesen