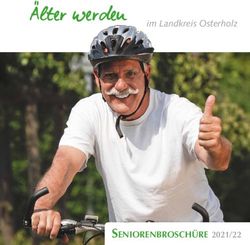Grundrechtliche Rahmenbedingungen für eine Vergesellschaftung großer Wohnungs-unternehmen - POLICY PAPER 1|2022 - GIF e.V.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
POLICY PAPER
1|2022
Grundrechtliche
Rahmenbedingungen
für eine Vergesellschaftung
großer Wohnungs-
unternehmen
Prof. Dr. Jürgen Kühling
Moritz Litterst
März 2022POLICY PAPER
1 | 2022
Inhaltsverzeichnis
Executive Summary ............................................................................................................. II
1. Problemaufriss ............................................................................................................. 1
2. Gang der Überlegungen................................................................................................. 2
3. Historisch-genetische Analyse des Art. 15 GG .................................................................. 3
3.1 Die Sozialisierungsregelung in Art. 156 WRV und ihre Vorläufer ................................... 3
3.2 Die historischen Hintergründe der Sozialisierungsdiskussion nach dem ..........................
Zweiten Weltkrieg .................................................................................................. 4
3.3 Der Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee ............................................................ 7
3.4 Diskussion im Parlamentarischen Rat ....................................................................... 7
3.5 Zwischenfazit ........................................................................................................ 9
4. Subjektive oder auch objektive Interpretation des Art. 15 GG? ........................................... 9
5. Vorbemerkung zu divergierenden Auslegungsansätzen zum Anwendungsbereich ...................
von Art. 15 GG ............................................................................................................ 11
6. Tauglicher Gegenstand von Sozialisierungen ................................................................... 12
6.1 Produktionsmittel.................................................................................................. 12
6.2 Grund und Boden.................................................................................................. 13
6.3 Die Sozialisierungsreife als Topos in der Literatur ..................................................... 14
7. Verhältnismäßigkeit von Sozialisierungen ....................................................................... 16
7.1 Ausschluss einer Verhältnismäßigkeitsprüfung? ........................................................ 16
7.2 Maßstab und Konsequenzen einer Eignungsprüfung .................................................. 17
7.3 Erforderlichkeit einer Sozialisierung......................................................................... 18
7.4 Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ..................................................................... 20
7.5 Zwischenfazit ....................................................................................................... 21
8. Vorgaben zur Entschädigungshöhe ................................................................................ 22
8.1 Sondermaßstäbe oder Parallelen zur Rechtsprechung zu Art. 14 GG? .......................... 22
8.2 Abwägungsleitende Topoi in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ......... 24
8.3 Konsequenzen im vorliegenden Zusammenhang ....................................................... 27
9. Exkurs: Verhältnismäßigkeitsprinzip und Entschädigung im Unionsrecht ............................. 31
10. Fazit .......................................................................................................................... 33
IPOLICY PAPER
1 | 2022
Executive Summary
Mit einem Ruck haben die Berliner Diskussion und der schließlich erfolgreiche Volksentscheid über
die beabsichtigte Sozialisierung der Wohnungen großer Immobilienunternehmen den Sozialisierungs-
artikel 15 im deutschen Grundgesetz (GG) aus seinem „Dornröschenschlaf“ gerissen. Eine Norm, die
mehr als 70 Jahre praktisch unangewandt blieb, ist nunmehr zwischen die Fronten eines zuweilen
hoch emotionalen gesellschaftspolitischen Streites geraten. Dabei fehlt jegliche Rechtsprechung, ins-
besondere des Bundesverfassungsgerichts, die insoweit Leitwirkung entfalten könnte.
Angesichts dieses späten Interesses an Art. 15 GG verwundert es auch nicht, dass das Meinungs-
spektrum zur Auslegung dieser Bestimmung besonders breit ist. Teilweise wird die Norm sehr weit-
reichend so verstanden, dass sie letztlich jegliche Vergesellschaftung größerer Unternehmensbe-
stände legitimiert, sofern dafür nur entschädigt wird. Am anderen Ende des Meinungsspektrums liegt
eine sehr enge Auslegung dieser Bestimmung. Aufgrund einer strengen Verhältnismäßigkeitskon-
trolle des Sozialisierungsvorhabens einschließlich seiner hier: wohnungspolitischen – Ziele generiert
sie kaum einen Unterschied zur Prüfung am Maßstab der Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG. Dieses
Verständnis macht Art. 15 GG damit im Ergebnis weitgehend überflüssig. Dazwischen findet sich ein
breites Spektrum unterschiedlich nuancierter Auffassungen, in das sich auch die vorliegende Unter-
suchung einfügt.
Angesichts der Besonderheit des Art. 15 GG als judikatives Neuland liegt es nahe, zunächst gründlich
seine Genesis zu klären sowie nach seinem zeithistorischen Entstehungskontext und den Zielen der
Mütter und Väter des Grundgesetzes zu fragen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass hier mit
einigen Missverständnissen aufzuräumen ist: So finden sich letztlich keine hinreichend belastbaren
genetischen Anhaltspunkte für das sehr weite Verständnis des Art. 15 GG.
Im Ergebnis versteht die hier entwickelte Interpretation Art. 15 GG so, dass die Norm nur dann eine
Vergesellschaftung zu legitimieren vermag, wenn diese den historisch nachweisbaren (und teleolo-
gisch überzeugenden) Zweck verfolgt, eine auch gesellschaftsrelevant problematische Macht markt-
dominanter Unternehmen zu bekämpfen. In diesem Fall wird eine Sozialisierung als geeignete Maß-
nahme angesehen, die regelmäßig auch den Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitstest beste-
hen wird.
Was heißt das nun für das Berliner Vorhaben? Nach hier begründeter Auffassung sind die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine Sozialisierung nicht erfüllt. Sie würde die reduzierten Hür-
den einer modifizierten, eher weniger strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Sozialisierungen im
Fall der Bekämpfung konglomerater Unternehmensverbünde zulässt, reißen. Denn es gibt auf dem
Berliner Wohnungsmarkt nach aktuellen Feststellungen des Bundeskartellamts keine marktdominan-
ten Unternehmen. Außerdem lassen sich signifikante Abschläge von der Entschädigung nicht recht-
fertigen. Die damit in zweifacher Hinsicht attestierte Verfassungswidrigkeit des Berliner Vorhabens
wird – trotz einzelner Gegenstimmen – von zahlreichen Stellungnahmen in der Literatur, regelmäßig
mit einer zu Art. 14 GG analogen Verhältnismäßigkeits- und Entschädigungsprüfung geteilt. Das
Berliner Vorhaben sieht sich daher durchgreifenden verfassungsrechtlichen Einwänden ausgesetzt.
IIPOLICY PAPER
1 | 2022
1. Problemaufriss
Am 24. September 2021 erlangte der Berliner „Volksentscheid über einen Beschluss zur Erarbeitung
eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Woh-
nungsunternehmen“ eine Mehrheit von 56,4 % der Stimmen. In dem Entscheid wird der Berliner
Senat aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vergesellschaftung privatwirt-
schaftlicher Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen im Land Berlin durchzuführen.
Zu diesem Zwecke soll bis Ende März 2022 eine Expertenkommission eingesetzt werden, die mit der
Prüfung der Umsetzbarkeit eines entsprechenden Gesetzes beauftragt wird. Zuletzt erhöhte die Ini-
tiative den Druck auf das Land Berlin, indem sie die Mehrheit der Sitze in der Expertenkommission
forderte und mit einem Volksentscheid über ein schon ausgearbeitetes Vergesellschaftungsgesetz
drohte. 1 Im Rahmen der Vergesellschaftung soll an die betroffenen Wohnungsunternehmen eine
„Entschädigung deutlich unter Verkehrswert“ gezahlt werden. Dieses Ansinnen ist in mehrfacher Hin-
sicht von hoher politischer Brisanz, u. a. weil es zeigt, wie aufgeladen die Diskussion um die Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums inzwischen ist, dass selbst die in Deutschland hoch umstrittene, bis-
lang nicht erprobte sowie verfassungsrechtlich wenig abgesicherte Vergesellschaftung von Unterneh-
men angestrebt wird. Dabei besteht eine Vielzahl grundlegender rechtspolitischer Fragen: Warum
gerade nur die größten Unternehmen? Was kann damit tatsächlich Sinnvolles für den Wohnungs-
markt erreicht werden? Da der angemessene Schutz der Eigentumsordnung ein wesentliches Element
der sozialen Marktwirtschaft darstellt, stehen hinter dem Konflikt zudem über die Immobilienwirt-
schaft hinausgehende Fundamentalfragen unserer Wirtschaftsordnung, die sich darauf jedoch be-
sonders stark auswirken.
Da rechtliches Neuland betreten wird und in Anbetracht der Bedeutung dieser Fragen ist eine wahre
„Schlacht von Rechtsgutachten“ entstanden. Bereits 2018 gab die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen Berlin drei Rechtsgutachten in Auftrag, die sich in unterschiedlicher Tiefe mit
der rechtlichen Zulässigkeit und den Grenzen einer Vergesellschaftung großer Wohnimmobilienun-
ternehmen durch das Land Berlin beschäftigen. 2 Alle drei Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass
eine Vergesellschaftung nach dem Berliner Vorbild zulässig sei. Sowohl ein Gutachten für die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE als auch eines des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeord-
netenhauses von Berlin, jeweils aus dem Jahr 2019, halten die Vergesellschaftung ebenso für zuläs-
sig. 3
1 Vgl. dazu Der Tagesspiegel, "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" droht mit neuem Volksentscheid
v. 21.1.2022, abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/initiative-fordert-mehrheit-in-ex-
pertenkommission-deutsche-wohnen-und-co-enteignen-droht-mit-neuem-volksent-
scheid/27996360.html (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
2 Geulen, Rechtliche Stellungnahme, Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnimmobilien
v. 21.11.2018; Vorwerk, Stellungnahme v. 16.11.2018; Beckmann, Rechtliche Zulässigkeit und
Grenzen einer Vergesellschaftung bzw. Sozialisierung von Wohnimmobilien in Berlin v. 22.11.2018;
jeweils abrufbar unter: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnraum/vergesellschaf-
tung/ (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
3 Wieland, Verfassungsfragen der Vergesellschaftung von Wohnraum, Rechtsgutachten für die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE und die Fraktion Die Linke des Abgeordnetenhauses von Berlin, August
2019, abrufbar unter: https://www.uni-speyer.de/fileadmin/Ehemalige/Wieland/Rechtsgutach-
ten_VerfassungsfragenderVergesellschaftungvonWohnraum.pdf; Wissenschaftlicher Parlaments-
dienst Abgeordnetenhaus von Berlin, Gutachten zur rechtlichen Bewertung der Forderungen der Ini-
tiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ v. 21.8.2021, abrufbar unter: https://www.parlament-
berlin.de/media/download/2105 (jeweils zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
1POLICY PAPER
1 | 2022
Auf der anderen Seite gaben private Verbände mehrere Gutachten in Auftrag, die zu dem Ergebnis
kommen, dass eine Vergesellschaftung aus verschiedenen Gründen unzulässig sei. 4 Nach allen drei
Gutachten ergibt sich eine Verfassungswidrigkeit daraus, dass die Vergesellschaftung im Rahmen
des Art. 15 GG unverhältnismäßig sei, beziehungsweise gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoße. Im Raum
stehen ebenso ihre Unionsrechtswidrigkeit aufgrund eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfrei-
heit 5 sowie eine Kollision mit der Berliner Landesverfassung, 6 die eine Sozialisierung anders als das
Grundgesetz nicht vorsieht. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass zu Recht die grundrechtlichen
Fragen nach dem deutschen Grundgesetz im Vordergrund stehen, da hier verfassungsgerichtlich un-
geklärte Fragen insbesondere des Art. 15 GG zu beantworten sind – eine Norm, die bisher in der
verfassungsrechtlichen Praxis noch nicht relevant wurde und zu der daher keine (Verfassungs-)Judi-
katur existiert.
2. Gang der Überlegungen
Der verfassungsrechtliche Gehalt des Art. 15 GG ist anhand der klassischen Auslegungsregeln zu
entwickeln. Dabei prallen in der Literatur im Kern zwei Ansichten aufeinander: So orientiert sich auf
der einen Seite eine historisch-subjektive Interpretation des Art. 15 GG – tatsächlich oder vermeint-
lich – sehr stark an seinem zeitgeschichtlichen Entstehungskontext in der Nachkriegszeit und geht
davon aus, dass die Bestimmung auch heute noch primär aus dieser Entstehungsgeschichte heraus
interpretiert werden müsse. Dies erfordert in einem ersten Schritt eine umfassende historisch-gene-
tische Analyse (dazu III.): Wie hätten die Eltern des Grundgesetzes in der Nachkriegszeit – mit einer,
vorsichtig formuliert, stärker ausgeprägten Wohnungsnot – den Berliner Plan beurteilt?
In einem zweiten Schritt ist sodann kritisch zu hinterfragen, ob die primäre Fokussierung auf die
genetische Interpretation überhaupt sachgerecht ist oder nicht stärker eine objektive Interpretation,
die das Grundgesetz stärker als „living instrument“ versteht (dazu IV.). 7
Vor einer detaillierten Auseinandersetzung mit Art. 15 GG ist im Folgenden im Ausgangspunkt auf-
zuzeigen, dass in der Literatur ungewöhnlich heterogene Konzeptionen des Anwendungsbereichs der
Sozialisierungsnorm anzutreffen sind, was gewiss auch mit seiner fehlenden Anwendungspraxis zu
erklären ist (dazu V.). Sodann ist die Frage zu beantworten, ob Immobilienunternehmen tatbestand-
lich überhaupt einen tauglichen Gegenstand von Sozialisierungen darstellen können, ob es sich also
insoweit um „Produktionsmittel“ oder „Grund und Boden“ im Sinne dieser Norm handelt (dazu VI.).
Im nächsten Schritt sind die Konsequenzen für die Frage einer etwaigen Verhältnismäßigkeitskon-
trolle zu ziehen. Es ist also zu fragen, ob eine Sozialisierung von Wohnungsunternehmen ein legitimes
Ziel verfolgen sowie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein muss, oder
ob eine derartige Prüfung angesichts der Besonderheiten des Art. 15 GG – im Unterschied zu allen
4 Sodan, Rechtsgutachten, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater
Wohnungswirtschaftsunternehmen im Land Berlin, März 2019, abrufbar unter:
https://bbu.de/sites/default/files/press-releases/bbu-sodan-rechtsgutachten-2019-endfassung.pdf
und jüngst Schede/Schuldt, Gutachten, Die Einbeziehung der Genossenschaften in das von „Deut-
sche Wohnen & Co. Enteignen“ geforderte Vergesellschaftungsgesetz v. 10.9.2021, abrufbar unter:
https://www.weiterdenken-statt-enteignen.de/images/pdf/genossenschaften.pdf bzw. Battis/Hen-
nig/Lauer, Rechtsgutachtliche Stellungnahme zur verfassungsrechtlichen Umsetzbarkeit des Berliner
Volksentscheids über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur
Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen v. 22.9.2021, abrufbar
unter: https://cimg.rueckerconsult.de/Gutachten%20Vergesellschaftung_210922.pdf (jeweils zu-
letzt abgerufen am 15.3.2022).
5 Vgl. Battis/Hennig/Lauer, Rechtsgutachtliche Stellungnahme zur verfassungsrechtlichen Umsetz-
barkeit des Berliner Volksentscheids über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs
durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen v.
22.9.2021, S. 44–52.
6 So Sodan, Rechtsgutachten, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater
Wohnungswirtschaftsunternehmen im Land Berlin, 2019, S. 77–81.
7 Sehr ausgeprägt ist der Streit im US-Verfassungsrecht, wo ein Methodenstreit zwischen verschie-
denen Formen der historisierenden Auslegung – dem „originalism“ – und einer Interpretation der
Verfassung als „living document“ besteht; dazu Hillgruber, § 15 Verfassungsinterpretation, in: De-
penheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorien, 2010, S. 514 f.
2POLICY PAPER
1 | 2022
anderen Grundrechten – entfällt. Wenn das nicht der Fall ist, ist zu klären, mit welchen Maßstäben
die Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist (dazu VII.). Eng damit verbunden ist die Frage, nach welchen
rechtlichen Bewertungsparametern sich die Entschädigungshöhe richtet. Hier besteht angesichts des
klaren Wortlauts von Art. 15 GG („durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt“)
immerhin Einigkeit über die Notwendigkeit einer Entschädigung. Der Streit wird stattdessen über
deren Höhe geführt, was wiederum für die praktische Realisierbarkeit des Vorhabens relevant ist
(dazu VIII.). In einem Exkurs soll knapp auf die weiterführenden Aspekte hingewiesen werden, dass
der Verzicht auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung und eine laxe Entschädigung mit erheblichen Ab-
schlägen auch in unionsrechtlicher Perspektive problematisch sein kann (IX.). Ein Fazit mit Ausblick
beschließt den Gang der Untersuchung (dazu X.).
Verfassungsrechtsprechung fehlt bislang zu all den aufgeworfenen Fragen. Rechtliche Analysen sind
dagegen vor allem dank der Berliner Initiative in jüngster Zeit – auch in Form der zahlreichen ge-
nannten Gutachten – reichlich vorhanden. 8
3. Historisch-genetische Analyse des Art. 15 GG
Bei der Beurteilung einer seit Inkrafttreten des Grundgesetzes und damit für mehr als 70 Jahre
praktisch bedeutungslosen Verfassungsnorm – symptomatisch ist die Bezeichnung als „Verfassungs-
fossil“ 9 – stellt eine umfassende historisch-genetische Analyse eine interessante Ausgangslage für
die Interpretation des Art. 15 GG dar. 10 Im Zentrum steht dabei die Frage, was die Mütter und Väter
des Grundgesetzes mit der „Sozialisierungsklausel“ des Art. 15 GG bezweckten.
Dazu soll zunächst ein Blick auf die Vorgängernorm des Art. 15 GG in der Weimarer Reichsverfassung
und die Sozialisierungsbestrebungen in der Weimarer Republik geworfen werden (dazu 1.). Sodann
spielt der historische Kontext der Debatte um eine Sozialisierung im Nachkriegsdeutschland eine
große Rolle (dazu 2.). Schließlich bildet die Entstehungsgeschichte des Art. 15 GG mit dem Verfas-
sungsentwurf von Herrenchiemsee (dazu 3.) und den Diskussionen im Parlamentarischen Rat (dazu
4.) Kernstücke der genetischen Analyse.
3.1 Die Sozialisierungsregelung in Art. 156 WRV und ihre Vorläufer
Die Sozialisierungsregelung ist kein Kind des Grundgesetzes. Schon in der Weimarer Republik hatte
sich ein Sozialisierungsgedanke entwickelt. 11 In der Regierungserklärung des Kabinetts Scheidemann
vom Februar 1919 wurde erstmals gefordert, „Wirtschaftszweigen, die nach ihrer Art und ihrem Ent-
wicklungsstand einen privatmonopolistischen Charakter angenommen haben“, der „öffentlichen Kon-
trolle zu unterstellen“. 12 Im März 1919 führte das Sozialisierungsgesetz die Befugnis des Staates ein,
8
Neben den genannten Gutachten (s. bereits Fn. 2–4) ebenso zu der Thematik Battis, DRiZ 2021,
410; Fleckenstein, GE 2019, 166; Haaß, LKV 2019, 145; Hien, ZfIR 2019, 226; Ipsen, NdsVBl. 2019,
298; ders., NVwZ 2019, 527; Kloepfer, NJW 2019, 1656; Knauthe, ZfIR 2020, 689; dies., ZfIR 2019,
509; Lörler, NJ 2019, 273; Manssen, ZfIR 2020, 733; Petersen/Maier, ZfIR 2019, 737; Röhner, KJ
2020, 16; Schede/Schuldt, ZRP 2019, 78; Schmidt, DÖV 2019, 508; Sodan/Ferlemann, LKV 2019,
193; Thiel, LKV 2021, 385; ders., ZfBR 2021, 523; ders., DÖV 2019, 497; Waldhoff/Neumeier, LKV
2019, 385; Wolfers/Opper, DVBl. 2019, 542; Zivier, RuP 2019, 257.
9 So Depenheuer/Froese, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 1, 7. Aufl.
2018, Art. 15 GG Rn. 4.
10 Zur Bedeutung der Entstehungsgeschichte und der geschichtlichen Rahmenbedingungen für die
Auslegung des Grundgesetzes allgemein Sachs, in ders. (Hrsg.), GG Kommentar, 9. Aufl. 2021, Ein-
führung Rn. 41 m. w. N.
11 Zu den Entwicklungen im deutschen Kaiserreich Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013,
S. 9–12.
12 Vgl. Ziffer 7 der Regierungserklärung, abgedruckt bei Friedländer, in: Nipperdey (Hrsg.), Grund-
rechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. 3, 1930, Art. 156 WRV, S. 325.
3POLICY PAPER
1 | 2022
geeignete wirtschaftliche Unternehmen gegen eine angemessene Entschädigung zu vergesellschaf-
ten. 13 In der am 11. August 1919 in Kraft getretenen Weimarer Reichsverfassung wurde die Mög-
lichkeit einer Sozialisierung dann erstmals konstitutionell geregelt. 14 Die Regelung ähnelte der des
Sozialisierungsgesetzes, wobei sie der Verweis auf die Enteignungsbestimmungen in Art. 153 WRV
weiter einschränkte. 15 Aufgrund des Ermessens des Gesetzgebers („kann“), der Unbestimmtheit der
Sozialisierungsobjekte („geeignete“) sowie der Entschädigungspflicht („angemessene Entschädi-
gung“) scheiterten Sozialisierungsvorhaben vor allem an der fehlenden politischen Durchsetzbarkeit
und der mangelnden finanziellen Umsetzbarkeit. So zielte auch die Weimarer Nationalversammlung
nicht auf eine flächendeckende Sozialisierung ab, was auch der nachfolgenden Staatspraxis ent-
sprach. 16
Dem Art. 156 WRV lag ein Verständnis der Sozialisierung zu Grunde, wonach sie die Gemeinwohl-
verpflichtung der Wirtschaft verstärken sollte. 17
3.2 Die historischen Hintergründe der Sozialisierungsdiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg
BIM In historischer Perspektive ist Art. 15 GG zudem vor dem Hintergrund der politischen und wirt-
schaftlichen Gesamtlage im Nachkriegsdeutschland zu betrachten. 18 Neben den politischen Debatten
über die Ausrichtung der Wirtschaftsordnung innerhalb der und zwischen den beiden großen Parteien
als späteren Hauptakteuren des Parlamentarischen Rates – namentlich der CDU/CSU einerseits und
der SPD andererseits – liefern die schon vor dem Jahr 1949 erlassenen landesverfassungsrechtlichen
Vorschriften Anhaltspunkte für die Sozialisierungsdiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die SPD ging zunächst davon aus, dass ein Wiederaufbau Deutschlands nur in einer sozialen Demo-
kratie mit sozialistischen Elementen gelingen könne. 19 Im Hinblick auf die Wirtschaftsordnung for-
derte der Parteivorsitzende Schumacher die Vergesellschaftung des „Kapitals“, das eine nicht zu
kontrollierende Machtzusammenballung darstelle und damit politischen Einfluss nehmen könne. 20
13 § 2 Sozialisierungsgesetz (Auszug) (RGBl. 1919, S. 341):
„Das Reich ist befugt, im Wege der Gesetzgebung gegen angemessene Entschädigung
1. für eine Vergesellschaftung geeignete wirtschaftliche Unternehmungen, insbesondere solche
zur Gewinnung von Bodenschätzen und zur Ausnutzung von Naturkräften, in Gemeinwirtschaft
zu überführen,
[…]
Die näheren Vorschriften über die Entschädigung bleiben den zu erlassenden besonderen Reichs-
gesetzen vorbehalten.“
14 Art. 156 WRV (Auszug) (RGBl. 1919, S. 1383):
„(1) Das Reich kann durch Gesetz, unbeschadet der Entschädigung, in sinngemäßer Anwendung
der für Enteignung geltenden Bestimmungen, für die Vergesellschaftung geeignete private wirt-
schaftliche Unternehmungen in Gemeineigentum überführen. Es kann sich selbst, die Länder
oder die Gemeinden an der Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmungen und Verbände beteili-
gen oder sich daran in anderer Weise einen bestimmenden Einfluss sichern.
[…].“
15 So war eine Enteignung gemäß § 153 Abs. 2 WRV nur zum „Wohle der Allgemeinheit“ und gegen
eine „angemessene Entschädigung“ möglich.
16 Die wenigen Anwendungsfälle des Sozialisierungsgesetzes und Art. 156 WRV sind dargestellt bei
Dietlein, in: Stern/Sachs/ders. (Hrsg.), Staatsrecht, Bd. IV, 2006, § 113, S. 2307, der von „reinen
Programmvorschriften“ spricht.
17 Schliesky, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar GG, Art. 15 Rn. 15 (Stand: Au-
gust 2011).
18 So heißt es bei Von Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz, 1. Aufl. 1953, Einl., S. 1. bezeichnend:
„Art und Charakter einer jeden Verfassung sind aufs stärkste von der staatsrechtlichen Gesamtsitu-
ation abhängig, in der sie wächst.“
19 Als Repräsentant dieser Idee galt der Parteivorsitzende Kurt Schumacher; vgl. u. a. seine Rede
„Aufgaben und Ziele der deutschen Sozialdemokratie“ auf dem ersten Parteitag vom 8. - 10.5.1946
in Hannover; vgl. Protokoll SPD-Parteitag 1946, S. 23–56., abrufbar unter: http://library.fes.de/par-
teitage/pdf/pt-jahr/pt-1946.pdf (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
20 Vgl. Antoni, Sozialdemokratie und Grundgesetz, Bd. 1, 1991, S. 127.
4POLICY PAPER
1 | 2022
Dabei wurde die Verstaatlichung allerdings nicht (mehr) als zwingend betrachtet. 21 Viel wichtiger ist
im vorliegenden Kontext jedoch der Umstand, dass sich die Idee der Vergesellschaftung auf zentrale
Industriezweige wie beispielsweise Kohle, Eisen und Erdöl beschränkte. 22 Die SPD sah darin ein Mittel
zur Bekämpfung von Machtkonzentrationen in bestimmten Industriezweigen. 23 Dabei stand vor allem
die Schwerindustrie im Fokus der Sozialisierung, auf deren entscheidende Rolle in den vergangenen
Kriegen hingewiesen wurde. 24 Die vom Sozialisierungskatalog nicht umfassten Wirtschaftsbereiche
sollten einer Sozialisierung ausdrücklich nicht zugänglich sein. 25 Hinsichtlich der Wohnungswirtschaft
fällt auf, dass zwar ein Mangel an Wohnraum festgestellt, eine Vergesellschaftung in diesem Bereich
allerdings gerade nicht (!) erwogen wurde. 26
In der CDU gab es unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Vorstellung eines „christ-
lichen Sozialismus“, in dessen Rahmen eine „Überführung gewisser großer Urproduktionen, Großin-
dustrien und Großbanken in Gemeineigentum“ angestrebt wurde. 27 Auch im Ahlener Programm, also
dem damaligen Wirtschaftsprogramm der CDU der britischen Zone, wird 1947 noch eine Vergesell-
schaftung der Eisen- und der Kohleindustrie gefordert. 28 In den darauffolgenden zwei Jahren schlug
die CDU, unter anderem geprägt durch den späteren ersten Bundeswirtschaftsminister Ludwig Er-
hard, den wirtschaftspolitischen Kurs der „sozialen Marktwirtschaft“ ein. 29 Die Zustimmung zu einer
Sozialisierung nahm daher in den Reihen der CDU stetig ab. 30
Die teilweise schon vor 1949 erlassenen Landesverfassungen stellten eine Orientierung für den Par-
lamentarischen Rat dar. 31 Auch darin fand die Idee der Sozialisierung Anklang. Besonders hervorge-
hoben sei insoweit der heute noch wortgleiche Art. 41 der Hessischen Landesverfassung aus dem
Jahr 1946, der nicht nur eine Sozialisierung ermöglichen sollte, sondern diese – wiederum in den
21 Vgl. SPD, Grundgedanken eines sozialistischen Wirtschaftsprogrammes, 1946, S. 12, wo es heißt:
„Verstaatlichung der Produktionsmittel gilt in der modernen sozialistischen Theorie schon längst nicht
mehr als die einzige und konsequenteste Form der Sozialisierung. Sie ist vielmehr nur noch ein Mittel
neben anderen beim Ausbau der sozialistischen Wirtschaftsordnung“, abrufbar unter
http://library.fes.de/prodok/fa-28009.pdf (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
22 Vgl. z. B. der auf der wirtschaftspolitischen Tagung 1947 vorgestellte Sozialisierungskatalog; Re-
ferat abgedruckt bei Nölting, Freiheit und Bindung in der sozialistischen Wirtschaft, in: Weber/ders.,
Sozialistische Wirtschaftsordnung, Beiträge zur Diskussion, 1948, S. 35. Noch restriktiver Zorn, der
auf dem Parteitag 1948 eine Beschränkung auf Bereiche fordert, die Private „nicht durchführen kön-
nen oder wollen“, vgl. Protokoll SPD-Parteitag 1948, S. 146, abrufbar unter:
http://library.fes.de/parteitage/pdf/pt-jahr/pt-1948.pdf (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
23 Bezeichnend dafür ist die von Nölting, Freiheit und Bindung in der sozialistischen Wirtschaft, in:
Weber/ders., Sozialistische Wirtschaftsordnung, Beiträge zur Diskussion, 1948, S. 35, aufgestellte
„allgemeine Formel“: „Überall, wo sich monopolistische, marktbeherrschende Tendenzen geltend
machen, wächst die Sozialisierungsreife.“
24 SPD, Grundgedanken eines sozialistischen Wirtschaftsprogrammes, 1946, S. 17.
25 So u. a. Nölting, Freiheit und Bindung in der sozialistischen Wirtschaft, in: Weber/Nölting, Sozia-
listische Wirtschaftsordnung, Beiträge zur Diskussion, 1948, S. 30 f.; s. dazu Ott, Wirtschaftskon-
zeption der SPD, 1978, S. 147.
26 SPD, Grundgedanken eines sozialistischen Wirtschaftsprogrammes, 1946, S. 21. Allerdings war
die Eigentumsstruktur auf den Wohnungsmärkten nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere als heute
und eine andere als in der damaligen Montanindustrie. So gab es keine großen Wohnungskonzerne,
wohl aber zu Unternehmen gehörende Wohnungsbestände, häufig als Mitarbeiterwohnungen.
27 So u. a. proklamiert in CDU, Frankfurter Leitsätze, 1945, abrufbar unter: http://www.kas.de/up-
load/ACDP/CDU/Programme_Beschluesse/1945_Frankfurter-Leitsaetze.pdf (zuletzt abgerufen am
15.3.2022).
28 Vgl. Zonenausschuss der CDU für die britische Zone, Ahlener Programm v. 3.2.1947, abrufbar
unter: http://www.kas.de/upload/themen/programmatik_der_cdu/programme/1947_Ahlener-Pro-
gramm.pdf (zuletzt abgerufen am 15.3.2022).
29 Zu den Anfängen der Idee der sozialen Marktwirtschaft Kleinmann, Geschichte der CDU, 1993,
S. 92 - 96.
30 Die Sozialisierung hatte in dem Wirtschaftsprogramm der CDU von 1949 praktisch keine Bedeu-
tung mehr; s. dazu CDU, Düsseldorfer Leitsätze über Wirtschaftspolitik, Landwirtschaftspolitik, Sozi-
alpolitik, Wohnungsbau v. 15.7.1949, abrufbar unter: http://www.kas.de/upload/ACDP/CDU/Pro-
gramme_Bundestag/1949_Duesseldorfer-Leitsaetze.pdf (zuletzt abgerufen am 15.3.2022); vgl. Brü-
ckner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 70.
31 Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 80. Bis 1949 traten in Bayern, Bremen, Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Landesverfassung in Kraft.
5POLICY PAPER
1 | 2022
beschränkten „kriegsrelevanten“ Bereichen – explizit vorsah. 32 Die Vergesellschaftung wurde also
nicht in das bloße Ermessen der staatlichen Organe gestellt, sondern kraft Verfassung vorgeschrie-
ben. 33
Diese Idee einer Verstaatlichung bestimmter Groß- und Schlüsselindustrien durch die Verfassung
selbst fand sich erstmals in dem von Georg August Zinn und Adolf Arndt ausgearbeiteten Verfas-
sungsentwurf der SPD aus dem Jahr 1946 wieder. 34 Die CDU schlug hingegen Sozialisierungsmaß-
nahmen nur für „unpersönlich“ gewordenes Eigentum vor, da dies „fast stets zu einem Instrument
der Beherrschung anderer Menschen oder sogar des Staates“ gebraucht werde. 35 Dabei ist unter
„unpersönlichem“ Eigentum wiederum ein solches an Grund- und Schlüsselindustrien zu verstehen. 36
Im Gegensatz zu den sehr konkreten Vorstellungen der SPD in Form eines Katalogs von Industrien
und einer unmittelbaren Sozialisierung erscheint der Vorschlag der CDU eher als ein Mittel zur Be-
kämpfung von Machtkonzentrationen im Ausnahmefall. Bei der Ausarbeitung der Landesverfassung
selbst war vor allem das linke Lager, bestehend aus der SPD und der KPD, treibende Kraft für die
Aufnahme einer Sozialisierungsvorschrift. Diese Kräfte konnten die CDU schließlich von einer Zustim-
mung zur unmittelbaren Sozialisierung im Verfassungswege überzeugen. 37
Auch in die Bayerische Verfassung wurde mit Art. 160 Abs. 2 eine Sozialisierungsregelung aufge-
nommen. 38 Bei ihr steht allerdings die Sozialisierung im Ermessen der staatlichen Gewalt und es
bedarf eines Ausführungsgesetzes, sodass die Regelung vergleichbar mit der des Art. 156 WRV ist. 39
Die Analyse der parteipolitischen Vorstellungen und der Diskussionen über die Sozialisierungsvor-
schriften der Landesverfassungen zeigt demnach einen parteiübergreifenden Konsens darüber, dass
eine Machtkonzentration in den zentralen und vor allem kriegsrelevanten Wirtschaftszweigen insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus verhindert werden sollte. Die
unterschiedliche Schärfe der bereits erlassenen landesverfassungsrechtlichen Sozialisierungsrege-
lungen zeigt zudem, dass die Kompromissbereitschaft hinsichtlich der Fragen des „Ob“ und des „Wie“
von Vergesellschaftungen groß war.
32 Art. 41 LVerf Hessen (Auszug) (GVBl. 1946, S. 229):
„(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden
1. in Gemeineigentum überführt:
der Bergbau (Kohle, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung, die Betriebe
der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen gebundenen Verkehrswesen
[…].
(2) Das Nähere bestimmt das Gesetz.
[…].“
33 Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 88.
34 Art. 39 Abs. 2 des Entwurfes lautete: „Gemeineigentum sind ohne weiteres die Betriebe des Berg-
baus, der Eisen- und Stahlerzeugung, der Energiewirtschaft, der Banken, des Versicherungswesens,
des schienen- oder an Oberleitungen gebundenen Verkehrswesens, die Filmindustrie, Lichtspiele so-
wie Post- und Rundfunk.“
35 Vgl. die Leitsätze der CDU zur neuen Verfassung v. 28.6.1946; zu finden bei Beyer, Die verfas-
sungspolitischen Auseinandersetzungen um die Sozialisierung in Hessen 1946, 1977, S. 129.
36 Beyer, Die verfassungspolitischen Auseinandersetzungen um die Sozialisierung in Hessen 1946,
1977, S. 130.
37 Mit 49 der 90 Sitze hatten die KPD und die SPD die Mehrheit in der verfassungsgebenden Ver-
sammlung, sodass das bürgerliche Lager um die CDU/FPD ohnehin zu Kompromissen gezwungen
war.
38 Der Wortlaut der aktuellen Sozialisierungsvorschriften der Landesverfassungen ist zu finden bei
Schliesky, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar GG, Art. 15, Anhang Rn. 63 (Stand:
August 2011). 1949 gab es zudem in Bremen und Rheinland-Pfalz bereits eine verfassungsrechtliche
Sozialisierungsvorschrift.
39 Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 126. Diese deutlich „mildere“ Sozialisierungs-
vorschrift kann in Anbetracht der Mehrheit der CSU (109 der 200 Sitze in der verfassungsgebenden
Versammlung) wiederum als Zugeständnis aus Sicht der SPD angesehen werden.
6POLICY PAPER
1 | 2022
3.3 Der Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee
Im Rahmen der unmittelbaren Genese des Grundgesetzes sind sodann zunächst der Inhalt und das
Zustandekommen des Verfassungsentwurfes von Herrenchiemsee 40 von Interesse. Der Unteraus-
schuss I des Konvents von Herrenchiemsee fügte in den Grundrechtskatalog folgenden Artikel S ein:
„Die Überführung von Bodenschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum bedarf eines be-
sonderen Gesetzes.“ 41 Diese Formulierung wurde wortgleich in Art. 18 des Herrenchiemseer Verfas-
sungsentwurfes (HChE) übernommen. 42 Dabei wurde klargestellt, dass ein Gesetz auch eine ganze
Gruppe gleichartiger Unternehmen erfassen könne. 43 Es blieb im Rahmen des Konvents bei dieser
Fassung, die einstimmig beschlossen wurde.
Art. 18 HChE unterschied sich von den bisherigen verfassungsrechtlichen Sozialisierungsvorschriften
schon durch seine Positionierung im Grundrechtskatalog. 44 Der Wortlaut des Art. 18 HChE ist sehr
kurz. 45 So gibt die Norm keinen Aufschluss über eine etwaige Entschädigung und definiert die Sozi-
alisierungsobjekte nicht näher.
Dennoch bildete dieser knappe Entwurf die Grundlage für die Ausarbeitung des Art. 15 GG im Parla-
mentarischen Rat. Aus dem Zustandekommen des Art. 18 HChE und dem Diskussionsverlauf lässt
sich ein Konsens der Mitglieder des Konvents über die Aufnahme einer Sozialisierungsvorschrift in
das Grundgesetz (also das „Ob“) schließen ebenso wie die Auffassung, dass die Frage der Ausgestal-
tung (also das „Wie“) dagegen dem Parlamentarischen Rat überlassen werden sollte.
3.4 Diskussion im Parlamentarischen Rat
Die finale Ausarbeitung des späteren Art. 15 GG war demnach Aufgabe des Parlamentarischen Rates.
Ausgangspunkt dafür bildete Art. 18 HChE, mit dem sich der Ausschuss für Grundsatzfragen 46 in der
ersten Lesung am 8. Oktober 1948 erstmals beschäftigte. 47 Dabei wurde die Aufnahme einer Sozia-
lisierungsvorschrift nicht grundlegend in Frage gestellt. 48 Sehr weit gehend wies Carlo Schmid (SPD)
darauf hin, dass Art. 18 GG-Entwurf eigenständig und unabhängig von der Individualenteignung nach
Art. 17 GG-Entwurf zu verstehen sei. Er solle als „strukturelle Umwandlung der Wirtschaftsverfas-
sung“ gelten. 49 Der Redaktionsausschuss legte daraufhin am 16. November 1948 zwei Varianten für
Art. 18 GG-Entwurf vor. Der Vorschlag des Abgeordneten Zinn (SPD) erweiterte den Anwendungs-
bereich der Norm auf „ganze Produktions- und Wirtschaftszweige“, wohingegen die Variante der Ab-
geordneten von Brentano (CDU) und Dehler (FDP) weitere Restriktionen für eine Sozialisierung auf-
stellte („wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert“; „für die Entschädigung gilt Art. 17 Abs. 3
40 Der „Sachverständigen-Ausschuss für Verfassungsfragen“ tagte vom 10.–23.8.1948 im Schloss
Herrenchiemsee.
41 Vgl. Bericht des Unterausschusses I, Bucher, in: Wernicke/Booms (Hrsg.), Der Parlamentarische
Rat, Bd. 2, 1981, S. 226.
42 Der Entwurf ist abgedruckt bei Bucher, in: Wernicke/Booms (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat,
Bd. 2, 1981, S. 579–614.
43 Vgl. Bericht über den Verfassungskonvent, abgedruckt bei Bucher, in: Wernicke/Booms (Hrsg.),
Der Parlamentarische Rat, Bd. 2, 1981, S. 515.
44 In der zweiten Plenarsitzung am 11.8.1948 wurde noch vorgeschlagen, die Sozialisierung im Zu-
ständigkeitskatalog für die Gesetzgebung zu regeln, vgl. Bucher, in: Wernicke/Booms (Hrsg.), Der
Parlamentarische Rat, Bd. 2, 1981, S. 75.
45 Der Entwurfscharakter könnte sich dadurch erklären, dass die Akteure ihre Ausarbeitung nicht als
direkte Vorlage für die folgende Diskussion im Parlamentarischen Rat erachtet haben, vgl. Brückner,
Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 168
46 Die sechs Fachausschüsse waren dafür zuständig, die einzelnen Abschnitte des Grundgesetzes für
den Hauptausschuss vorzubereiten, wobei der Fachausschuss für Grundsatzfragen u. a. die Grund-
rechte behandelte.
47 8. Sitzung am 8.10.1948, Pikart/Werner, in Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat,
Bd. 5, 1991, S. 213 f.
48 Über den (überraschenderweise) lagerübergreifenden Konsens aus damaliger Sicht Werner, NJW
1949, 329.
49 Vgl. 8. Sitzung am 8.10.1948, Pikart/Werner, in Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische
Rat, Bd. 5, 1991, S. 213 f.
7POLICY PAPER
1 | 2022
S. 2“) . 50 Die zwei Varianten zeigen, dass sich trotz des grundsätzlichen Konsens die Vorstellungen
von der „Schärfe“ der Sozialisierungsvorschrift in den Lagern des Parlamentarischen Rates unter-
schieden. 51 Bei der zweiten Lesung des Grundsatzausschusses am 30. November 1948 ging es unter
anderem um die Verweisung auf Art. 17 GG-Entwurf. 52 Von Mangoldt (CDU) schlug stellvertretend
für seine Fraktion eine explizite Verweisung auf Art. 17 GG-Entwurf vor, wohingegen Bergsträsser
für die SPD nur „im Wege der Enteignung“ ergänzen wollte. Dabei bezweckte die CDU/CSU-Fraktion
mit dem expliziten Verweis, die Überführung in Gemeineigentum entgegen der Vorstellung in der
ersten Sitzung eher als Sonderform der Individualenteignung zu konzipieren. 53 Es wurde schließlich
ein Kompromiss aus beiden Vorschlägen beschlossen, der wie folgt lautet: „Die Überführung von
Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum im Wege der Ent-
eignung des Art. 17 ist nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes zulässig.“
Auf Basis dieser Fassung beschäftigte sich der Hauptausschuss im Rahmen der ersten Lesung am 4.
November 1948 das erste Mal mit der Sozialisierungsvorschrift. 54 Hier ging es erneut um das Ver-
hältnis von Art. 15 GG zu Art. 14 GG. Nachdem in der zweiten Lesung des Hauptausschusses am 19.
Januar 1949 nur sprachliche Änderungen des Grundsatzausschusses angenommen wurden, legte der
Allgemeine Redaktionsausschuss eine Fassung vor, wonach eine Sozialisierung nur vorlag, wenn die
Sozialisierungsobjekte „unmittelbar in Gemeineigentum überführt werden“. 55 Ähnlich schlug der Fün-
ferausschuss, der zum Vorantreiben der festgefahrenen Verhandlungen zum Grundgesetz insgesamt
eingesetzt wurde, eine Fassung vor, in der die Konditionierung „zum Zwecke der Vergesellschaftung“
ergänzt wurde. 56 Diese Formulierungen sollten den Anwendungsbereich des Art. 15 GG von der In-
dividualenteignung gemäß Art. 14 GG abgrenzen. 57 Der Vorschlag des Fünferausschusses 58 wurde in
der dritten Lesung des Hauptausschusses im Wesentlichen übernommen. 59 In der abschließenden
vierten Lesung des Hauptausschusses am 5. Mai 1949 stellte der Abgeordnete Seebohm (Deutsche
Partei) einen Antrag, Art. 15 zu streichen. 60 Nachdem dieser abgelehnt wurde, stellte er ihn erneut
erfolglos in der zweiten Lesung im Plenum des Parlamentarischen Rates am 6. Mai 1949. 61 Er be-
gründete ihn damit, dass mit Art. 14 GG allen Notwendigkeiten, in das Eigentum einzugreifen, Ge-
nüge getan sei. Deswegen sei es weder notwendig noch vertretbar, die Sozialisierungsregelung in
den Grundrechtekatalog aufzunehmen. 62 Die Ablehnung des Streichungsantrages verdeutlicht er-
neut, dass im Parlamentarischen Rat ein breiter Konsens über die Aufnahme einer Sozialisierungs-
ermächtigung bestand.
50 Die Varianten sind abgedruckt bei Hollmann, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische
Rat, Bd. 7, 1995, S. 41.
51 Ähnlich auch Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 175.
52 26. Sitzung am 30.11.1948, Pikart/Werner (Hrsg.), in: Schick/Kahlenberg, Der Parlamentarische
Rat, Bd. 5, 1995, S. 737 f.
53 Vgl. zu den Hintergründen Schockenhoff, Wirtschaftsverfassung und Grundgesetz, 1986, S. 170.
Mit einem expliziten Verweis auf die Enteignung auch schon die genannte zweite Variante des Re-
daktionsausschusses von Bretano/Dehler.
54 18. Sitzung am 4.11.1948, Feldkamp, in: Risse/Weber (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 14,
2009, S. 536 f.
55 Stellungnahme v. 25.1.1949, Hollmann, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat,
Bd. 7, 1995, S. 214 f.
56 Änderungsvorschläge v. 31.1.1949, Hollmann, in Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische
Rat, Bd. 7, 1995, S. 308.
57 Die Begründung des Redaktionsausschusses lautete: „[…] dessen rechtliche Bedeutung darin liegt,
daß hier nicht eine Individual-Enteignung auf Grund eines Gesetzes […] und vermittels eines Verwal-
tungsaktes oder einer gerichtlichen Einzelentscheidung, sondern eine Gruppenenteignung unmittel-
bar, aber auch nur durch Gesetz ermöglicht wird.“, vgl. Hollmann, in Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der
Parlamentarische Rat, Bd. 7, 1995, S. 215.
58 Der Ausschuss bestand aus zwei SPD-, zwei CDU- und einem FDP-Abgeordneten und war für
umstrittene Grundentscheidungen zuständig.
59 47. Sitzung am 8.2.1949, Feldkamp, in: Risse/Weber (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 14,
2009, S. 1496 f.
60 57. Sitzung am 5.5.1949, Feldkamp, in: Risse/Weber (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 14,
2009, S. 1790 f.
61 9. Sitzung am 6.5.1949, Werner, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 9,
1996, S. 456 f.
62 Vgl. Werner, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 9, 1996. S. 456.
8POLICY PAPER
1 | 2022
Bei der dritten Lesung im Plenum am 8. Mai 1949 ergaben sich keine Änderungen. Allerdings machte
der Abgeordnete Menzel (SPD) folgende im vorliegenden Zusammenhang interessanten Ausführun-
gen zu Art. 15 GG: „Gerade hieraus erhoffen wir Sozialdemokraten in der Vorstellungswelt der Deut-
schen eine zunehmende Einsicht über die Notwendigkeit, die deutschen Schlüsselindustrien in Ge-
meineigentum zu überführen.“ 63 Der Aussage lässt sich entnehmen, dass die Sozialdemokraten die
Einführung des Art. 15 GG als Gewinn verbuchten. Dennoch fällt auf, dass Art. 15 GG wohl auch nach
ihrem Verständnis ein reduzierter Katalog der Sozialisierungsgegenstände zu Grunde liegen und auf
Schlüsselindustrien fokussiert sein sollte.
Insgesamt zeigen die Diskussionen im Parlamentarischen Rat, dass abgesehen von den Streichungs-
anträgen der Deutschen Partei die Aufnahme einer Sozialisierungsermächtigung als „notwendige Be-
dingung“ auf einen breiten Konsens stieß. 64 Ein zentraler Streitpunkt war das Verhältnis von Art. 15
zu Art. 14 GG. Die Sozialisierung wurde schließlich eigenständig in die Verfassung aufgenommen.
Diese eigenständige Bedeutung hatte die SPD wiederholt in den Verhandlungen betont. Eine ent-
schädigungslose Vergesellschaftung schloss der Passus „ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt“ aus. Dieser Aspekt entsprach insbesondere den Interessen des bürgerlichen La-
gers um die CDU. 65 Unabhängig von der Diskussion über die Ausgestaltung der Vorschrift und den
damit einhergehenden Kompromissen legte eine breite Mehrheit im Parlamentarischen Rat in Bezug
auf die Frage des „Was?“ einer Sozialisierung, also der Sozialisierungsobjekte, ein eher zurückhal-
tendes Verständnis zugrunde. 66
3.5 Zwischenfazit
Insgesamt gibt eine umfassende historisch-genetische Analyse des Art. 15 GG bemerkenswerten
Aufschluss darüber, was sich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates von der Einführung des
Art. 15 GG versprochen haben. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man in der Sozialisierung tenden-
ziell ein Mittel zur Gemeinwohlverpflichtung bestimmter Wirtschaftszweige gesehen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg änderte sich die Zielrichtung hin zu einer Monopol- und Machtbekämpfung in zentralen
Industriezweigen. Dabei lag der Zweck der Vergesellschaftung nicht darin, die (Daseinsvorsorge-
)Aufgaben der zu sozialisierenden Wirtschaftszweige in staatlicher Hand besser zu erfüllen. Vielmehr
zeigt der Verlauf der Sozialisierungsdiskussion vom Zweiten Weltkrieg bis zum Grundgesetz, dass
die Sozialisierung zunehmend als „ultima ratio“ zur Verhinderung einer Machtkonzentration in den
Schlüsselindustrien gesehen wurde und man stattdessen mit einem staatlichen Eingriff in die Wirt-
schaft im Übrigen immer zurückhaltender wurde. 67
4. Subjektive oder auch objektive Interpretation des Art. 15 GG?
Es stellt sich die Frage, ob sich die Auslegung des Art. 15 GG im Wesentlichen auf diese Ergebnisse
der historisch-genetischen Analyse beschränken sollte. Im Gegensatz zu einer derartigen subjektiven
Auslegung steht eine Interpretation unter Zugrundelegung des vollständigen juristischen Ausle-
gungskanons, die sich dabei auch dem zeitlichen Wandel stärker öffnet. Das Ziel einer Auslegung
liegt darin, den objektivierten Willen des (verfassungsgebenden) Gesetzgebers und nicht seinen rein
63 10. Sitzung am 8.5.1949, Werner, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 9,
1996, S. 528.
64 Vgl. auch Durner, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG Kommentar, Art. 15 Rn. 16 f. (Stand: März
2019).
65 Vgl. Schockenhoff, Wirtschaftsverfassung und Grundgesetz, 1986, S. 174.
66 Anders nur die KPD, die in einer Eingabe v. 12.10.1948 die zwingende Überführung aller Boden-
schätze, Naturkräfte sowie der Stahl- und Chemieindustrie, die Enteignung des Großgrundbesitzes
sowie eine Ermächtigung zur Sozialisierung aller geeigneten „privaten wirtschaftlichen Unternehmen“
vorsah, vgl. Pikart/Werner, in: Schick/Kahlenberg (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat, Bd. 5, 1993,
S. 256.
67 Bezeichnend für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass Rudolf Zorn für sein Wirtschaftskonzept
der „regulierten Marktwirtschaft“ schon 1948 auf dem Parteitag der „sozialisierungsfreundlichen“ SPD
Zustimmung erhalten hat, vgl. Protokoll SPD-Parteitag 1948, S. 147 f.; ausführlich dazu Antoni, So-
zialdemokratie und Grundgesetz, Bd. 2, 1992, S. 29 - 31.
9POLICY PAPER
1 | 2022
subjektiven Willen zu erfassen. 68 Dabei dienen die klassischen Auslegungsmethoden – grammatika-
lische, historische bzw. genetische, systematische und teleologische Auslegung – auch bei grundge-
setzlichen Normen als Interpretationshilfe. 69 Diese Methoden stehen grundsätzlich gleichrangig ne-
beneinander, 70 wobei der im Rahmen der grammatikalischen Auslegung zu bewertende Wortlaut eine
äußere Interpretationsgrenze darstellt. 71
Bei der rechtswissenschaftlichen Diskussion um die Auslegung des Art. 15 GG fällt auf, dass die
Entstehungsgeschichte rund um die Beratung im Parlamentarischen Rat als Auslegungsmethode ein
vergleichsweise großes Gewicht hat. Man könnte meinen, dies sei nicht verwunderlich, weil die Norm
nie angewandt wurde und die verfassungsrechtliche Diskussion einer Sozialisierung allenfalls theo-
retischer Natur war. Sofern man sich bei der Auslegung allerdings gänzlich auf die Materialien des
Parlamentarischen Rates (genetische Auslegung) und die Vorgeschichte (historische Auslegung) be-
schränkt, wird nur auf die subjektive Sichtweise des historischen Gesetzgebers abgestellt, die grund-
sätzlich nur eines der Auslegungskriterien darstellt. 72 Es stellt sich die Frage, ob es die Besonderhei-
ten des Art. 15 GG rechtfertigen, die übrigen Auslegungsmethoden zu vernachlässigen und einen
Bedeutungswandel der Norm außer Betracht zu lassen.
Schon 1953 hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass die Vorschriften der Verfassung einen
Bedeutungswandel erfahren können. 73 Demnach kann der gesellschaftliche Wandel bei der Interpre-
tation der verfassungsrechtlichen Vorschriften durchaus berücksichtigt werden. 74
Auch wenn Art. 15 GG nie angewandt wurde, ist es daher fraglich, ihn allein aus der Sicht des Jahres
1949 zu betrachten. Wenn man dies dennoch will, ist darauf hinzuweisen, dass – wie soeben darge-
legt (siehe oben III.) – im Vorfeld und bei der Verfassungsgebung stets davon die Rede war, dass
die Sozialisierung ein Mittel gegen eine Machtkonzentration in den damaligen „Schlüsselindustrien“
darstelle. Dabei bezog sich der Verfassungsgeber vor allem auf die Industrien, in denen sich die
Macht zur Zeit des Nationalsozialismus gebündelt hatte. Bei einer strikten Orientierung am Willen
des historischen Gesetzgebers wären ohne Grundgesetzänderung mit neu formiertem Willen des
Verfassungsgebers nur diese Industriezweige als Sozialisierungsobjekte erfasst. Dies würde aller-
dings ignorieren, dass die Einführung des Art. 15 GG davon getrieben war, politisch-wirtschaftliche
„Machtblöcke“ in den Industriesektoren zu verhindern. Es wäre auch zu fragen, ob man dem Parla-
mentarischen Rat tatsächlich unterstellen kann, dass ihm ein solches Machtgefüge in anderen, viel-
leicht auch erst neu entstandenen Schlüsselindustrien egal gewesen wäre. Diese Überlegung zeigt
bereits die Grenzen auf, an die eine ausschließlich oder primär subjektive Auslegung stößt. Sie birgt
68 Vgl. Stern, in: ders. (Hrsg.), Staatsrecht, Bd. I, 2. Aufl. 1984, § 4, S. 124 f.; Stern, in: ders.
(Hrsg.), Bd. III/2, 1994, § 95, S. 1657 - 1659.
69 Starck, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XII, 3. Aufl. 2014, § 271
Rn. 17; ausführlich zu den Auslegungsmethoden Müller/Christensen, Juristische Methodik, 11. Aufl.
2013, S. 328–386; ausführlich zur Auslegung der Verfassung Lechner/Zuck, BVerfGG Kommentar,
8. Aufl. 2019, Einleitung Rn. 69–130 m. w. N. in der dortigen Fn. 235.
70 BVerfGE 105, 135 (157); 133, 168 (205 f.) Rn. 66; 144, 20 (213 f.) Rn. 555.
71 BVerfGE 124, 25 (39). Dem Wortlaut-Element kommt eine Eingrenzungsfunktion im Auslegungs-
vorgang zu; vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, S. 343.
72 Dies wäre vergleichbar mit der Strömung des Originalismus im US-Verfassungsrecht, die nur den
Zweck der Norm, den ihre Schöpfer mit ihr verfolgten, für maßgeblich hält (sog. „original intent“);
vgl. dazu Melin, Gesetzesauslegung in den USA und in Deutschland, 2005, S. 116 f.
73 In BVerfGE 2, 380 (401) heißt es: „Allerdings kann eine Verfassungsbestimmung einen Bedeu-
tungswandel erfahren, wenn in ihrem Bereich neue, nicht vorausgesehene Tatbestände auftauchen
oder bekannte Tatbestände durch ihre Einordnung in den Gesamtablauf einer Entwicklung in neuer
Beziehung oder Bedeutung erscheinen; […].“
74 Zur wichtigen Bedeutung einer solchen „dynamischen“ Auslegung für Verfassungen, die schwer
änderbar sind Gärditz, in: Herdegen u. a. (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, I. § 4
Rn. 33. Eine solche Auslegung ist für das Grundgesetz umstritten, vgl. z.B Hillgruber, § 15 Verfas-
sungsinterpretation in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorien, 2010, S. 515, der
auf den dauerhaft maßgeblichen Willen des historischen Verfassungsgebers hinweist.
10POLICY PAPER
1 | 2022
die Gefahr, dass sich das Recht immer weiter von seinem gesellschaftlich-kulturellen Kontext ent-
fernt. 75 Es sprechen die besseren Argumente dafür, auch hier eine umfassende, an die jetzigen Be-
dingungen angepasste Auslegung zu Grunde zu legen, in die die historisch-genetische Analyse (Er-
mittlung des Gesetzgeberwillens) einfließt, deren Ergebnis allerdings nicht determiniert (Objektivie-
rung des Willens). 76 Dies heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass dem historischen Willen des
Gesetzgebers im Rahmen der Auslegungsvorgangs kein besonderes Gewicht eingeräumt werden
kann. Das ist vielmehr stets fallabhängig zu beurteilen. 77 Dem befriedenden Charakter des Art. 15
GG, der vor dem Hintergrund des Machtmissbrauchs in der Industrie zu Kriegszeiten eingeführt
wurde, muss in Rahmen der Auslegung daher durchaus ein erhebliches Gewicht eingeräumt werden.
5. Vorbemerkung zu divergierenden Auslegungsansätzen zum Anwen-
dungsbereich von Art. 15 GG
Zur Weite des Anwendungsbereiches von Art. 15 GG gibt es verschiedene Ansichten. Unter Zugrun-
delegung einer teleologischen Auslegung wird der Kreis tauglicher Sozialisierungsobjekte des Art. 15
GG teilweise sehr weit und praktisch restriktionslos gefasst. 78 Auf der anderen Seite kann der Sozi-
alisierungskatalog unter Zugrundelegung einer historischen Auslegung sehr restriktiv betrachtet wer-
den. 79
Abseits dieser extremen Ansichten wird der Anwendungsbereich des Art. 15 GG mithilfe der unge-
schriebenen Tatbestandsvoraussetzung einer „Sozialisierungsreife“ dahingehend eingegrenzt, dass
der betreffende Gegenstand für eine Sozialisierung geeignet sein muss. Unter dem Topos der Sozia-
lisierungsreife wird überwiegend danach gefragt, ob dem oder den Unternehmen eine hinreichende
wirtschaftliche Bedeutung zukommt. 80 Der Kreis der sozialisierungsfähigen Gegenstände wird auf
diese Weise allerdings wohl lediglich um Kleinunternehmen reduziert. 81 Als Prüfung der Sozialisie-
rungseignung kann diese Analyse unter Zugrundelegung einer dynamischen Interpretation auch im
Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung verortet werden. 82
Davon unabhängig kann auf der Basis der historisch-genetischen Auslegung der Anwendungsbereich
der Norm dadurch eingegrenzt werden, dass sie teleologisch als ein Mittel zur Bekämpfung von
Machtkonzentration in der Wirtschaft interpretiert wird. Ein solches Verständnis könnte schon durch
eine entsprechend eingrenzende Interpretation des Sozialisierungsgegenstandes umgesetzt wer-
den. 83 Allerdings stößt sich eine derart restriktive Interpretation am Wortlaut, da das Produktions-
mittel unter Zugrundelegung einer dynamischen Auslegung zunächst jeden Wirtschaftszweig erfasst.
75 So Voßkuhle, JuS 2019, 417 (423), der eine zu weite Entfernung des Rechts von den kulturellen
Grundlagen bei einem Rückgriff auf den historischen Gesetzgeber als „Selbstaufgabe der Normativi-
tät der Verfassung“ erachtet.
76 So stellt auch das Bundesverfassungsgericht heraus, dass die Vorstellungen der gesetzgebenden
Instanzen nicht mit dem objektiven Gesetzesinhalt gleichgesetzt werden können und für die Erfas-
sung des objektiven Willens des Gesetzgebers alle anerkannten Auslegungsmethoden heranzuziehen
sind, BVerfGE 144, 20 (213 f.) Rn. 555.
77 Ebenso Lechner/Zuck, BVerfGG Kommentar, 8. Aufl. 2019, Einleitung Rn. 94.
78 Vgl. nur Jarass, in: ders./Pieroth (Hrsg.), GG Kommentar, 16. Aufl. 2020, Art. 15 Rn. 2 m. w. N.
79 Vgl. nur Depenheuer/Froese, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 1,
7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 36 m. w. N.
80 Axer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, Art. 15 Rn. 19 (Stand: 15.2.2022); Depen-
heuer/Froese, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 15
Rn. 40; Bryde, in: von Münch/Kunig (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 1, 7. Aufl. 2021, Art. 15 Rn. 22.
81 Vgl. Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 189; ein vergleichbarer Maßstab auch bei
Axer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, Art. 15 Rn. 19 (Stand: 15.2.2022) m. w. N.
82 Vgl. zur teilweisen Überschneidung der Sozialisierungsreife mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz auch Dietlein, in: Stern/Sachs/ders. (Hrsg.), Staatsrecht, Bd. IV, 2006, § 113, S. 2318.
83 So etwa zum Produktionsmittel Schliesky, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar
GG, Art. 15 Rn. 38 (Stand: August 2011), bei dem nur die heutigen „Schlüsselindustrien“ umfasst
sind; oder Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/ders./Henneke (Hrsg.), GG Kommentar, 15. Auflage
2021, Art 15 Rn. 5, der aus heutiger Sicht auch Finanzdienstleistungsunternehmen in den Anwen-
dungsbereich von Art. 15 GG aufnehmen würde, allerdings nur bei entsprechender „Systemrele-
vanz“.
11Sie können auch lesen