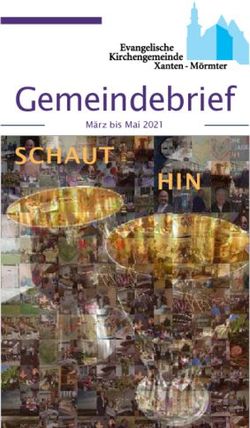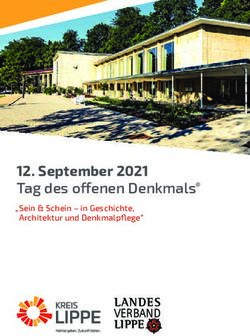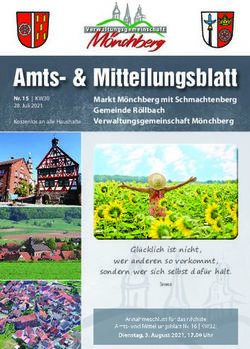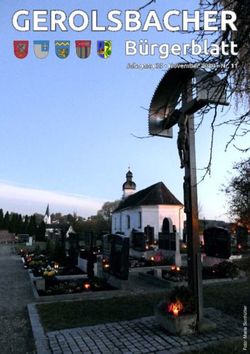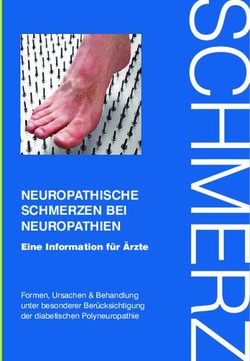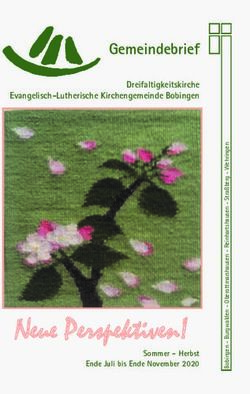Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ) - Uni Ulm
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Humboldt-Studienzentrum für Philosophie
und Geisteswissenschaften (HSZ)
eine Abteilung des Departments für Geisteswissenschaften/School
of Humanities
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester 2020-21
Philosophie und Geisteswissenschaften
Professionsbezogene Vertiefung: Ethik
Modul Personale Kompetenz (MPK)
Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)Impressum
Herausgeber: Humboldt-Studienzentrum
Universität Ulm
Oberer Eselsberg
89069 Ulm
Redaktion: Bettina Meyer-Quintus
Layout: GDV, Graphik-Design Verlagsservice,
Reutlingen
Gestaltung (Umschlag): kiz, Abteilung Medien
Druck (Umschlag): kiz, Abteilung Medien
Druck (Innenteil)/Bind.: kiz, Abteilung Medien
Erscheinungsweise: halbjährlich zum Semesterbeginn
3I Einführung und Allgemeines
1. Inhalt
I Einführung und Allgemeines
1. Inhalt 3
1.1 Semesterbeginn 5
1.2 Allgemeine Informationen 6
1.3 Hinweise zum Angebot des HSZ 7
1.3.1 Das Studium der Philosophie 8
1.3.2 Die Gastprofessur für Philosophie 9
1.4 Die verschiedenen Möglichkeiten des Studiums 10
1.4.1 Nebenfach / Anwendungsfach Philosophie 10
1.4.2 Ethik in den Bildungswissenschaften 11
1.4.3 Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ) 12
1.5 Kursgebühren für Gasthörer 14
II Lehrveranstaltungen
1. Kurzübersicht der Lehrveranstaltungen 15
2.1 Geschichte der Philosophie 19
2.2 Theoretische Philosophie 23
2.3 Praktische Philosophie 26
2.4 Interdisziplinäre Seminare 32
3. Kulturanthropologie 35
4. Politik und Zeitgeschehen 38
5. Alte Sprachen 39
6. Schule und Bildung 42
III Zusätzliche Veranstaltungen
1. Ringvorlesung, Philosophischer Salon Vorträge 44
2. Fachschaft Kunterbunt 46
IV Anhang
Lageplan 48
4I Einführung und Allgemeines
1. Inhalt
Das Humboldt-Studienzentrum bietet in folgenden Bereichen
Lehrveranstaltungen an:
• Philosophie: Geschichte der Philosophie,
Theoretische Philosophie, Praktische Philosophie
• Interdisziplinäre Themen
• Kulturanthropologie
• Politik und Zeitgeschehen
• Alte Sprachen
• Professionsbezogene Vertiefung: Ethik
• Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)
• Modul Personale Kompetenz (MPK)
Alle HSZ-Kurse können als ASQ angerechnet werden.
5I Einführung und Allgemeines
1.1 Semesterbeginn
1.1 Semesterbeginn
Semestereröffnung und Einführung:
Montag, 2. November, 13:00 Uhr
Via Moodle, Kursnr. 1000.001
Die Studienangebote des aktuellen Semesters werden kurz vorge-
stellt. Im Gespräch mit den Dozentinnen und Dozenten können
Fragen gestellt und Anregungen eingeholt werden.
Einschreibung:
Die Einschreibung sollte über Corona erfolgen.
Für Gasthörer ist eine Einschreibung direkt im Sekretariat des
Humboldt-Studienzentrums, Pavillon I, OG möglich, und zwar ab
dem 2. November 2020 zu den allgemeinen Öffnungszeiten.
Allgemeine Öffnungszeiten:
Sekretariat: Pavillon I, Raum 37, Oberer Eselsberg
Montag bis Donnerstag: 09.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr
6I Einführung und Allgemeines
1.2 Allgemeine Informationen
1.2. Allgemeine Informationen
Das Humboldt-Studienzentrum ist eine Abteilung des
Departments für Geisteswissenschaften /
School of Humanities
Vorstand des Departments:
Prof. Dr. Othmar Marti, Vorsitzender
Prof. Dr. Joachim Ankerhold, stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. Jacobo Torán, Mitglied für Angelegenheiten in Studium und Lehre
Sprecher:
Prof. Dr. Joachim Ankerhold, Institut für komplexe Quantensysteme
Vizepräsident für Forschung, Universität Ulm
Geschäftsführerin:
Prof. Dr. Dr. h. c. Renate Breuninger
renate.breuninger@uni-ulm.de
Geschäftsstelle:
Bettina Meyer-Quintus
Oberer Eselsberg, Pavillon I, OG Raum 37, Tel.: 50-23460/61, Fax: 0731 / 50-23470
manuela.fischer@uni-ulm.de, bettina.meyer-quintus@uni-ulm.de
Gastprofessor für Philosophie:
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff
Oberer Eselsberg, Pavillon I, OG, Tel.: 50-23433
thomas.kirchhoff@uni-ulm.de
EPG-/MPK-Koordinatorin:
Dr. Katja Springer
Oberer Eselsberg, Pavillon I, OG, Tel.: 50-23466
katja.springer@uni-ulm.de
ASQ-Koordinatoren:
Dr. Roman Yaremko, Dr. Katja Springer
roman.yaremko@uni-ulm.de, katja.springer@uni-ulm.de
Oberer Eselsberg, Pavillon I, OG , Tel.: 50-23464
http://www.humboldt-studienzentrum.de
7I Einführung und Allgemeines
1.3 Hinweise zum Angebot des HSZ
1.3 Hinweise zum Angebot des Humboldt-Studienzentrums
Vor dem Hintergrund einer naturwissenschaftlichen und technisch-
wissenschaftlichen Orientierung der Universität Ulm ist das Humboldt-
Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften aus der
Überlegung entstanden, dem Universitätsgedanken im Sinne einer mög-
lichst umfassenden Bildung gerecht zu werden.
Die Studierenden sollen in ihrer Universität ein Angebot vorfinden, das
ihnen erlaubt, ihre fachwissenschaftliche Ausbildung im Rahmen der
kulturellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit wahrzunehmen und be-
grifflich zu durchdringen. Dies hat Humboldt, dessen Name eine Ver-
pflichtung ist, unter akademischer Bildung verstanden. In diesem Sinne
fällt der Philosophie auch die Aufgabe zu, die Wissenschaften einer brei-
teren Öffentlichkeit zu erschließen.
In einer globalisierten Welt, deren komplexe und dynamische Strukturen
zunehmend alle Ebenen von Gesellschaft, Technik und Wissenschaft
durchdringen, ist es neben einem fundierten Fachwissen notwendig, deren
Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, um eigenes Denken und
Handeln adäquat ausrichten zu können. Führungsfunktionen in Wirtschaft
und Forschung bedürfen zunehmend u.a. auch jener Qualifikationen, die
dieser Komplexität in Form von sozialer Kompetenz und praktischer
Urteilskraft gerecht werden. Diese praktische Urteilskraft gilt es be-
sonders in ethischen Begründungs- und Anwendungsfragen auszubil-
den und zu schulen, wie z.B. in den Spannungsfeldern von Ethik und
Wirtschaft, Ethik und Umwelt/Ökologie und Ethik und Medizin.
So zeichnet sich die Beschäftigung mit Philosophie u.a. durch ein exemp-
larisches Lernen aus, das auch Schlüsselqualifikationen vermittelt.
Neben dem Erwerb von Grundtechniken, wie etwa der Logik und Herme-
neutik, gilt es für den Studierenden, sich anhand philosophischer Diskurse
ein methodisch-reflektiertes und kritisches Denken anzueignen, das die
Grundlage jeder wissenschaftlichen Praxis darstellt. Insbesondere die
Philosophie vermag es, ein historisch geschultes, begrifflich exaktes und
methodisch-argumentatives Reflektieren zu entwickeln. Dadurch soll die
Fähigkeit zur abwägenden Reflexion von Thesen oder Überzeugungen
und zum Erkennen von oftmals stillschweigend gemachten, unter Um-
ständen problematischen Voraussetzungen und Prämissen eingeübt und
weiter ausgebildet werden.
8I Einführung und Allgemeines
1.3.1 Das Studium der Philosophie
1.3.1 Philosophie in Ulm
Im Mittelpunkt des Lehrangebots des Humboldt-Studienzentrums stehen
daher die Grundzüge des philosophischen und geisteswissenschaftlichen
• Wissens,
• Denkens und
• Argumentierens
unter einer historischen und systematischen Perspektive.
Vermittelt werden vor dem Hintergrund der Ulmer Bedingungen philoso-
phische Kenntnisse hinsichtlich
• der philosophisch-theoretischen und -praktischen Grundlagen der
Wissenschaften (Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie);
• der Probleme ethischen und politisch-sozialen Handelns innerhalb
unseres Gemeinwesens;
• hermeneutischer und analytischer Kompetenzen bezüglich syste-
matischer und historischer Wissensbestände sowie deren sprachlich-
begrifflicher Vermittlung.
Jede Veranstaltung des HUMBOLDT-STUDIENZENTRUMS kann als
ASQ belegt werden.
• Um den Studierenden die Möglichkeit zur Teilnahme an unseren
Lehrangeboten neben ihrem Studium einzuräumen, finden die Kurse
auch in den Abendstunden oder als Kompaktseminare an den Wo-
chenenden bzw. in den Semesterferien statt.
• Das Lehrangebot besteht aus einem kontinuierlich angebotenen Mo-
dulsystem: Es wird jedes Semester eine Einführung in die Philoso-
phie, eine Veranstaltung zur Wissenschafts- und Erkenntnistheorie,
zur praktischen Philosophie/Ethik und zu klassisch philosophischen
Texten angeboten.
9I Einführung und Allgemeines
1.3.2 Die Gastprofessur
1.3.2 Die Gastprofessur für Philosophie
Gastprofessor für Philosophie im akademischen Jahr 2020/21 ist PD Dr. Thomas Kirch-
hoff. Studium der Landschaftsplanung und Philosophie an der Technischen Universität
Berlin, anschließend freiberufliche Mitarbeit in verschiedenen Büros für Landschaftsplanung
und ökologische Gutachten. 2000 bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Landschaftsökologie an der Technischen Universität München (TUM), 2006 Promotion über
„Systemauffassungen und biologische Theorien“. Seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der FEST in Heidelberg, Arbeitsbereich Theologie und Naturwissenschaft. 2016 Ab-
schluss des Habilitationsverfahrens an der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan
für Ernährung, Landnutzung und Umwelt (WZW) der Technischen Universität München.
Titel der Habilitationsschrift: „Das Konzept der ‚kulturellen Ökosystemdienstleistungen‘:
eine begriffliche und methodische Kritik“. Seit 2017 Privatdozent für „Theorie der Land-
schaft“ an der Technischen Universität München. Im Dezember 2018 aufgenommen als
persönliches Mitglied in das Heidelberg Center for the Environment (HCE).
Die Lehrthemen von Thomas Kirchhoff beschäftigen sich mit Fragen der Naturphilosophie,
der Wissenschaftstheorie sowie des Umwelt- und Naturschutzes, insbesondere Theo-
rie/Geschichte der Landschaft & Wildnis, Theorie/Geschichte des Umwelt- & Naturschutzes,
Theorie/Geschichte der Ökologie, „Biodiversität“, „Ökosystemdienstleistungen“, Natur-
/Landschaftsästhetik, Sakralisierungen von Natur, Naturethik, Theorien des Mensch-Natur-
Verhältnisses.
Seine aktuellen Forschungsprojekte befassen sich unter anderem mit Naturkonzepten, Hei-
mat und Landschaft, Windenergieanlagen und Landschaft, dem Konzept der kulturellen
Ökosystemdienstleistungen, dem Konzept der Ökosystemintegrität, Biodiversität als kultu-
rellem Konzept sowie Wildnis als symbolischer Gegenwelt.
Zahlreiche Publikationen. Wichtige Buchpublikationen: „Naturphilosophie. Ein Lehr- und
Studienbuch. 2. Auflage“ (UTB / Mohr Siebeck 2020); „Ökologie zwischen Wissenschaft
und Weltanschauung“, Schwerpunktausgabe der Zeitschrift Natur und Landschaft (Bundes-
amt für Naturschutz 2020); „Online Encyclopedia Philosophy of Nature / Online Lexikon
Naturphilosophie“ (Universitätsbibliothek Heidelberg, https://journals.ub.uni-
heidelberg.de/index.php/oepn, seit 2019); „‘Kulturelle Ökosystemdienstleistungen‘. Eine
begriffliche und methodische Kritik (Alber 2018); „Wünschenswerte Vielheit. Diversität als
Kategorie, Befund und Norm“ (Alber 2016); „Welche Natur brauchen wir? Analyse einer
anthropologischen Grundproblematik des 21. Jahrhunderts (Alber 2014); „Vieldeutige Natur.
Landschaft, Wildnis und Ökosystem als kulturgeschichtliche Phänomene“ (transcript 2009).
Daneben zahlreiche Aufsätze, rege Vortrags- und Gutachtertätigkeit sowie Editor- und
Review-Tätigkeiten und einige Medienbeiträge.
Weitergehende Informationen: https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/humboldt/ oder
https://www.fest-heidelberg.de/pd-dr-thomas-kirchhoff/.
10I Einführung und Allgemeines
1.4 Die verschiedenen Möglichkeiten des Studiums
1.4.1 Nebenfach / Anwendungsfach Philosophie
Philosophie kann in verschiedenen Studiengängen im Neben-
fach/Anwendungsfach belegt werden. Die tabellarische Übersicht
gibt den Leistungspunkteumfang innerhalb der einzelnen Fächer
an.
Exemplarische Tabelle:
Studiengang Bachelor Master
Chemie - 6 LP
Wirtschaftschemie - -
Mathematik 20-25 LP 18-22 LP
Biologie - 12 LP
Biochemie - 12 LP
Physik - 18 LP
Informatik 24 LP 12 LP
Psychologie 6 LP -
Elektrotechnik 3 LP -
Informationssystemtechnik 3 LP -
Daneben ist der Besuch der Philosophiekurse innerhalb der Additi-
ven Schlüsselqualifikationen im Umfang von 6 Leistungspunkten
(2 Veranstaltungen à 3 LP) im Bereich der Orientierungskompeten-
zen in jedem Studiengang (außer Elektrotechnik und Informtions-
systemtechnik) möglich.
11I Einführung und Allgemeines
1.4.2 Ethik in den Bildungswissenschaften
Die Ethik ist integraler Bestandteil der Bildungswissenschaften in
den Bachelor- und Master-Studiengängen für das Lehramt an
Gymnasien. Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium kön-
nen Seminare zur Ethik im Rahmen des Moduls "Professionsbezo-
gene Vertiefung der Bildunsgwissenschaften/ Ethik" besucht und
angerechnet werden.
Die Ethikseminare im Bachelorstudium befassen sich mit ethisch-
philosophischen Grundfragen (B.A.-BiWi-Ethik).
Die Ethikseminare im Masterstudium befassen sich mit fach- bzw.
berufsspezifischen Fragen (M.A.-BiWi-Ethik).
Die Leistungsnachweise werden benotet und gehen in die Gesamt-
note der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt mit 4 LP ein.
Als Leistungsnachweise oder Prüfungen gelten: Referat, Hausar-
beit, Klausur.
Bei Fragen bezüglich des Leistungsnachweises für EPG I und EPG
II für das Lehramtsstudium auf Examen, wenden Sie sich bitte di-
rekt an die Verantwortliche für Ethik: Dr. Katja Springer.
Besonders hervorzuheben im Rahmen des Lehramtsstudiums ist
das Modul Personale Kompetenz (MPK), dass durch einen großen
Praxisanteil überzeugen kann.
12I Einführung und Allgemeines
1.4.3 Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)
1.4.3 Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)
Schlüssel zum Erfolg
Die Auswirkungen des technologischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandels stellen die Arbeitswelt vor neue Herausforderungen:
Von Bewerbern wird deshalb heute nicht nur eine hohe Fachkompetenz
gefordert, sondern Schlüsselkompetenzen wie geistige und physische
Flexibilität und Mobilität, Kontextualisierungsfähigkeit und verantwortli-
ches Handeln, Kommunikation und Kooperation, Urteils- und Entschei-
dungsfähigkeit, Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Und wer mit
sich selbst und anderen umzugehen weiß, sich effizient Wissen anzueig-
nen und überzeugend zu präsentieren versteht, der wird dank dieser und
anderer „soft skills“ auch im Studium erfolgreicher ans Ziel kommen.
Was sind Schlüsselkompetenzen?
Die Bildungskommission NRW 1995 versteht darunter „erwerbbare all-
gemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Strategien, die bei der Lösung
von Problemen und beim Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst vielen
Inhaltsbereichen von Nutzen sind“.
Schlüsselqualifikationen werden an der Universität Ulm sowohl integrativ
vermittelt, d.h. innerhalb fachwissenschaftlicher Module (z. B. Präsentati-
on im Seminar oder Teamarbeit im Praktikum), als auch additiv, d.h.
durch spezielle fächerübergreifende Übungen und Seminare. Diese Lehr-
veranstaltungen zu Additiven Schlüsselqualifikationen (ASQ) werden in
folgenden Bereichen angeboten:
Basiskompetenzen umfassen Sozialkompetenzen (Teamarbeit, Konflikt-
verhalten, Führung, Moderation etc.), Methodenkompetenzen (Lernen,
Medien, Information, Präsentation etc.) und Selbstkompetenz (Selbstma-
nagement, Leistungsbereitschaft, Kreativität etc.)
Praxiskompetenzen ergeben sich aus der gezielten Vorbereitung auf
berufliche Tätigkeiten, z.B. juristisches und wirtschaftliches Grundwissen,
EDV-Kompetenzen, Projektmanagement u.a.
Orientierungskompetenz setzt die Integration von interdisziplinären
Wissensbeständen voraus, vor allem auch aus den Kultur- und Sozialwis-
senschaften, um ein verantwortungsvolles, kritisches und kreatives Han-
deln und Denken in Zusammenhängen zu fördern.
13I Einführung und Allgemeines
1.4.3 Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)
1.4.3 Additive Schlüsselqualifikationen (ASQ)
Fremdsprachen und interkulturelle Kompetenz ermöglichen es, frem-
de Kulturen zu verstehen und erfolgreich mit anderen zu interagieren.
Dieser Bereich beinhaltet sowohl Kenntnisse (Kultur und Sprache) als
auch Sozial- und Handlungskompetenzen.
ASQ-Veranstaltungen
Lehrveranstaltungen zu Additiven Schlüsselqualifikationen werden an der
Universität Ulm fächerübergreifend vom Humboldt-Studienzentrum für
Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ), vom Zentrum für Sprachen
und Philologie (ZSP) sowie von einzelnen Studienkommissionen (StuKo)
angeboten.
Details, Termine und Aktuelles unter www.uni-ulm.de/asq/. Bitte beach-
ten Sie auch das Faltblatt von ASQ.
Dort finden Sie weitere aktuelle Informationen, u.a. zum Anmeldeverfah-
ren, Terminen, Dozentinnen und Dozenten.
ASQ-Veranstaltungen des HSZ werden sowohl semesterbegleitend als
auch als Block im Rahmen von 2 SWS angeboten und entsprechen einem
Arbeitsaufwand (workload) von 3 Leistungspunkten nach ECTS.
Alle HSZ-Seminare und HSZ-Vorlesungen können auch als ASQ-
Kurse angerechnet werden.
Kontakt:
Dr. Roman Yaremko, Dr. Katja Springer
Koordinatoren für Additive Schlüsselqualifikationen
Universität Ulm, Pavillon I, OG, Oberer Eselsberg
Telefon: +49 (0)731/50-23464
Email: roman.yaremko@uni-ulm.de, katja.springer@uni-ulm.de
14I Einführung und Allgemeines
1.5 Kursgebühren für Gasthörer
1.5 Kursgebühren für Gasthörer
Die Gebühren für Gasthörer betragen
für Hörer, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Universität sind:
bis zu vier SWS 75 € (entspricht 2 Veranstaltungen)
bis zu acht SWS 150 € (entspricht 4 Veranstaltungen)
mehr als acht SWS 200 € (entspricht beliebig vielen Veranstaltungen)
für Hörer, die Mitglieder oder Angehörige der Universität sind
bis zu vier SWS 50 € (entspricht 2 Veranstaltungen)
bis zu acht SWS 120 € (entspricht 4 Veranstaltungen)
mehr als acht SWS 150 € (entspricht beliebig vielen Veranstaltungen).
Die Gebühr muss bis zum Beginn der zweiten Veranstaltungssitzung
entrichtet werden. Bei der Überweisung auf unten genanntes Konto bitte
die Nummer des besuchten Kurses vermerken (Bsp: HSZ 2100.004).
Die Teilnahmegebühr für Veranstaltungen gilt nur für eine Person und ist
nicht übertrag- oder teilbar.
Vgl. die Allgemeine Gebührensatzung der Universität Ulm, veröffentlicht
in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm Nr. 21 vom
07.08.2014, Seite 232-233
Kontodaten:
BIC: SOLADES1ULM
IBAN: DE68 6305 0000 0000 0050 50
Verwendungszweck: die jeweilige HSZ-Veranstaltungsnummer
(beispielsweise HSZ3300.333)
15II Lehrveranstaltungen
1. Übersicht der Lehrveranstaltungen
GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE
Antike Glückstheorien online
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm
Prof. Dr. Peter Oesterreich, Universität Ulm
Kompaktseminar, 19.-21. November 2020
Do 14:00-19:00, Fr 09:30-19:00, Sa 09:30-14:00 Uhr
Geschichte der Ethik: Platon, Aristoteles asynchron
Hume, Kant, Mill online / asynchron
PD Dr. Günter Fröhlich, Universität Regensburg
Nähere Infos gibt es zum Semesterbeginn
Philosophie der Freundschaft online
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm
Seminar, Di 12:15-13:45 Uhr
J. J. Rousseau: Verbessert der Fortschritt der Wissenschaften auch zugleich
die Moral des Menschen? (Professionsbezogene Vertiefung: Ethik / EPG I)
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm online
Seminar, Mo 12:15-13:45 Uhr
THEORETISCHE PHILOSOPHIE
Einführung in die Wissenschaftstheorie online
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Seminar, Mi 12:15-13:45 Uhr
Theorien von Wildnis online
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Seminar, Di 16:00-17:30 Uhr
Thinking about Science online
Dr. Hans-Peter Eckle, Universität Ulm
Seminar, Mi 17:00-20:00 Uhr (14-tgl.)
16II Lehrveranstaltungen
1. Übersicht der Lehrveranstaltungen
PRAKTISCHE PHILOSOPHIE
Landschaft und Menschen online
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Vorlesung, Do 12:15-13:45
Zivilcourage. Über den Mut der Freiheit online
Dr. Johannes Schick, Blaubeuren
Seminar, Mo 17:00-18:30 Uhr
Wozu Wissen? Braucht es Bildung im Zeitalter von Google, Wikipedia
und Co? (Professionsbezogene Vertiefung: Ethik / EPG I) online
Dr. Katja Springer, Universität Ulm
Seminar, Di 14:00-15:30 Uhr
Tierethik online
Dr. Gisela Lorenz-Baier, Ulm
Seminar, Do 17:00-18:30 Uhr
Freude und Lust der Philosophie asynchron
Dr. Dr. Placidus Heider, Universität Regensburg
Nähere Informationen werden bei Semesterbeginn bekannt gegeben
Auseinandersetzung mit ethischen
Fragestellungen an Filmbeispielen online
Michael Zips, Kath. Hochschulpfarrer Ulm
Seminar, Mi 16:00-17:30 Uhr
INTERDISZIPLINÄRE SEMINARE
Umweltethik (Professionsbezogene Vertiefung: Ethik / EPG II) online
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Seminar, Mi 16:15-17:45 Uhr
Wirtschaftsethik online
PD Dr. Jörg Wernecke, TU München
20.11. 14:30-17:30 Uhr; 27.11. 14:30-18:00 Uhr
04.12. 14:30-17:30 Uhr; 11.12. 14:30-18:30 Uhr
17II Lehrveranstaltungen
1. Übersicht der Lehrveranstaltungen
Technikphilosophie online
PD Dr. David Espinet, Universität Freiburg
Kompaktseminar, 05.11.20, 12.11.20, 26.11.20,
14.01.21, 21.01.21, 28.01.21 und 11.02.21,
jeweils 14-17 Uhr
KULTURANTHROPOLOGIE
Verrat – Betrug – Intrige: Die menschliche Bosheit online
und ihre Darstellung in der Literatur
Roman Yaremko, Universität Ulm
Seminar, Mo 14:00-15:30 Uhr
„Das geht ja gar nicht“. Tabu und Tabubruch online
Stephan Schwarz, Evang. Hochschulpfarrer Ulm
Seminar, Mi 16:15-17:45 Uhr
Hieronymus Bosch (1450-1516) und Pieter Bruegel d.Ä. (1506-1569) –
Ihre Sonderstellung unter den Zeitgenossen
Prof. Dr. Ingrid Kessler-Wetzig, Ulm
Seminar, Di 17:00-20:00 Uhr (14-tgl.)
Beginn: 17.11.2020
Villa Eberhardt, Heidenheimer Str. 80, UG
POLITIK UND ZEITGESCHEHEN
Zur vorislamischen Zivilisationsgeschichte
des alten Iran
Prof. Dr. Ingrid Kessler-Wetzig, Ulm
Seminar, Di 17:00-20:00 Uhr (14-tgl.)
Beginn: 10.11.2020
Villa Eberhardt, Heidenheimer Str. 80, 1. OG
18II Lehrveranstaltungen
1. Übersicht der Lehrveranstaltungen
ALTE SPRACHEN
Sanskrit für Anfänger und Fortgeschrittene online
Dr. Nikolaus Groß, Senden
Übung, Di 18:00-19:30 Uhr
Griechische Lektüre: Plutarch, Cicero online
Dr. Nikolaus Groß, Senden
Übung, Mi 18:00-19:30 Uhr
Lateinische Lektüre: Cicero, Briefe online
Dr. Nikolaus Groß, Senden
Übung, Di 16:30-18:00 Uhr
N24/155
SCHULE UND BILDUNG
Einübung in den Lehrerberuf
Modul „Personale Kompetenz“ (MPK I) online
Dr. Katja Springer, Benedikt Büchler, Johannes Glembeck, David Oesch,
Girard Rhoden
Kompaktseminar, 27.11.-29.11.2020, Fr. 14:00-18:00 Uhr, Sa. 09:00-17:00 Uhr,
So. 09:00-17:00 Uhr
Schule und Bildung. Persönlichkeit und Ethos des Lehrers.
Modul „Personale Kompetenz“ (MPK II) online
Dr. Katja Springer, Benedikt Büchler, Johannes Glembeck, David Oesch,
Girard Rhoden
Kompaktseminar, 29.01.-31.01.2021, Fr. 14:00-18:00 Uhr, Sa. 09:00-17:00 Uhr,
So. 09:00-17:00 Uhr
19II Lehrveranstaltungen
2.1 Geschichte der Philosophie
2.1 Geschichte der Philosophie
Antike Glückstheorien online
Kompaktseminar, HSZ 2100.001
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm
Prof. Dr. Peter Oesterreich, Augustana-Hochschule Neuendettelsau
Was macht eigentlich das menschliche Glück aus? Besteht es in einem
irrationalen, rein individuellen Gefühl oder lassen sich doch einige philo-
sophische Aussagen über das scheinbar so unberechenbare Glück treffen?
Lassen sich vielleicht sogar unterschiedliche Wege zum Glücklichsein
aufzeigen?
Unser Seminar zu den Antiken Glückstheorien behandelt diejenigen Schu-
len der hellenistischen Philosophie, welche sich bereits unter dem Vorzei-
chen beginnender Subjektivität und Verinnerlichung am intensivsten mit
der Frage nach dem menschlichen Glück auseinandergesetzt haben. Dazu
gehören u.a. der Kynismus, die Stoa, der Epikureismus und die Skepsis.
Dabei wollen wir auch der Frage nachgehen, ob diese antiken Glücklehren
auch heute noch alternative Wege zum Glückstreben moderner Subjektivi-
tät anbieten können.
Leistungsnachweise durch Referate. Im Sekretariat (Pavillon 1, Albert-
Einstein-Allee 5) liegen ab Semesterbeginn Referatsthemen aus.
Textgrundlage: Malte Hossenfelder, Antike Glückslehren. Quellen zur
hellenistischen Ethik, Stuttgart 2013 (= Kröner Taschenausgabe Bd. 424)
Termin: 19.-21. November 2020
Do 14:00-19:00 Uhr, 09:30-19:00 Uhr, Sa 09.30-14:00 Uhr
20II Lehrveranstaltungen
2.1 Geschichte der Philosophie
2.1 Geschichte der Philosophie
Geschichte der Ethik: Platon, Aristoteles, Hume,
Kant, Mill asynchron
Seminar, HSZ 2100.002
PD Dr. Günter Fröhlich, Universität Regensburg
Die Vorlesung führt in einige historische Strömungen der ethischen Be-
gründungen und Positionen ein. Die wichtigsten stammen von Aristoteles,
Kant und Mill, ergänzt werden diese mit Platon und Hume.
Während Platon die Trennung von praktischer Philosophie, also Ethik,
und theoretischer Philosophie, also Streben nach Wissen und Erkenntnis,
noch gar nicht vollzog, führt Aristoteles diese explizit ein. Seine Ethik der
„Bestformen“ versucht die Bedingungen auszuloten, unter denen wir ein
gutes Leben führen können. Hume geht in seinen, im Wesentlichen auf
empirischen Grundlagen ruhenden Überlegungen davon aus, dass es etwas
in uns geben muss, dass uns zu nützlichen Handlungen motiviert. Wäh-
rend Kant die Frage nach den Begründungen der Ethik und des guten
Handelns noch einmal ganz neu am Leitfaden von Verpflichtungsgründen
aufrollt, kennt Mill in erster Linie einen Zweck des verbindlichen Han-
delns, das er am Wohl der Allgemeinheit bemisst.
Die Vorlesung wird umständebedingt online in Manuskriptform stattfin-
den. Jeden Freitag wird ein neuer Text ins Netz gestellt. Dazu wird es
noch eine Anleitung geben. Fragen zu den Texten und den behandelten
Autoren können jederzeit über Email: guenter.froehlich@uni-ulm.de
gestellt werden. Für einen Leistungsnachweis werden im Verlauf des
Semesters kleine Fragen zur Thematik der Vorlesungen gestellt, die
schriftlich zu beantworten sind.
Termin: Jeden Freitag wird ein neuer Text ins Netz gestellt. Dazu wird
es zu Semesterbeginn noch eine Anleitung geben.
21II Lehrveranstaltungen
2.1 Geschichte der Philosophie
2.1 Geschichte der Philosophie
Philosophie der Freundschaft online
Seminar, HSZ 2100.003
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm
In allen Ethiken als der Lehre vom gelingenden Leben kommt der Freund-
schaft eine besondere Bedeutung zu. Für Aristoteles ist im 8. und 9. Buch
der Nikomachischen Ethik die Freundschaft noch wichtiger als die Ge-
rechtigkeit, sie ist der wichtigste Bestandteil einer gut funktionierenden
Polis. Sie lässt eine Gesellschaft sittlich gut werden. Das Gut, das der
Freund dem Freunde entgegenbringt, wird hier nicht durch eigennützige
Zwecke definiert, sondern es geht um die "Wesensart" des Andern im
Ganzen. Während in der Antike Freundschaft höchste Tugend war und
zwischen Liebe und Freundschaft deutlich unterschieden wurde, wird sie
im Christentum zum Inbegriff der Liebe Gottes. In der Romantik wird
Freundschaft eigentümlich subjektiviert: Neben und über der Liebe ste-
hend, entgrenzt sie die bürgerliche Welt und - in dem sie das im Men-
schen angelegte Potential entfaltet - vervollständigt und vervollkommnet
sie den Menschen.
Und heute: Es scheint und bleibt zumindest zu hoffen, dass Freundschaft
eine neue Kultur der Geselligkeit begründen wird. Derridas „Politik der
Freundschaft“ nimmt Montaignes berühmtem Essay "Über die Freund-
schaft" auf und eröffnet mit dessen enigmatischen Satz "O Freunde, es
gibt keinen Freund“ einen neuen Begriff des Politischen. Auch für Han-
nah Arendt ist Freundschaft als Beziehungsgewebe immer zutiefst poli-
tisch.
Mehr denn je gilt es Räume für eine offene, vertrauensvolle, gerade nicht
abgeschottete und ausgegrenzte Kommunikation zu schaffen, so dass
Demokratie gelebt werden kann. Freundschaft als politische Kategorie
und als Lebensform sollte gerade in Zeiten von Social Media und Corona
eine verstärkte Bedeutung zukommen.
Termin: Dienstag, 12:15-13:45 Uhr
22II Lehrveranstaltungen
2.1 Geschichte der Philosophie
2.1 Geschichte der Philosophie
J. J. Rousseau: Verbessert der Fortschritt der
Wissenschaften auch zugleich die Moral des
Menschen? (Professionsbezogene Vertiefung:
Ethik / EPG I) online
Seminar, HSZ 2100.004
Prof. Dr. Renate Breuninger, Universität Ulm
J.J. Rousseau (1712-1776), Philosoph und Zivilisationskritiker, hat inner-
halb der europäischen Aufklärung als erster die Frage nach der gesell-
schaftlichen und kulturellen Bedeutung der Wissenschaften aufgeworfen.
Die Preisfrage der Akademie der Wissenshaften in Lyon im Jahre 1750,
die lautet: „Hat das Wiederaufblühen der Wissenschaften und Künste zur
Läuterung der Sitten beigetragen?“, verneint er und spricht sich damit
erstmalig gegen den Fortschrittsoptimismus aus. Wissenschaft und Bil-
dung hielten nicht Schritt mit dem sittlichen Fortschritt, ja, Moral und
Sitten verfallen in dem Maße, wie die Bedeutung der Wissenschaft zu-
nehme. Rousseaus „Discours sur les Sciences et les Arts“ bringt ihm den
1. Preis ein und macht ihn fortan berühmt.
Der fortschrittliche und emanzipatorische „Geist“ der Wissenschaften und
Künste habe, so Rousseau, die traditionellen Bindungen des Menschen
und damit die bislang gültigen Fundamente der Orientierung aufgelöst,
ohne neue einsetzen zu können. Aus dem Geist des Fortschritts sei keine
sichere Fundierung der Lebenspraxis zu erwarten: er erzeuge Orientie-
rungsprobleme, ohne sie lösen zu können.
Der hier vor- und eingeschlagene Weg nach innen, zu den Gesetzen des
Herzens, wurde von Kant, dem begeisterten Rousseau-Leser, zu Ende
gegangen. Das Problem, das Rousseau als erster angesprochen hat, hat bis
heute nichts von seiner Aktualität verloren.
Literatur: Jean-Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik, Hamburg
1995
Termin: Montag, 12:15-13:45 Uhr
23II Lehrveranstaltungen
2.2 Theoretische Philosophie
2.2 Theoretische Philosophie
Einführung in die Wissenschaftstheorie online
Seminar, HSZ 3100.001
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Wissenschaftliche Erkenntnisse bilden in vielen Bereichen eine wesentli-
che Grundlage menschlichen Handelns. Was aber ist Wissenschaft und
wie funktioniert sie? Wie kommen wissenschaftliche Erkenntnisse zu-
stande? Können sie Anspruch auf absolute Geltung oder Wahrheit bean-
spruchen? Wieso gibt es in allen wissenschaftlichen Disziplinen langan-
haltende Kontroversen zwischen konkurrierenden Theorien, die sich of-
fenbar nicht empirisch auflösen lassen? Was ist der Unterschied zwischen
Erklären und Verstehen? Wie unterscheiden sich holistische und individu-
alistische Ansätze? Das Seminar bietet eine Einführung in solche und
weitere wissenschaftstheoretische Fragen.
Die Teilnahme am Seminar erfordert keine philosophischen Vorkenntnis-
se. Texte werden zu Semesterbeginn online zugänglich gemacht. Eine
umsichtige Einführung in das Thema bietet: Poser, Hans 2012: Wissen-
schaftstheorie. Eine philosophische Einführung. 2., erweiterte Auflage.
Stuttgart, Reclam.
Termin: Mittwoch, 12:15-13:45 Uhr
24II Lehrveranstaltungen
2.2 Theoretische Philosophie
2.2 Theoretische Philosophie
Theorien von Wildnis online
Seminar, HSZ 3100.002
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Seit einigen Jahren ist in unserer Gesellschaft ein stark zunehmendes
Interesse an Wildnis zu beobachten. Man kann geradezu von einer weit-
verbreiteten Sehnsucht nach Wildnis sprechen. Was verbirgt sich hinter
dieser Sehnsucht? Wie ist sie zu erklären? Was ist überhaupt Wildnis?
Und gibt es im Anthropozän noch echte Wildnis? Um diese Fragen disku-
tieren zu können, analysieren wir den Begriff der „Natürlichkeit“ und
machen uns vor allem mit der „Kulturgeschichte von Wildnis“ vertraut –
also mit unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen und Bewertungen von
Wildnis, die in unserer Kultur im Laufe der letzten Jahrhunderte entstan-
den sind. Dabei untersuchen wir nicht nur die Umwertung von Gebirgen
von einer schrecklichen Wildnis zu Orten göttlicher Erhabenheit und
schließlich Orten säkularer Faszination, sondern auch den Mythos, Ame-
rika sei vor der europäischen Besiedlung eine unkultivierte Wildnis gewe-
sen.
Die Teilnahme am Seminar erfordert keine philosophischen Vorkenntnis-
se. Texte werden zu Semesterbeginn online zugänglich gemacht. Eine
komprimierte Einführung in das Thema bietet: Kirchhoff,
Thomas/Vicenzotti, Vera 2020: Von der Sehnsucht nach Wildnis. In:
Kirchhoff/Karafyllis et al. (Hg.): Naturphilosophie. Ein Lehr- und Stu-
dienbuch. 2., aktualisierte und durchgesehene Auflage. Tübingen,
UTB/Mohr Siebeck: 313–322.
Termin: Dienstag, 16:00-:17:30 Uhr
25II Lehrveranstaltungen
2.2 Theoretische Philosophie
2.2 Theoretische Philosophie
20th Century Thinking about Science online
Seminar, HSZ 3100.003
Dr. Hans-Peter Eckle, Universität Ulm
Despite the long tradition of scientists’ (although the term ‘scientist’ has only been coined by
William Whewell in 1833) and philosophers’ thinking about knowledge, scientific
knowledge, and, more generally, science it was arguably only in the 20th century that the
thinking about science became a distinct branch of philosophy. Moreover, the 20th century
witnessed other important meta approaches to science, e.g. from the perspective of sociology
and ethics. In the 20th century, the thinking about science brought into sharp focus again the
empiricist and rationalist positions and also the importance of the historical dimension of
science. The course will investigate the various approaches to the thinking about science
advanced in the 20th century: logical positivism/empiricism with its focus on inductivism,
i.e. the empirical justification of scientific theories; critical rationalism, with its focus on the
invention of hypotheses, fallibilism and the falsifiability criterion for scientific theories and
the demarcation of science from non-science; and the historically inspired paradigm theory
which focuses on the process and progress of science and how scientists’ actions may be
interpreted. The attempts to criticize the various positions and to extract and amalgamate
these into a, if possible, coherent picture of science will lead us up to the most recent discus-
sions of the 20th century.
Format: We start with introductory lectures to give an overview of the most important posi-
tions in the philosophy of science of the 20th century including the social and ethical dimen-
sion. These overview lectures intend to open up vistas into important debates. Some of these
can then be taken up and discussed in more detail and worked out in student presentations
and/or papers.
Selected literature:
Kent W Staley: An Introduction to the Philosophy of Science, Cambridge UP, 2014; Peter
Godfrey-Smith: Theory and Reality - An Introduction to the Philosophy of Science, Univer-
sity of Chicago Press, 2003; Stephen Webster: Thinking about Biology, Cambridge UP,
2003; Donald Gillies: Philosophy of Science in the Twentieth Century - Four Central
Themes, Blackwell, Oxford, 1993 John Losee: A Historical Introduction to the Philosophy of
Science, Oxford UP, 2001
Termin: Mittwoch, 17:00-20:00 Uhr (14-tgl.)
Beginn: 11.11.2020
Raum: online
26II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.3 Praktische Philosophie
Landschaft und Menschen online
Vorlesung, HSZ 4100.001
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Landschaft ist uns alltagsweltlich vertraut und zugleich ein Thema ganz unter-
schiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen wie Ästhetik, Geografie, Kunstge-
schichte, Kulturwissenschaften, Medizin, Naturethik, Ökologie, Ökonomik, Psy-
chologie und Soziologie. In der Vorlesung werden wir anhand des Gegenstandes
„Landschaft“ ausgewählte Themen der praktischen Philosophie behandeln, in
denen unser Nachdenken über Fragen systematisiert wird, die einen unmittelbaren
Handlungs- und Lebensbezug aufweisen. Wir werden uns unter anderem mit
Folgendem beschäftigen: Landschaft ist nicht einfach da, sondern immer ein Pro-
dukt menschlicher Wahrnehmung; Landschaft wird je nach gesellschaftlicher
Praxisform als ein kategorial verschiedener Gegenstand konstituiert, zum Beispiel
ästhetisch-symbolisch als Bild oder aber naturwissenschaftlich als Kausalsystem;
Landschaft wird aber auch innerhalb gleichartiger Konstitutionsweisen sehr ver-
schiedenartig begriffen, wobei konkurrierende Ideen von Vergesellschaftung eine
Rolle spielen, die jeweils unterschiedliche Ideen von Freiheit und Vernunft, Ord-
nung und Individualität sowie des Verhältnisses von Natur und Kultur beinhalten.
Die Teilnahme an der Vorlesung erfordert keine philosophischen Vorkenntnisse.
Eine kurze Einführung in die Thematik bieten: Kirchhoff, Thomas 2020: Land-
schaft. In: Kirchhoff/Karafyllis/Evers et al. (Hg.): Naturphilosophie. Ein Lehr- und
Studienbuch. 2., aktualisierte und durchgesehene Auflage. Tübingen, UTB/Mohr
Siebeck: 152–158 sowie Kirchhoff, Thomas 2019: Politische Weltanschauungen
und Landschaft. In: Kühne/Weber/Berr/Jenal (Hg.): Handbuch Landschaft. Wies-
baden, Springer VS: 383–396. Eine umfassende Darstellung enthält Trepl, Ludwig
2012: Die Idee der Landschaft. Eine Kulturgeschichte von der Aufklärung bis zur
Ökologiebewegung. Bielefeld, transcript.
Termin: Donnerstag 12.15-:13:45 Uhr
27II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.2 Theoretische Philosophie
Zivilcourage. Über den Mut der Freiheit online
Seminar, HSZ 4100.002
Dr. Johannes Schick, Blaubeuren
Vielfach wird der Ruf nach Zivilcourage laut. Gemeint ist der öffentliche Mut, „aus eigenem
Entschluss, auf eigenes Risiko und von niemandem abgefordert zu handeln“ (F. Schorlem-
mer). Menschen mit Zivilcourage bedienen sich der Kräfte ihres eigenen Verstands und
Herzens. Denn sie finden sich nicht ab mit Unrecht und Gleichgültigkeit, sondern ergreifen
Partei für die Interessen der Schwachen und für humane Werte. Sie glauben an die Bedeut-
samkeit des Lebens.
Zivilcourage begegnet bei großen Vorbildern wie den Ulmern Sophie und Hans Scholl, die
mit Leib und Leben für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde einstanden, aber sie ist
auch ablesbar am aufrechten Gang der Alltagshelden, die Gesicht zeigen. Sie meint den Mut
der Freiheit: Den Mut, der aus der Freiheit kommt und in die Freiheit führt.
Aber wie werden Menschen zivilcouragiert? Aus welchen Quellen schöpfen sie? Was för-
dert, was hindert den Mut, sich einzumischen? Was prägt die mutige Haltung? Und welchen
Unterschied macht sie in unserer Welt? Wie lässt sie sich philosophisch verstehen?
Im Seminar gehen wir diesen Fragen nach. Wir befassen uns mit dem Bedeutungsfeld des
Muts und analysieren soziale, situative und persönliche Faktoren sowie Handlungsarten der
Zivilcourage. Wir wollen dabei das Freiheits- und Humanitätspotential entdecken, das im
Handeln mutiger Menschen erkennbar wird, und bedenken, welche gesellschaftliche Rele-
vanz darin sichtbar wird.
In interdisziplinären Diskussionen über zentrale Texte, Personen, Konzepte und Aktionen
aus Geschichte und Gegenwart versuchen wir, eine kleine Philosophie der Zivilcourage zu
erarbeiten.
Literatur zur Vorbereitung:
Gerd Meyer (2014): Mut und Zivilcourage. Grundlagen und gesellschaftliche Praxis. Opla-
den, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
Termin: Montag, 17:00-18:30 Uhr
28II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.3 Praktische Philosophie
Wozu Wissen? Braucht es Bildung im Zeitalter
von Google, Wikipedia und Co? online
Seminar, HSZ 4100.003
Dr. Katja Springer, Universität Ulm
„Angesichts der Unendlichkeit eines jederzeit zugänglichen potentiellen Wissens, sind wir
alle faktisch Unwissende.“ Mit diesen Worten beschreibt der österreichische Philosoph
Konrad Paul Liessman den gegenwärtigen Zustand der sogenannten Wissensgesellschaft.
Mithilfe der Technisierung, Digitalisierung und Vernetzung ist der Zugriff auf Informationen
für alle Gesellschaftsschichten auf der gesamten Welt leichter denn je.
Aber Wissen und Bildung sind etwas anderes als Informationen. Wissen impliziert eine
gewisse geistige Durchdringung und Aufbereitung von Informationen. Die Idee der Bildung
zielt über den Wissenserwerb hinaus auf eine Selbstformung des Menschen als Persönlich-
keit, auf Charakterbildung, die Erlangung von Mündigkeit durch angemessenes Verstehen
und die Fähigkeit zu einer bestimmten Distanzfähigkeit als Moment der Freiheit gegenüber
einem möglichen Diktat des aktuellen Zeitgeistes.
In diesem Seminar wollen wir anhand von klassischen und modernen Texten einen Einblick
in die traditionelle Idee von Bildung, der Kritik an eben dieser und deren Verfallsformen in
den modernen Theorien der Halbbildung und Unbildung erlangen.
Literatur:
- Was ist Bildung? Eine Textanthologie. Hrsg. von Heiner Hastedt. Ditzingen: Reclam 2012.
- Einführung in die Theorie der Bildung. Hrsg. von Andreas Dörpinghaus, Andreas Poe-
nitsch, Lothar Wigger. 5. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013.
- Bildungsphilosophie. Disziplin-Gegenstandsbereich-Politische Bedeutung. Hrsg. von
Michael Spieker und Krassimir Stojanov. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2017.
(Tutzinger Studien zur Politik, Band9) auch online einsehbar
- Bildungsphilosophie. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Hrsg. von Rudolf Rehn und
Christina Schües. Freiburg, München: Karl Alber 2008. (Pädagogik und Philosophie, Band
1)
Termin: Dienstag, 14:00-15:30 Uhr
29II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.3 Praktische Philosophie
Tierethik online
Seminar, HSZ 4100.004
Dr. Gisela Lorenz-Baier, Ulm
Der Umgang des Menschen mit der Natur ist heute zu einem existenziel-
len Thema geworden. Die Frage, welche moralische Haltung wir Tieren
gegenüber einnehmen müssen, ist älter, aber genauso ungelöst. Das
grundsätzliche Problem dabei ist, wie Menschen einen objektiven Stand-
punkt zur Beurteilung tiergerechten Handelns einnehmen können. Dazu
hat Peter Singer in seinem Grundlagenwerk "praktische Ethik" aus dem
Jahr 1980 auf die "Leidensfähigkeit" als Kriterium für "moralische Per-
sönlichkeit" verwiesen. Das aber hat auf den Umgang mit schwerstbehin-
derten Menschen, wenn es konsequent zu Ende gedacht wird, problemati-
sche Konsequenzen.
Das Seminar wird das Buch von Peter Singer und jüngere Texte zur Tie-
rethik diskutieren.
Termin: Donnerstag, 17:00-18:30 Uhr
30II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.3 Praktische Philosophie
Freude und Lust der Philosophie online
Seminar, HSZ 4100.005
Dr. Dr. Placidus Heider, Universität Regensburg
Lust hindert am klaren Denken, wie die körperliche Bedingtheit überhaupt, und
Freude, gar Spaß, an etwas Gutem sind verdächtig, weil eigennützig und selbstbe-
zogen.
Und doch ist die „Tochter aus Elysium, der schöne Götterfunken“, die Freude, die
geistestrunkene Priesterin des Heiligtums von Ideen und Erkenntnis. Vom göttli-
chen Rausch und der lustvollen Leidenschaft des Erkennens kündet Platons
„Eros“, auch wenn er einige Dialoge weiter deutlich Respekt vor seinem Mut
bekommt und sich das Adjektiv „platonisch“ verdient…
Mut verlangt es nämlich, zwei so unterschiedliche Rösser vor den eigenen Karren,
den der Ethik, der Politik, den des eigenen Lebens, zu spannen: Rationalität und
ihr Anderes, Körperlichkeit und formale Strukturen, Analyse und Begehren, Moral
und Freiheit… Und dann noch zu sagen, dass diese so unterschiedlichen, treiben-
den Zugtiere in Wirklichkeit ursprünglich austauschbare Zwillinge sind…, die wir
nur gegen einander ausspielen?
So dass sich unsere Kultur, unsere Lebenswirklichkeit, an so vielen Stellen auf-
spaltet, verliert und auch in uns selber chaotisch bekämpft?
Verständlich sind die Ängste jedenfalls…
Ja, das Seminar würde gelingen, wenn wir auch persönlich mutig den „wissen-
schaftlichen“ Tabubruch begehen und eine beargwöhnte Grundlinie unser Ge-
schichte wiederfinden, die doch völlig offenkundig ist… Und dann nicht nur
distanziert das beobachten, was Philosophie zu Lust und Freude zu sagen hat,
sondern sicherlich im Gespräch mit vielen Zeugen (Epikur, Spinoza, Schopenhau-
er, Nietzsche) immer wieder zu der erkennenden Freude zurückfinden, wie an dem
ersten Tag, an dem etwas einfällt, aufleuchtet und die Welt neu ist… Und wir
selbst neu leben…
Eine „fröhliche Wissenschaft“…
Literatur wird im Seminar bekanntgegeben.
Termin: Dienstag, 16:00-19:00 Uhr
31II Lehrveranstaltungen
2.3 Praktische Philosophie
2.3 Praktische Philosophie
Auseinandersetzung mit ethischen
Fragestellungen an Filmbeispielen online
Seminar, HSZ 4100.006
Michael Zips, Kath. Studentenpfarrer Ulm
Nach einem Unfall ist ein Mann querschnittsgelähmt und will nicht mehr
leben. Hat er ein Recht auf seinen Tod?
In einem Waisenhaus werden Abtreibungen vorgenommen - ist das
ethisch zu vertreten?
Ein Vergnügungspark gerät außer Kontrolle, ist technisch nicht mehr zu
beherrschen und es kommt zur Katastrophe.
"Das Meer in mir", "Gottes Werk und Teufels Beitrag", "Westworld" - das
Medium Film eignet sich (gerade in Corona-Zeiten) gut, um daran ethi-
sche Fragestellungen aufzuwerfen und nach Orientierung zu suchen.
Ausgehend von christlich-ethischen Prinzipien (einer theologischen Ethik)
werden wir die Konflikte analysieren, Argumente diskutieren, abwägen
und Entscheidungen treffen.
Die drei genannten Filmbeispiele sind nur Vorschläge; mir ist wichtig,
dass sich die SeminarteilnehmerInnen mit ihren eigenen Themen und
Interessen und den entsprechenden Filmen einbringen.
Schön wäre es, wir könnten eigene Clips erstellen, Filmmusik ausprobie-
ren, ... also auch praktisch umsetzen, was wir theoretisch erarbeiten.
Termin: Mittwoch, 16:00-17:30 Uhr
32II Lehrveranstaltungen
2.4 Interdisziplinäre Seminare
2.4 Interdisziplinäre Seminare
Umweltethik online
Seminar, HSZ 5100.001
Prof. Dr. Thomas Kirchhoff, Universität Ulm
Die Umwelt- oder Naturethik ist ein interdisziplinäres Feld der prakti-
schen Philosophie. Sie rekonstruiert die Argumentationen, mit denen der
Schutz und die nachhaltige Nutzung von Natur begründet werden kann.
Sie fragt nach den vernünftigen Begründungsmöglichkeiten für den
Schutz unserer Umwelt, von Natur, Tieren und Pflanzen, Biodiversität,
Klima usw. Im Seminar machen wir uns mit grundlegenden umweltethi-
schen Begriffen, Positionen und Argumentationen vertraut: Nach welchen
Prinzipien kann der menschliche Umgang mit Natur bewertet werden
(Konsequentialismus, Tugendethik, Deontologie)? Welche unterschiedli-
chen Werte kann Natur haben (Axiologie)? Wie sind diese Werte gesell-
schaftlich fundiert und kulturgeschichtlich entstanden? Stellen bestimmte
Naturphänomene subjektähnliche Entitäten dar, denen gegenüber Men-
schen moralische Verpflichtungen haben wie gegenüber anderen Men-
schen (Biozentrismus, Pathozentrismus/Sentientismus, Ökozentrismus)?
Zudem behandeln wir Konzepte wie Nachhaltigkeit, Umweltgerechtigkeit
und Ökosystemintegrität sowie Handlungsfelder wie Klimaschutz und die
Erhaltung von Biodiversität.
Die Teilnahme am Seminar erfordert keine philosophischen Vorkenntnis-
se. Texte werden zu Semesterbeginn online zugänglich gemacht. Eine
umsichtige Einführung in das Thema bietet: Ott, Konrad 2014: Umwelte-
thik zur Einführung. 2., ergänzte Auflage. Hamburg, Junius.
Termin: Mittwoch, 16:15-17:45 Uhr
33II Lehrveranstaltungen
2.4 Interdisziplinäre Seminare
2.4 Interdisziplinäre Seminare
Wirtschaftsethik online
Kompaktseminar, HSZ 5100.002
PD Dr. Jörg Wernecke, TU München
Fragt die philosophische Ethik nach den allgemeinen Regeln moralisch
gebotenen Handelns und deren Begründung, so fokussiert die Wirt-
schaftsethik ihren Blick auf die moralische Bewertung von wirtschaftli-
chen Systemen, deren moralische Normen und Ideale, die Möglichkeiten
und Grenzen der Implementation moralischer Normen in ökonomische
Handlungssysteme sowie deren Folgen (und Nebenfolgen) für Person,
Gesellschaft und politische Systeme. Infolge sind nicht nur die Begrün-
dung von Normen, z.B. von Menschenrechten, und die Bewertung der
ökonomischen Folgen moralischen Verhaltens Gegenstand von Wirt-
schaftsethik, sondern auch Fragen einer Verantwortungsethik in persona-
ler, regionaler und globaler Perspektive.
In einem Einführungsseminar sollen die TeilnehmerInnen die philosophi-
schen Grundlagen der zentralen Positionen der Wirtschaftsethik von der
Antike bis zur Gegenwart kennenlernen und einordnen können. Von den
TeilnehmerInnen wird die Übernahme eines Referates erwartet.
Termin: 20.11. 14:30-17:30 Uhr; 27.11. 14:30-18:00 Uhr
04.12. 14:30-17:30 Uhr; 11.12. 14:30-18:30 Uhr
online
34II Lehrveranstaltungen
2.4 Interdisziplinäre Seminare
2.4 Interdisziplinäre Seminare
Technikphilosophie online
Seminar, HSZ 5100.003
PD Dr. David Espinet, Universität Freiburg
Was ist Technik? Bloßes Instrument in der Hand des autonomen Menschen oder
selbst autonome Kraft, die uns umso mehr bestimmt, desto umfassender wir die
Welt – ja uns selbst – technisch und technologisch gestalten? Diese und verwandte
Fragen beleuchten wir mit Blick auf die folgenden drei Themenbereiche: (1)
Grundbegriffe des Technischen: Was ist Technik? Unterscheidet sie sich von
Natur und worin könnte dann die Autonomie der Technik bestehen? (2) Mensch-
sein in einer technischen Welt: Welches ist das Verhältnis von Mensch und Ma-
schine? Wer oder was bestimmt hier wen? (3) Ethik der Technikfolgenabschät-
zung und Roboterethik: Welches ist der richtige Umgang mit Technik? Brauchen
wir eine neue Ethik für sog. „intelligente“ bzw. „autonome“ künstliche Systeme
und wenn ja, welche genau?
Die Teilnahme am Kurs setzt keine philosophischen Vorkenntnisse voraus. Texte
werden zu Semesterbeginn online zugänglich gemacht. Umsichtige Einführungen
ins Thema bieten: Alfred Nordmann: Technikphilosophie. Eine Einführung, Ham-
burg: Junius Verlag 2015 und Janina Loh: Roboterethik. Eine Einführung, Berlin:
Suhrkamp 2019.
Termin: 05.11.20, 12.11.20, 26.11.20, 14.01.21, 21.01.21, 28.01.21
und 11.02.21, jeweils 14-17 Uhr
35II Lehrveranstaltungen
3. Kulturanthropologie
3. Kulturanthropologie
Verrat – Betrug – Intrige: Die menschliche
Bosheit und ihre Darstellung in der Literatur
online
Seminar, HSZ 8100.001
Roman Yaremko, M.A. Universität Ulm
Was wäre die gesamte Weltliteratur ohne ihre bekanntesten Texte über Mord, Betrug, Verrat,
Eifersucht, Niedertracht oder Intrige gewesen? Sie könnte voreingenommen, langweilig,
angepasst oder sogar weltfremd sein, aber keinesfalls vollständig. Vollkommen eingeengt
wäre sie also. Die Bosheit des Menschen, seine Schlechtigkeit und Gemeinheit, kennen in
der Literatur keine Grenzen und können genauso uferlos sein, wie dies nur seine Liebe und
Güte zu sein vermögen. Grausam und böse kann natürlich fast jeder Mensch handeln, was
jedoch diese Behauptung für die Literatur interessant macht, ist die hautdünne Trennlinie
zwischen Gut und Böse, d.h. dieser ganz konkrete Umkippzeitpunkt, ab dem ein abrupter
Abbruch einer gut vertrauten und zuvor sittlich richtigen Wertvorstellung erfolgt. Zahlreiche
Autoren von Homer über Shakespeare und bis Dostojewskij haben eine Vielzahl von literari-
schen Geschichten vorgelegt, in denen gezeigt wird, dass der Mensch ein höchst ambivalen-
tes Wesen in seinen Gedanken und Handlungen darstellt und voll skurriler Gegensätze
steckt.
Das angebotene Seminar will eine Annäherung an die menschliche Ambivalenz und ihre
literarische Darstellung wagen. Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung liegt auf der Dop-
pelstruktur des Bösen und ihrer literarischen Interpretation. Besprochen werden die ausge-
wählten Texte von Shakespeare, Molière, Kleist, Keller, Meyer, Ibsen, Grillparzer,
Dostojewskij, Tschechow, Hauptmann, Camus etc.
Für die Auswahl der Textbeispiele können auch Wünsche der TeilnehmerInnen entgegenge-
nommen werden. Das genaue Programm, die Texte und eine Sekundärliteraturliste werden
im Netz bereitgestellt.
Literatur zur Vorbereitung: Köhlmeier, Michael; Liessmann, Konrad Paul (2019): Der
werfe den ersten Stein. Mythologisch-philosophische Verdammungen. München: Hanser.
Termin: Montag, 14:00-15:30 Uhr
36II Lehrveranstaltungen
3. Kulturanthropologie
3. Kulturanthropologie
„Das geht ja gar nicht“. Tabu und Tabubruch
Seminar, HSZ 8100.002 online
Stephan Schwarz, Evang. Hochschulpfarrer Ulm
Jede Gesellschaft kennt Tabus, Dinge, die man nicht sagt, Dinge, die man
nicht tut. Und jede Gesellschaft kennt den Bruch von Tabus: Wer das
Tabu bricht, wird ausgeschlossen, gemieden, verachtet – oder gefeiert.
Es lohnt sich daher, sich ein Semester lang mit diesem Thema zu beschäf-
tigen.
Ausgehend von Sigmund Freuds „Totem und Tabu“ werden wir fragen:
Welche Tabus gibt es heute? (Wozu) braucht es Tabus? (Wozu) braucht
es Tabubrüche? Und was bedeuten sie für unser (Zusammen-)Leben?
Je nach Interesse der Teilnehmenden können disziplinübergreifend unter-
schiedliche Perspektiven des Themas ausgelotet werden. Hier einige Bei-
spiele:
Tabubrüche in der Politik (z.B. Donald Trump), Tabubrüche in der For-
schung (z.B. Clearview und seine Gesichtserkennungs-Software),
Tabubrüche in der Sprache (z.B. die absichtliche Verschiebung der
„Grenzen des Sagbaren“), Tabubrüche in Kunst (z.B. Selbstverletzung als
Protest), Film und Literatur, Tabus rund um Körperlichkeit, Religion,
Sexualität, Tod.
Der Kurs lebt vom Engagement und der Diskussionsfreudigkeit der Teil-
nehmer/innen.
Literatur wird im Kurs bekanntgegeben.
Termin: Mittwoch, 16:15-17:45 Uhr
37Sie können auch lesen