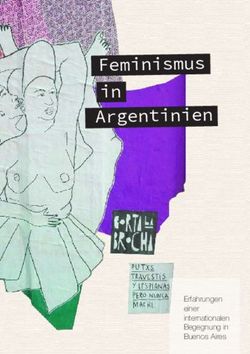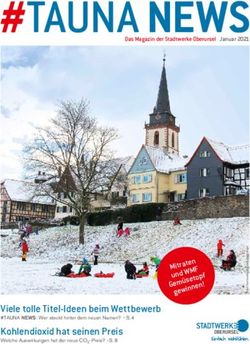KALASCHNIKOW - MON AMOUR - Begleitmaterial zur Vorstellung - Dschungel Wien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Begleitmaterial zur Vorstellung
KALASCHNIKOW – MON AMOUR
© Rainer Berson
Dschungel Wien
Ko-kreatives Tanztheater | 60 Min. | 14 - 23 Jahre
Begleitinformationen erstellt von: Sophie Freimüller
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.atKULTURVERMITTLUNG
Vorbereitender Workshop
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse
auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre Schüler:innen auf das Medium „zeitgenössisches
Theater“ vor – mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und
Schauspielbereich.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.
Publikumsgespräch
Sehr gerne können Sie sich für ein kostenloses Publikumsgespräch direkt im Anschluss an die
Vorstellung anmelden. Im Publikumsgespräch können die Kinder und Jugendlichen relevante
Themen des Stückes bearbeiten, Fragen stellen und ihren ersten Eindrücken Ausdruck
verleihen. Unterschiedliche Formate passend zu Inhalt und Zielgruppe – zum Teil mit
interaktiven Elementen – bieten den geeigneten Rahmen für direkten Austausch und
ermöglichen neue Zugänge zur darstellenden Kunst.
Bitte geben Sie bei der Reservierung bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.
Nachbereitender Workshop
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die Schüler:innen das gesehene
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.
Ansprechperson für weitere Informationen und Beratung:
Madeleine Seaman | +43 1 522 07 20-24
m.seaman@dschungelwien.at
IIInhaltsverzeichnis
1. ZUR PRODUKTION ........................................................................... 1
1.1 Inhalt ..................................................................................................... 2
1.2 Konzept und Ideen ................................................................................. 6
1.3 Gesprächsfetzen aus Gesprächen mit den Tänzern ................................ 7
1.4 Das Team ............................................................................................. 10
2. HINTERGRUNDINFORMATION ....................................................... 12
2.1 Weiterführende Empfehlungen ........................................................... 15
2.2 Glossar und weiterführende Begriffe ................................................... 17
3. IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG ................................. 21
III1. ZUR PRODUKTION
Kalaschnikow – Mon Amour
Dschungel Wien
Uraufführung
Ko-kreatives Tanztheater | 60 Min. | Ab 14 Jahren
Triggerwarnung: Dieses Stück enthält Darstellungen von Gewalt und Kriegsgeschehen, die
einige Zuschauer:innen beunruhigend finden können. Es besteht jederzeit die Möglichkeit,
die Vorstellung durch den hinteren Bühnenausgang zu verlassen.
Vorstellungstermine im Dschungel Wien:
DO 23.09.2021 20:00 Premiere
FR 24.09.2021 19:00
SA 25.09.2021 19:30
MO 27.09.2021 10:30
DI 28.09.2021 10:30
DI 09.11.2021 10:30
MI 10.11.2021 10:30
DO 11.11.2021 10.30
FR 12.11.2021 19:30
MO 28.03.2022 19:30
DI 29.03.2022 10:30
MI 30.03.2022 10:30 + 19:30
Team
Konzept & Choreografie: Corinne Eckenstein
Bühne: Hawy Rahman
Kostüm: Kareem Aladhami
Musik: Karrar Al Saedi
Video: Osama Rasheed
Projektleitung: Jennifer Vogtmann
Regieassistenz: Sophie Freimüller
Mit: Ali Reza Askari, Javid Hakim, Ahmad Hazara, Iliya Hosseini, Jasir Karimi, Morteza
Mohammadi
Ermöglicht durch Im Rahmen von
11.1 Inhalt
Männerwelt(en)
»Dieses Stück begann mit der Frage, warum junge Männer eine Kalaschnikow auf ihren Körper
tätowieren. Weil sie Stärke und Macht symbolisiert? Weil sie für manche ein Symbol für
Freiheit und sogar Hoffnung ist? Gleichzeitig ist sie die Waffe, die uns die Zukunft genommen
hat und erinnert so an den Krieg, vor dem wir geflohen sind.«
Gemeinsam mit jungen afghanischen und irakischen Männern wurden Männlichkeitsbilder
untersucht. Solche, die eine Reibungsfläche für sie sind, aber auch solche, die ihnen von außen
entgegengebracht werden. Hier zu sein bedeutet, in Frieden zu leben, aber der Krieg im
Inneren ist immer noch präsent. Dieses Stück handelt vom Wunsch, in Frieden mit sich selbst
und anderen zu leben. Es geht um Trauma und Traum, um Heilung und Verletzung, um Wut
und Vergebung. Ein sehr persönliches Stück, das die Erfahrungen der jungen Geflüchteten in
traumbildartige Sequenzen übersetzt und ihr Hoffen und Bangen mit einer beeindruckenden
Offenheit auf die Bühne bringt.
2KALASCHNIKOW – MON AMOUR - Inhaltsbeschreibung
Diese Inhaltsangabe dient in erster Linie zur Information für Sie als Pädagog:in und ist nicht
zur Weitergabe an Ihre Schüler:innen gedacht. Die Inhaltsangabe soll Ihnen außerdem
helfen, nach dem Stückbesuch mit Ihren Schüler:innen darüber zu sprechen, was sie gesehen
haben.
Während des Einlasses rollen 6 junge Männer eine große Plastikfolie, die den Boden der Bühne
bedeckt, auf. Auf der Bühne steht ein oranges zusammengeklapptes Bühnenbild mit Tor. Die
Männer stehen auf und tragen die Plastikrolle, wie einen Stab in einer Reihe hinter die Bühne.
Männerstimmen aus dem Off ertönen. Sie sprechen in gutem Deutsch mit Akzent über die
Bedeutung der Kalaschnikow, von Krieg, Hoffnung, Freiheit, Traum und Trauma.
Dann setzt Musik ein und die sechs Tänzer tippeln Schulter an Schulter, wie eine menschliche
Mauer auf die Bühne. Sie beginnen panisch nach Luft zu schnappen und versuchen verzweifelt
sich Raum zu verschaffen, indem sie sich voneinander stoßen. Aber sie kommen nicht los, da
sie an ihren T-Shirts miteinander verbunden sind. Einer beginnt zu laufen und zieht die
anderen mit sich. Sie laufen in Kreisen untereinander durch und verknoten sich so, bis sie
wieder schwer atmend aneinandergefesselt sind. Sie öffnen heimlich die Zipper ihrer Shirts,
lösen sich langsam aus dem Knoten und verteilen sich. Alle ziehen sich ihre T-Shirts über den
Kopf und rollen diese auf. Die entstandenen Rollen heben sie über ihre Köpfe und schauen,
wie nach einem Flugzeug gen Himmel. Plötzlich drehen sich alle Richtung Mitte und stellen
sich in einer Reihe auf. Mit den aufgerollten T-Shirts fahren sie scannend den Körper des
Vordermanns ab. Dann verbinden sie ihm die Augen mit dem Shirt und stoßen sich
gegengleich zur Seite bis sie fallen. Sie schieben sich die Augenbinden, wie Turbane auf die
Stirn und gehen sofort wie Tiere auf alle viere. Dabei wirken sie hektisch und verängstigt,
springen übereinander, gehen vor und zurück und dann hinter das Bühnenbild.
Über dem Bühnenbild hängt eine Plastikfolie. Das Geräusch von Wasser ertönt und die Folie
wird weggezogen. Dahinter stehen die Tänzer. Einer kommt nach vorne und beginnt
traditionell persisch zu tanzen. Vier der anderen steigen ein und sie bewegen sich so als
Schwarm über die Bühne. Der letzte bleibt zurück und hüllt sich wie ein Geist in das Plastik.
Langsam kommt auch er nach vor und die anderen schlüpfen zu ihm unter die Folie. Sie
drücken ihre Gesichter und Hände gegen die Folie, als ob sie nicht weiterkämen. Einer nach
dem anderen hebt den Kopf hervor und das Knäuel beginnt sich in Wellen zu wiegen, bevor
der Geist samt Plastik von der Bühne stürmt.
Die anderen setzen sich auf den Boden und beginnen sich ein kleines Auto zuzurollen. Dabei
sprechen sie auf Farsi und lachen. Sie bemerken nicht, dass der sechste Tänzer wieder auf die
Bühne gekommen ist und mit seinem Hemd, wie mit einer Kalaschnikow, auf sie zielt. Der
jüngste springt mit dem Auto auf. Die jagen ihm hinterher. Nur einer bemerkt die
Kalaschnikow und bleibt. In einem kurzen Duett nimmt der eine dem anderen die Waffe ab
und geht damit über das Publikum zu den starrenden anderen Tänzern. Er erschießt sie. Sie
fallen hinter das Bühnenbild. Das Auto fällt vorne zu Boden. Der Mann mit der Waffe geht ab.
Der letzte Tänzer bleibt zurück und beginnt indes ein Solo, bei dem er stetig in sich
zusammenklappt. Ein weiterer kommt hervor und sie beginnen ein Duett. Sie sind stetig in
3Berührung, im Fluss, verschmelzen. Auf allen vieren trägt der eine den anderen ins Zentrum
der Bühne, wo die restlichen Tänzer die Wände des Bühnenbilds öffnen und um alle schließen.
Es entsteht ein Haus, dessen inneres durch die Fenster des Bühnenbilds einsehbar ist. Sie
schieben es herum. Dann öffnen sie unter Anstrengung die Türen und einer nach dem anderen
versucht zu fliehen, was immer wieder vom Rest verhindert wird. Nur einer schafft es raus,
während die Türen wieder schließen. Er beginnt um die Konstellation zu laufen. Die anderen
laufen mit ihm. Sie rennen durcheinander im Kreis. Dann beginnen sie hinter dem Bühnenbild
seitlich zu hüpfen und dabei wieder schwer zu schnaufen. Zwei ziehen das Bühnenbild gerade.
Jeder tritt in einen eigenen Fensterrahmen. Sie sind wieder nur durch Plastik zu sehen,
schauen durch die Scheiben und pressen die Hände dagegen. Einer trägt jetzt ein Tutu. Er löst
sich vom Fenster und geht durch das Tor, bewegt sich wie ein Schmetterling und beginnt sich
zu waschen. Ein anderer Tänzer klettert im Tor herum, wobei er den Schmetterling nicht aus
den Augen verliert. Er geht vor und beginnt mit ihm zu spielen, was schnell ausartet. Er dreht
ihn, zieht ihn, versucht ihn immer wieder einzufangen und tötet ihn am Ende versehentlich.
Er schreit und weint. Alle anderen schauen dem Spiel zu, nur einer sitzt im Tor und meditiert.
Auf seinem T-Shirt prangt in großen orangenen Lettern der Satz „WER BIN ICH?“.
Alle kommen mit den Händen vor dem Gesicht aus dem Tor getorkelt. Sie tanzen alle synchron
eine Gruppenchoreographie. Am Ende bleibt nur der jüngste über. Er beginnt wild zu boxen,
zu breakdancen und schließlich wieder zu weinen. Die anderen ziehen sich zurück und
schieben das Bühnenbild in die linke Ecke, sodass ein neuer Raum entsteht.
Nur einer der Tänzer kommt und versucht den weinenden Jungen zu beruhigen. Sie beginnen
zu kämpfen, aber es wirkt eher wie ein Kampf unter Brüdern, ein Spiel. Am Ende deckt der
große den kleinen zu und legt sich auf ihn. Sie bilden eine Figur. Dann läuft der kleine ihm
davon und die anderen ihm hinterher hinter das Bühnenbild.
Das Licht verändert sich, Nebel zieht auf: ein Alptraum beginnt. Einer der Tänzer trägt einen
goldenen Handschuh. Von diesem wird der kleine Tänzer hinter der Wand hervorgezogen. Es
beginnt ein Kampf mit der Hand. Die anderen schieben die Mauer vor ihn, sodass er nur noch
durch die Scheiben zu sehen ist. Er hängt sich ins Tor, fällt, wird von der Hand am Hals wieder
hochgezogen und beginnt dann von der Hand liebkost zu werden und schließlich zu onanieren.
Im Hintergrund formatieren sich die anderen neu. Sie transformieren zu einer Figur, einem
Drachen. Der Solist von eben, legt den Handschuh im Tor ab und baut sich in ein. Der Drache
wandert. Die Bewegungen werden immer wilder, bis der Drache in sich zusammenfällt.
Die Tänzer liegen aufeinander. Einer beginnt leise ein afghanisches Lied über das Land, das
müde geworden ist vom Krieg, zu singen. Die anderen steigen ein. Manche beginnen zu
weinen. Da steht der Jüngste auf und beginnt den singenden und weinenden Haufen
auszulachen. Die anderen stocken, starren ihn an und lachen mit ihm. Hinter den Fenstern
findet jetzt ein Fest statt. Sie beginnen wieder persisch zu tanzen und ein lustiges afghanisches
Lied über das ledige Dasein zu singen. Einer findet den goldenen Handschuh im Tor und sie
fangen an ihn hin und her zu werfen. Als der, der zuvor mit dem Handschuh gekämpft hat,
diesen zu fangen kriegt, setzt bedrohliche Musik ein und alle gehen ins Freeze. In Zeitlupe
kommen sie auf ihn zu, um ihn aufzufangen.
4Wie eine Puppe bewegen die anderen den in Trance gefallenen Tänzer durch das Tor nach
vorne. Dort helfen sie ihm und einem anderen in den Handstand. Zwei Tänzer setzen sich
jeweils einen der beiden auf die Schultern. Zwei neue Wesen entstehen und beginnen einen
anderen Tänzer, der sich jetzt den Handschuh angezogen hat, zu jagen. Der Alptraum wechselt
den Träumenden. Ein weiteres Trauma besucht uns im Traum. Der Mann mit der Kalaschnikow
kommt wieder. Sein Gesicht ist diesmal maskiert. Alle fliehen hinter die Scheiben des
Bühnenbilds, der mit dem Handschuh hinter das Tor. Sie halten die Hände hoch und gehen
der Reihe nach in die Knie. Dann zielt er auf den Hinterkopf des im Tor stehenden. Der wird
ohnmächtig und sackt zusammen, bevor die Waffe abgedrückt wird. Der bewaffnete Mann
tritt über seinen Körper und durch das Tor. Er lässt die Kalaschnikow fallen, sackt auf die Knie
und zieht sich wie eine Haut die Maske vom Gesicht. Vor Scham verkriecht er sich in das
Tanktop, das er trägt, und zieht es sich dabei über den Kopf, sodass die Innenseite nach außen
gedreht wird. Das Top ist nun regenbogenfarbig. Erstaunt zieht er es sich wieder an. Er streckt
sich, lächelt, ist frei und tanzt sich Fenster für Fenster ins Off.
Zwei Tänzer liegen sich hinter dem Tor gegenüber. Der eine zieht dem anderen den Handschuh
von der Hand und wirft ihn weg. Sie liegen sich gegenüber und beginnen bekannte
Klatschspiele zu spielen und mit ihren Händen zu tanzen. Sie stehen irgendwann auf und
setzen ihr Spiel im Stehen fort, rollen sich übereinander, heben sich und hüpfen.
Dann kommt einer von ihnen durch das Tor und beginnt in großen Bewegungen zu tanzen. Er
springt und dreht sich in der Luft, dazwischen spricht er einen Monolog auf Deutsch zum
Thema Integration und warum er trotz allen Mühen noch nicht angekommen zu sein scheine.
Woher die ganzen Grenzen kämen. Er stellt die Frage danach, wer überhaupt integriert sei.
Ein Showman kommt in das Tor und beginnt wild zu tanzen. Er beschwört Ishtar, die in
männlicher Gestalt unter einem riesigen goldenen Rock auf die Bühne gedreht kommt. Ishtar
hebt ihren Rock und alle Tänzer kriechen schleunig darunter, wie unter ein Zelt. Zusammen
beginnen sie sich in einer pulsierenden Kugel auf der Stelle zu deformieren. Der Jüngste wird
unter dem Rock rausgeworfen. Der beginnt das goldene Ungetüm brüllend anzugreifen. Ishtar
weicht aus und verschluckt ihn schließlich wieder in ihrem Schoß. Alle anderen stürmen unter
dem Rock hervor und laufen ab. Nur der Junge zieht sich den Rock, nur das Gesicht freilassend,
über und läuft schnell in Kreisen. Dann hängt er sich fledermausartig in das Tor und schaut
neugierig und frech herausfordernd ins Publikum, bis er fällt.
Es wird dunkel. Aus dem Publikum kommt der Musiker auf die Bühne und singt live auf
Arabisch. Die Tänzer kommen oberkörperfrei mit der Plastikrolle vom Beginn auf die Bühne,
rollen sie aus und kippen das Bühnenbild nach hinten um. Dann ziehen sie sich die Hosen aus.
Unter Gesang beginnen sie Eimer voll Erde auf das Plastik zu schütten. Einer schüttet stetig
Wasser von einem Kübel in den anderen. Die anderen beginnen sich selbst und sich
gegenseitig mit Erde einzureiben. Von der Decke kommt Wasser wie im Nebel. Die Tänzer
spielen. Es wird still, nur das Wasser ist zu hören. Sie stellen sich unter den Nebel, waschen
sich und halten Gesicht und Arme gen den Regen. Das Licht geht aus, das Wasser bleibt an.
51.2 Konzept und Ideen
„Zwischen Traum und Trauma.“, beschrieb Corinne Eckenstein, Choreographin und
Regisseurin von „Kalschnikow – Mon Amour“, die Arbeit am Projekt einmal nach einer langen
Tanzprobe und dem immer darauffolgenden gemeinsamen Essen voller Gesprächs- und
Mitteilungsbedarf. Der Traum vom besseren Leben, vom Himmel Europas, das sich als gar
nicht mal so himmlisch entpuppt, aber immer noch besser ist, als die Heimat und die Traumata
von Diskriminierung, Flucht und Ausgrenzung, die die Beteiligten nach Wien mitgebracht
haben und mit denen sie sich im Zuge der Proben noch intensiver als ohnehin schon
befass(t)en.
Das Projekt „Kalaschnikow – Mon Amour“ war ein langer Prozess aus Gesprächen, freien Tanz-
Workshops und Flashmobs, bildnerischem Arbeiten und daraus resultierenden Ausstellungen,
bis zu intensiven Proben für das Stück mit sechs jungen geflüchteten Männern, die wir über
die freien Tanz-Workshops kennenlernen durften. Seit nun gut einem Jahr dreht sich alles um
die Frage(n) nach Männlichkeit. Was ist Männlichkeit? Was ist toxische Männlichkeit? Gibt es
einen Unterschied zwischen arabischen und österreichischen männlichen Rollenbildern? Wie
ist das Verhältnis zwischen Männern* und Frauen*? Welche männlich gelesenen und welche
weiblich gelesenen Anteile trage ich in mir? Was ist Feminismus?
Mit dieser Auseinandersetzung wurde der Blick für spezifische Bedingungen, unter denen
Männlichkeit, wie auch Weiblichkeit, sozial konstruiert wird, geschärft. Schnell kristallisierte
sich heraus, dass viele der beteiligten Männer zwischen diversen Bildern, die ihnen
Gesellschaft(en) von Männlichkeit vorschreiben, hin- und hergerissen sind. Hinzu kommt, dass
der allgemeine Stereotyp, der in Österreich und Europa arabischen Männern zugeschrieben
wird, zu noch größerer Zerrissenheit führt. Ein Beispiel: Werden die Männer provoziert und
reagieren durch lautstarkes Abwehren, werden sie von der österreichischen Politik und den
Medien in die Rolle des gewalttätigen, „nicht-normativen“ Anderen, des „bösen Ausländers“,
gedrängt. Geben sie der Provokation aber kleinlaut bei, gelten sie in ihrer eigenen Kultur noch
verstärkter, als im europäischen Männlichkeitsbild, als verweichlicht und unmännlich. Gerade
bei Menschen mit Fluchterfahrung kann die neue Lebenssituation aber auch zum Raum neuer
Freiheiten werden, durch die es möglich ist, diversere und vielschichtige Männlichkeitsbilder
auszuloten. Es geht also um eine Suche in Ungewissheit bei gleichzeitiger Zukunftszuversicht,
um ein ständiges Selbstreflektieren, Fremdreflektieren und die Reflexion und Hinterfragung
gesellschaftlicher Teilhabe, um Selbstbild und Identität und um Tabuthemen wie Sexualität
und Liebe zwischen Verunsicherung und Verhärtung.
61.3 Gesprächsfetzen aus Gesprächen mit den Tänzern
Die Tänzer bleiben hier anonym. Dieses Gesprächsprotokoll soll einerseits ihre
Lebensrealitäten spiegeln und andererseits zeigen, wie unterschiedlich jeder für sich ist,
obwohl alle sechs eine sehr ähnliche Geschichte haben – sie sind alle im Iran aufgewachsene
Afghanen, die zwischen 2013 und 2015 alleine oder mit nur einem kleinen Teil an Familie nach
Österreich gekommen sind – und wie divers sie in ihren Meinungen sind, obwohl sie alle mit
denselben Problemen zu kämpfen haben.
Aus Gesprächen über Männlichkeit:
„Man ist erst ein Mann, wenn man eine Frau heiratet. Ein Mann ohne Frau ist kein Mann.
Vorher ist man ein Junge.“
„Männlichkeit ist etwas Großes. Wir müssen als Männer etwas machen und bauen. Wie die
Pyramide in Ägypten. Es muss groß sein.“
„Männer sind so. Sie müssen sich messen. Es muss einer recht haben. Es muss einer gewinnen,
wenn sie nicht der gleichen Meinung sind.“
Nach einer Diskussion über Feminismus:
„Ich habe es erst hier gelernt. Ich habe mit Frauen über tiefe Themen diskutiert und immer
wieder nachgefragt: Verstehst du, was ich sage? Und da hab ich gemerkt, wie schlau Frauen
sind. Ich war überrascht. Erst jetzt weiß ich, ich kann mit Frauen ganz gleich reden, wie mit
Männern. Ich schäme mich ein bisschen.“
Zum Thema Sexualität:
A: „Sind Frauen Kunst?“
B: „Mir ist Kleidung und Schminke von Frauen sehr wichtig, weil das ist Kunst!“
A: „Viele Gedichte und Lieder und Kunstwerke sind über Frauen.“
C: „Kunst ist ein Gefühl.“
A: „Dann sind Frauen Kunst. Für mich.“
„Viele glauben, ich bin schwul, wenn ich tanze, weil ich tanze.“
„Mit Frauen aus der Türkei oder dem Iran hast du immer Probleme. Immer Drama. Mit
österreichischen Frauen hatte ich noch nie ein Problem. Außer ich werde wütend natürlich.
Meine letzte Freundin aus Österreich hatte was mit ihrem Nachbarn, dieses Arschloch. Sie sind
jetzt zusammen, so dumm. Eine österreichische Freundin hat gesagt, ich bin ein Terrorist. Sie
ist deppat. Aber ich will eh nicht heiraten. Ich bleibe für immer ein Junge, kein Mann.“
7Zum Thema Anpassung:
„Im College, in das sie mich gegeben haben, waren ausschließlich andere Geflüchtete. Ich habe
mit meinen Freunden Arabisch, nicht Farsi, sodass mich alle verstehen. Ein Lehrer ist
gekommen und hat mich geschimpft: Hey! Sprich Deutsch! Integriere dich!
Ich habe nur gesagt: Ich habe mich integriert! Hier gibt es niemanden, der Deutsch spricht.
Wie soll ich mich integrieren, wenn ich nie unter Österreicher:innen bin und immer nur mit
anderen Geflüchteten zusammengesteckt werde? Ich hasse dieses Wort: Integration.“
Über Traumata und Kindheitstraumen:
„Auf der Welt gibt es Krieg. Und in mir drinnen ist auch Krieg. Ich kämpfe mit mir selbst.“
A: „Ich muss jede Arbeit nehmen, die ich kriege. Wann hört die Arbeit endlich auf, wann habe
ich endlich Pause?“
B: „Mir ist nicht mehr jede Arbeit gut genug, aber ich muss schauen, wegen dem Geld.“
A: „Ich muss arbeiten für meine Mutter. Bei uns ist das so, weißt du? Sobald der ältere Bruder
verheiratet ist, muss der kleinere arbeiten. Egal, wie klein du bist. […] Mit 11 oder 12 Jahren:
Ich bin ins Restaurant gegangen, bevor es hell wurde und wieder rausgegangen, als es schon
finster war. Ich habe nie die Sonne gesehen und ich war die ganze Zeit auf Drogen, die sie mir
gegeben haben. Was ist das für eine Kindheit?“
Ein Gespräch über Gewalt:
A: „B. hat sich geschlagen.“
B (mit einem ganz blauen Auge): „Sag das nicht Mann! Ich schäme mich! Außerdem hast du
dich auch geschlagen.“
A: „Ich wollte dir helfen.“
B: „Ja, es waren 10 gegen 2 und wir habe trotzdem irgendwie gewonnen.“
Sophie: „Aber wer waren die? Was ist denn passiert?“
B: „Tschetschenen.“
A: „Sag das nicht, sonst ist es gleich rassistisch.“
B: „Ok, aber sie haben tschetschenisch gesprochen, das ist was ich gehört habe, deswegen
sage ich Tschetschenen. Aber ich weiß es natürlich nicht.“
Sophie: „Ja und was haben die jetzt gemacht? Haben sie mit dem Schlagen angefangen?“
B: „Ääääh… naja schon irgendwie. Sie haben mich dumm angeschaut und ich habe gesagt:
‚Was schaust du so dumm?!‘ und dann ging es los!“
Sophie: „Das ist alles? Deswegen hast du jetzt ein blaues Auge?“
B: „Ich muss mich doch verteidigen? Blicke können auch diskriminieren! Ich muss mir nicht
alles gefallen lassen. Ich habe zugeschlagen.“
Sophie: „Also ich versteh das schon, find es aber falsch. Weißt du, wie oft ich Männer schlagen
müsste, wenn es nur um Blicke geht? Mindestens einmal am Tag! Aber glaubst du, tu ich das?“
B: „Hm.“
8Aus einer Voicemail über die Lage in Afghanistan:
„[…] Sobald sie Leute suchen, die nach Afghanistan gehen, um zu kämpfen, werde ich gehen.
Ich schlafe nicht mehr. Ich möchte mit den Taliban machen, was sie mit den Frauen und
Kindern machen. Ich habe so schreckliche Videos gesehen. Weißt du, ich frage mich, was
mache ich hier in Österreich? Was ist das? Warum bin ich hier? Was ist das für ein Leben,
wenn es meinen Leuten so schlecht gehen muss. Ich gehe nach Afghanistan und töte die
Taliban. Nicht um zu töten, sondern weil ich geboren bin zum Helfen. Ich helfe damit den
Menschen und den Tieren in Afghanistan. Meine Mutter hat geweint, wie ich es ihr erzählt
habe. Ich habe gesagt, wein nicht, sei stolz, dass du einen Sohn hast, der hilft. […]“
© Rainer Berson
91.4 Das Team
Corinne Eckenstein (Regie und Choreografie): Corinne Eckenstein, geboren in Basel, Schweiz.
Künstlerische Leitung und Direktion des DSCHUNGEL WIEN. Regisseurin, Choreografin,
Visionärin. Sie absolvierte ihre Ausbildung als Schauspielerin und Tänzerin in New York und
San Francisco. Ihre Theaterlaufbahn begann sie am jungen theater basel, wohin sie später als
Regisseurin zurückkehrte. Seit 1990 lebt Eckenstein in Wien, wo sie u.a. mit Meret Barz,
Sebastian Prantl, Milli Bitterli, Eva Brenner, den Wiener Festwochen, ImpulsTanz, dem Theater
der Jugend, Kosmos Theater, TanzQuartier und Schauspielhaus Wien arbeitete. 1995
begründete sie gemeinsam mit der Autorin und Regisseurin Lilly Axster, die
queerfeministische Gruppe: TheaterFOXFIRE, deren Produktionen (insgesamt 44) in den
vergangenen Jahren große Erfolge bei Publikum und Presse verzeichneten. 2000 eröffnete sie
das „theater kosmos frauenraum“ mit „Königinnen“ und war bis 2003 als Hausregisseurin
tätig. Gemeinsam mit ihrer Compagnie TheaterFOXFIRE war sie von Beginn an wichtige
Impulsgeberin des 2004 neu gegründeten DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges
Publikum. Daneben ist sie kontinuierlich auch international tätig, u.a. in Zürich, Basel,
Hannover und Berlin. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt in der Förderung von Tanz für junges
Publikum. 2016 übernahm sie die künstlerische Leitung und Direktion des DSCHUNGEL WIEN.
Mit ihrem Fokus auf Kunstvermittlung, Diversität und Nachhaltigkeit, spricht sie zentrale
Erfordernisse eines urbanen Kinder- und Jugendtheaters im 21. Jahrhundert an. Ihre
besondere Stärke liegt darin, immer wieder neue Formen und Visionen zu entwickeln.
Hawy Rahman (Bühnenbild und Workshops inklusive Pop Up Ausstellungen): Hawy Abdel
Rahman ist Bildhauer und Perfomer. Er wurde 1972 in Bagdad (Irak) geboren, hat aber
mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft. Er studierte in Bagdad am College of Fine
Arts Bildhauerei und später an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und hat ein
Diplom in Bildhauerei und Druckgrafik. Er arbeitet viel mit Jugendlichen unter anderem im
Jugend College in der Holzwerkstatt oder macht mit ihnen Ausstellungsprojekte in seinem
Atelier.
Jennifer Vogtmann (Projektleitung): Jennifer Vogtmann wurde 1982 in Sindelfingen
(Deutschland) geboren. Sie ist Sozialpädagogin und Theater-, Film- und
Medienwissenschaftlerin mit Ausbildung zur Kulturmanagerin. Zuletzt war sie in der
Jugendarbeit bei theaterpädagogischen Inszenierungen und medienpädagogischen Projekten
tätig.
Sophie Freimüller (Regieassistenz): Sophie Freimüller wurde 1996 in einem nicht einmal 100-
Seelen-Nicht-Dorf in Oberösterreich geboren und schloss 2019 ihr Bachelorstudium für
Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien ab. 2020 sammelte sie bei
„The Return of Ishtar“ erste Erfahrungen im Bereich Theaterregie und ist dem Dschungel
seitdem erhalten geblieben, meistens als Regieassistentin für Corinne Eckenstein. Sie schleicht
sich aber gerne auch in diverse andere spannende Projekte ein und stellt dann zum Beispiel
plötzlich als Frau in Ausstellungen zum Thema Männlichkeit aus. Wie macht sie das nur?
Ali Reza Askari (Tanz): Ali ist 17 Jahre jung und hat schon viel erlebt. Er wurde im Iran geboren
und hat später in Afghanistan gelebt, bevor seine Familie wieder in den Iran flüchtete. Ali ist
seit 2015 in Österreich. Er wollte immer Boxer werden. Das sieht man auch in seinem Tanzstil.
10Ahmad Hazara (Tanz): Ahmad ist 24 Jahre alt und in Karaj im Iran geboren. Schon als Kind
liebte Ahmad Musik und Tanzen. „Musik und Tanz begleitet mich durch jeden Tag. Wenn ich
tanze, bin ich voller positiver Energie.“
Iliya Hosseini (Tanz): Iliya ist 29 Jahre alt. Durch ‚Tanz die Toleranz‘ ist Iliya zum Tanzen
gekommen. Er interessiert sich außerdem für Zeichnen und Malen.
Jasir Karimi (Tanz): Jasir ist Anfang 20 und ist in Teheran geboren. Nach der Matura im Iran ist
Jasir 2015 nach Österreich gekommen. „Tanzen ist wie ein Gespräch mit mir selbst und mit
der Existenz.“
Javid Hakim (Tanz): Javid ist 29 Jahre alt und hat im Divercity Lab eine Schauspielausbildung
gemacht. Im Iran war Javid unter anderem tätig im Bereich Martial Art Choreography für
Filmproduktionen und hat Drehbuch, Regie und Fotografie gelernt. „Es geht nicht darum
schön zu tanzen, sondern um das Gefühl und die Gedanken dahinter. Wenn wir so tanzen,
kommt die Schönheit von selbst.“
Morteza Mohammadi (Tanz): Morteza ist 25 Jahre alt und im Iran geboren. Er hat 2016 bei
‚Tanz die Toleranz‘ zu tanzen begonnen. „Ich kann das sagen, Tanzen bedeutet für mich die
Freiheit für die Seele und die Freude im Moment. Manchmal finde ich die tiefen Punkte in mir
und will diese auch anderen Menschen zeigen. Vielleicht werden sie so auch die Dinge, die in
ihnen begraben sind, finden. Ich bin selbst eine suchende Person und glaube bis zum Ende
vom Leben wird das weitergehen.“
Karrar Alsaedi (Musik): Karrar Al Saedi, geboren 1998 in Bagdad, hat in Bagdad Musik studiert
und studiert seit 2018 an der MDW in Wien. Er arbeitet in den Bereichen Sound Filmdesign,
Theatermusik, Performance Art und Komposition.
Kareem Aladhami (Kostüm): Kareem ist 24 Jahre alt und wurde im Irak in Bagdad geboren.
Schon als Kind hatte er immer Interesse an Mode und hat mit 10 Jahren angefangen in
Modegeschäften als Verkäufer zu arbeiten. Er lebt seit Ende 2015 in Österreich und besucht
seit 2018 die Kunst- und Modedesignschule in der Herbststraße. Seitdem taucht er in die Welt
der Mode ein und verkauft auch schon erfolgreich seine Designs.
Osama Rasheed (Video): Osama Rasheed, geboren 1986 in Bagdad, hat in mehreren
internationalen Film- und Kunstprojekten als Regisseur und Kameramann gearbeitet. Seine
Projekte wurden in Kunsthäusern und auf Festivals, wie auf dem Toronto International Film
Festival, im MOMA New York und im Haus der Kulturen der Welt Berlin, gezeigt.
112. HINTERGRUNDINFORMATION
Da es sich bei den Projektbeteiligten mit Fluchthintergrund letztendlich ausschließlich um
Iraker und Afghanen handelt, folgt hier ein sehr kurzer geschichtlicher und
gesellschaftspolitischer Abriss der beiden Länder.
Irak
Der Irak steht auf Platz 4 der Weltrangliste der Länder mit den meisten Bodenschätzen, was
es traurigerweise auch zum Schauplatz vieler Kriege werden ließ.
Irak war ursprünglich ein Königreich, dessen König allerdings 1958 bei einem Militärputsch
gestürzt wurde. Die Republik wurde ausgerufen. Sie sollte allerdings nicht allzu lange anhalten.
1979 bis 2003 wurde die Bevölkerung von Diktator Saddam Hussein regiert. Unter seinem
Regime führte der Irak Kriege gegen die Nachbarstaaten Iran und Kuwait und beging ein
Massaker an der schiitischen und kurdischen Bevölkerung. 2003 wurde die Regierung von
einer von den USA angeführten multinationalen Invasionstruppe gestürzt und Saddam
Hussein später für seine Taten zum Tode verurteilt. Als Grund für den Einmarsch wurde eine
angeblich vom Irak ausgehende Terrorgefahr und Verbindungen zu Al-Quaida angeführt.
Beides lässt sich nicht belegen und es stellt sich die Frage, ob nicht ökonomische Gründe, wie
Bodenschätze und Bereicherung durch Kriegsführung und Waffenindustrie im Vordergrund
des Einmarschs standen. Die USA, Großbritannien und die „Koalition der Willigen“
verabsäumte es, wie schon öfter vorgekommen, stabile Strukturen für die Nachkriegszeit
aufzubauen und die USA führte das Land während seiner Besetzung 2003-2011 in
bürgerkriegsähnliche Zustände. Wie viele tausende zivile Opfer diese unter der irakischen
Bevölkerung forderten ist unbekannt.
Während der Irakkrise 2014 eroberten Islamisten des ISIS Teile des Iraks an der syrischen
Grenze. Das Land gilt trotz Rückeroberung weiterhin als sehr instabil.
„Der Irak ist schon lange nur noch ein Land, in dem Kriege anderer auf die Kosten der
irakischen Zivilbevölkerung ausgetragen werden. Schade um unser schönes Land.“, fassten es
unser Bühnenbildner und Coach Hawy Rahman und unser Kostümbildner Kareem Aladhami
einmal während einer Probe zusammen.
Afghanistan
Nach einem kommunistischen Staatsstreich und Unruhen marschierte 1979 die Sowjetunion
in Afghanistan ein und etablierte eine neue kommunistische Regierung. Es begann ein Krieg
zwischen der sowjetisch gestützten Regierung und von den USA unterstützten und
finanzierten Widerstandsgruppen (Mudschaheddin), unter anderem den Taliban, die also von
den USA maßgeblich mitgeformt und gefördert wurden. Schließlich besiegten die
Mudschaheddin die Regierung und es kam zum Konflikt unter ihnen. 1996 kamen die radikal-
islamistischen Taliban-Milizen an die Macht und führten die Scharia ein. Nach den 9/11-
Anschlägen 2001 wurde das Regime der Taliban, das Mitglieder der Terrormiliz Al-Quaida
beherbergte, von den USA gestürzt. Die USA besetzten das Land 20 Jahre lang mit den Zielen
der Terrorismusbekämpfung und der internationalen Stabilisierungsmission, welche beide
unerreicht bleiben sollten. Schon während der demokratischen, islamischen Republik, die
ausgerufen wurde, kam es immer wieder zu Unruhen im Land, die Kindersterblichkeitsrate
war eine der höchsten der Welt und eine Durchsetzung westlicher Wertesysteme gelang nur
schleppend.
12Als die US-Amerikanischen Truppen dann 2021 mehr oder weniger plötzlich abzogen,
brauchten die Taliban keine 2 Monate, um das gesamte Land zurückzuerobern und auch die
Hauptstadt Kabul für sich zu beschlagnahmen. Die Miliz sitzt jetzt auf einem von US-
Amerikanischen Steuerzahler:innen finanzierten Waffenlager, bestehend aus besten
Kriegswaffen. Obwohl Expert:innen und afghanische Journalist:innen vor der bevorstehenden
humanitären Krise gewarnt haben, hat der globale Westen nicht gehandelt und damit
unzählige Zivilist:innen, Aktivist:innen und für den Westen arbeitende Menschen im Stich
gelassen und in Lebensgefahr gebracht. In Österreich wird zynisch weiterhin über rechtlich
ohnehin nicht durchführbare Abschiebungen nach Afghanistan diskutiert, anstatt darüber,
wie der ausgelieferten Bevölkerung dort geholfen werden und wie die Menschen auf sicherem
Wege außer Landes gebracht werden könnten.
Da Afghanistan ein größtenteils schwer zugänglicher, gebirgiger Binnenstaat ist, ist eine Flucht
kompliziert. Die meisten trotzdem geflüchteten Afghan:innen, überwiegend verfolgte
Hazaras, leben in den Nachbarländern Pakistan und Iran. In beiden Ländern gelten sie als
Bürger:innen letzter Klasse. Für sie herrschen besondere Gesetze, die sie unfrei machen: Sie
haben keinerlei Papiere, können deshalb nicht reisen; höhere Bildung wird ihnen oft verwehrt,
Vermischungen der Ethnien sind verboten und sie werden bereits im schulischen Kindesalter
strukturell diskriminiert.
Mediale und Politische Darstellungen
Die Politik und die Medien markieren geflüchtete Menschen immer als das Fremde, das
Unnormale, das Andere und grenzen sie so vom Rest der Bevölkerung ab. Nimmt mensch die
österreichischen Medien, besonders die Boulevardangebote, unter die Lupe, wird schnell klar,
welches politisch angestrebte Bild sie von geflüchteten Männern an die gebürtigen
Österreicher:innen vermitteln (sollen): Geflüchtete Männer seien gewalttätig und gefährlich,
insbesondere arabische Männer! Sie seien faul und nur auf unsere Sozialhilfen aus und viele
von ihnen seien außerdem Terroristen. Sie seien eine Gefahr für das traditionelle,
gutbürgerliche Wertesystems Österreichs. Aber welche Werte sollen das sein, die da in Gefahr
sind? Die österreichische Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) beispielsweise macht
öffentlich, dass sie durch die Migrationswelle befürchte, arabische Männer brächten ein
patriarchales Familienbild in unser Land. Wir sagen: Tausende Jahre zu spät liebe arabische
Männer! Im patriarchale (Familien-)Strukturen erhalten, sind wir Österreicher:innen nämlich
selbst ganz gut.
Ironie beiseite, ist die eben beschriebene mediale Reproduktion von problematischen und
rassistischen Männerbildern an einem aktuellen Beispiel gut ersichtlich: Der Mord an der 13-
jährigen Leonie, der sich im Juni in Wien ereignete. Der 15. Femizid innerhalb Österreichs
2021. Die mutmaßlichen Täter wurden just von den Medien als Ausländer, als Afghanen
enttarnt. Bei keinem anderen Femizid stand die Nationalität des oder der Täter medial so
präsent im Mittelpunkt. Sind die (mutmaßlichen) Täter nämlich gebürtige Österreicher, wird
das nie erwähnt und in 13 dieser mittlerweile 17 Femizide (Stand August 2021) handelt(e) es
sich bei den Verdächtigen eben um österreichische Staatsbürger.
Die Medien überschlugen sich mit Beiträgen zu diesem Kindsmord und es begann eine
rassistische und rechtlich völlig haltlose Debatte darüber, wie gefährlich afghanische Männer
nicht seien und warum nicht mehr von ihnen abgeschoben würden. Gefährlich bei so einer
lautstarken landesweiten Diskussion ist mehr die Reproduktion eines höchstproblematischen
Rollenbildes, welche natürlich auch von der Politik aufgenommen wurde.
13Die Frage eines Journalisten, ob es nicht ein Fehler seines Resorts sei, dass so viele afghanische
Jugendliche kriminell werden, – (oder eher kriminell sozialisiert und völlig traumatisiert zu uns
kommen) – weil ihnen jegliche Möglichkeit an Beschäftigung und Zugang zu Integration fehle,
ignorierte der Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und reagierte stattdessen mit
Abschiebungswünschen und -fantasien, die offenkundig auch im Kontext der aktuellen
lebensgefährlichen Zustände Afghanistans bei ihm und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
nicht aussetzen.
Es stimmt, dass afghanische Flüchtlinge auffällig oft straffällig werden und es soll nicht
bestritten werden, dass dafür eine Lösung gefunden werden muss. Gute Ansätze, in der die
Betroffenen ihre Zeit des Wartens sinnvoll nutzen könnten, gibt es viele, umgesetzt werden
so gut wie keine. Worüber aber niemand spricht, sind beispielsweise die Statistiken, die der
afghanischen Community Erfolge zuschreiben: wie gut sich afghanische Flüchtlinge im
Arbeitsmarkt integrieren, wie häufig sie im Vergleich zu anderen marginalisierten Gruppen
erfolgreich Lehren abschließen und wie sie so schon lange wichtiger – (nämlich
steuerzahlender) – und nicht mehr wegzudenkender Teil der österreichischen Gesellschaft
geworden sind.
Für die an diesem Projekt beteiligten afghanischen Tänzer, die aufgrund ihrer Herkunft schon
öfter diskriminiert und von Menschen haltlos als Terroristen beschimpft wurden, bedeutete
die Debatte Stress, Angst vor vermehrt rassistischen Auseinandersetzungen und weitere
innere Zerrissenheit. Sind sie doch so bemüht dem Rollenbild, dass ihnen auferlegt wird mit
aller Kraft entgegenzuwirken, auch wenn es manchmal unglaublich schwer, unfair,
identitätszerrüttend und daher ungesund ist, Rassismus kleinlaut beizugeben, all seinen Stolz
und die guten Gegenargumente runterzuschlucken, nur um auf gar keinen Fall (negativ und
gewaltbereit) aufzufallen.
142.1 Weiterführende Empfehlungen
Vorab möchten wir auf die im Zuge des Projekts entstandene Ausstellung zu Männerwelten
verweisen. Ein paar der Kunstwerke sind noch bis inklusive 12.11.21 im Foyer des Dschungel
Cafés zu sehen. Um weitere Ausstellungstermine sind wir aufgrund der Nachfrage bemüht.
15ANLAUFSTELLEN
Hemayat: http://www.hemayat.org/
Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende
Queer Base: https://queerbase.at/?lang=de
Unterstützung für Geflüchtete der LGBTIQ*- Communitiy
SOS Mitmensch: https://www.sosmitmensch.at/
Hilfe zur Durchsetzung von Menschenrechten, Chancengleichheit und Gleichberechtigung
EMPFEHLENSWERTE WEBSITE DES VICD
VICD: https://www.vidc.org/
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation
Das VIDC ist die älteste entwicklungspolitische Organisation der Zivilgesellschaft in Österreich.
Seit seiner Gründung 1962 fühlt sich das Institut einem internationalen „Dialog auf
Augenhöhe“ verpflichtet. In unseren drei Bereichen Global Dialogue, kulturen in bewegung
und fairplay wollen wir eine kritische Öffentlichkeit auf soziale, politische, kulturelle und
wirtschaftliche Entwicklungen aufmerksam machen.
• Afghanistan Gender Studies:
https://www.vidc.org/fileadmin/user_upload/vidc_afghanistan_gender_study_2nd_r
evised_edition.pdf
• Handbuch Vermittlung Intellektueller Genderkompetenz:
https://www.vidc.org/fileadmin/user_upload/handbuch_vermittlung_interkultureller
_genderkompetenz.pdf
• Gender Tandem Workshop für Männer: Gendersensibilisierung afghanischer Männer
https://www.vidc.org/themen/gender/gender-tandem-workshops
LITERATUR
Liebe, Sex und Allah
Das unterdrückte erotische Erbe der Muslime von Ali Ghandour
In seinem Buch spricht der muslimische Gelehrte Tabuthemen an und
bricht mit Rollenbildern auf.
162.2 Glossar und weiterführende Begriffe
Abschiebung: Abschiebung oder nach EU-Recht auch Rückführung wird die Vollstreckung der
unfreiwilligen Ausreise einer Person ohne Staatsangehörigkeit bezeichnet. Abschiebungen
sollten sich an den Asylgesetzen und der Genfer Flüchtlingskonvention orientieren. Bis es zu
einem Abschiebungsbeschluss kommt vergeht meistens viel Zeit (oft Jahre), in welcher die
betroffenen Personen bereits in den Ländern leben, aus denen sie dann abgeschoben werden,
und eine neue Lebensbasis aufgebaut haben, aus der sie gerissen werden. Leider kommt es in
Österreich nicht selten vor, dass Abschiebungen im Zusammenhang mit Machtmissbrauch in
scheinbaren Nacht- und Nebelaktionen und für die Betroffenen völlig überrumpelnd
durchgeführt werden. Es sei beispielhaft an die aufsehenerregende Abschiebung der Schülerin
Tina (12) und deren Schwester Lea (5), die bereits in Österreich geboren wurde, mitsamt deren
und weiteren Familien nach Georgien erinnert. Diese wurde in der Nacht auf 28. Jänner 2021
in Wien vollzogen.
Arabisch: Zum großen Teil wird in den Ländern der arabischen Welt arabisch gesprochen. In
Ländern der Region, die eine andere Amtssprache haben, wie etwa im Iran, in Afghanistan und
in Teilen Syriens, wird Arabisch noch vor Englisch in der Schule unterrichtet. Mit der Sprache
einher geht eine eigene Schrift, die von rechts nach links geschrieben und gelesen wird.
Ariana: Ariana bezeichnet eine historische Region zwischen Persien und Indien, die sich vor
allem über Afghanistan, aber auch über den östlichen Iran erstreckt, also grenzüberschreitend
ist. Die Arier:innen (Bewohner:innen Arianas) verbindet Geschichte und deshalb teilweise
ähnliche Kultur, Bräuche, Sitten und Traditionen.
Asyl: Als Asyl wird der (temporäre) Schutz und die Zuflucht, sowie der Zufluchtsort und freie
Obdach von Verfolgten bezeichnet. Gründe für Verfolgung sind immer diskriminierend
ansonsten aber divers. Sie können zum Beispiel auf Religion, Politik, unterschiedlichen
Überzeugungen, Ethnie, Geschlecht, Sexualität und/oder Wirtschaft beruhen.
Dari und Farsi: Dari ist eine im Iran und Afghanistan gesprochene Amtssprache, die sich
eigentlich kaum von Farsi/Persisch unterscheidet. Die Schrift ist ident zur arabischen. Was in
der westlichen Welt kaum besprochen wird, ist die These, dass Dari von der iranischen
Regierung neben Persisch eingeführt worden sei, um eine weitere Spaltung der im Iran
lebenden Bevölkerung herbeizuführen. Durch die vom globalen Westen gut gemeinte, aber
schlecht recherchierte Einführung der Option, westliche Medien neben Farsi auch auf Dari zu
konsumieren (z.B. BBC Dari), wird diese Teilung der Bevölkerung reproduziert und die
iranische Regierung (unwissentlich) unterstützt.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) richtet sich nach der Europäischen Menschenrechtskonvention und
deren Einhaltung innerhalb der Mitgliedstaaten des Europarats. Er wurde 1959 in Straßburg
vom Europarat ins Leben gerufen. Einzelne Personen, als auch Personengruppen und Staaten
können sich mit Beschwerden an den EGMR richten. Zuletzt verhinderte der EGMR zum
Beispiel die vom österreichischen Innenminister Karl Nehmanner Ende Juli 2021 geplanten
Abschiebungen nach Afghanistan, während sich das Land in einer humanitären Krise befand
(und nach wie vor befindet).
17Eine Abschiebung nach Afghanistan war und ist somit menschenrechtswidrig, weil das Leben
der abgeschobenen Person bewusst gefährdet wird. Die Beschlüsse des EGMR sind für
Europarats-Mitgliedsstaaten bindend.
Feminismus: Eine leider immer noch lange nicht überflüssige Bewegung für die
Gleichberechtigung, Sichtbarmachung, Befreiung und Anerkennung von Frauen und gegen
geschlechterbedingte Binarität, Zuschreibungen, Konnotationen und Rollenzwänge.
Feminismus muss im Zuge der Gleichberechtigung immer auch im Zusammenhang mit
Ethnizität, Sexualität, Herkunft und Klasse gedacht werden.
Flucht: Menschliche Flucht ist eine Art von Migrationsbewegung. Flucht beschreibt das
aufgrund von unzumutbaren Umständen, wie existentiellen Gefahren und Bedrohungen,
notgedrungene Verlassen eines Ortes und folglich oft unerlaubtes Eindringen in andere
Länder.
Genfer Flüchtlingskonvention: Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde im Juli 1951
verabschiedet. Sie wurde als internationales Abkommen über die Rechte und den Schutz
Geflüchteter weltweit ins Leben gerufen, um eine Wiederholung der Zurückweisung von
unzähligen zur Flucht gezwungenen Menschen an der Schweizer Grenze während des Zweiten
Weltkriegs zu vermeiden. Besonders seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 wird die
Genfer Konvention oft in Frage gestellt und leider halten sich kaum mehr Länder an sie. Auch
die Europäische Union verletzt den völkerrechtlichen Vertrag und weist Schutzsuchende an
ihren Grenzen zurück oder teilt die Obhut der geflüchteten Personen nicht gerecht unter den
Ländern auf, sodass zum Beispiel überfüllte, unhygienische und menschenrechtswidrige
Flüchtlingslager, wie Moria (Griechenland) in südlichen Ländern Europas entstehen. Weiters
zahlt die EU enorme Summen von Geld an Drittstaaten, wie die Türkei oder Weißrussland,
damit diese keine Flüchtlinge von dort aus über die Grenzen lassen und macht sich damit von
demokratisch und menschenrechtlich mehr als fragwürdigen Regierungsoberhäuptern, wie
Erdoğan und Lukaschenka, erpressbar.
18Hazara: Die Hazaras sind stark diskriminierte und verfolgte Ethnie in Afghanistan. Als Vorwand
dafür gilt die ursprünglich schiitisch-islamische Religionsausrichtung der Hazaras im
mehrheitlich sunnitisch-islamischen Afghanistan. 1998 wurden etwa in Mazar-e Sharif
innerhalb weniger Tage über 8000 Hazaras ermordet. Morde an Hazaras finden bis zum
heutigen Tag kein Ende. Geflüchtete Hazaras sprechen oft von Genozid. In den westlichen
Medien wird diese menschenrechtliche Tragödie nicht behandelt.
Kalaschnikow: Kalaschnikows sind automatische Schusswaffen aus einer sowjetisch-
russischen Sturm- und Maschinengewehrreihe. Sie gelten als besonders billige, aber effektive
Waffe und sind deswegen in ökonomisch ärmeren Ländern eine beliebte Kriegsmaschine.
Paschtunen: Paschtunen sind ein iranisches Volk in Süd- und Zentralasien. Der Großteil der
Paschtunen lebt in Pakistan, direkt gefolgt von Afghanistan, wo sie um die 42% der
Bevölkerung ausmachen. Viele Paschtunen leben nach wie vor traditionell in streng religiösen
Stämmen zusammen.
Persien: Das Persische Reich war ein über Jahrhunderte herrschendes antikes Großreich, dass
von vielen im heutigen Iran angesiedelt wird. Tatsächlich erstreckte es sich aber lange Zeit
über weit größere Teile Asiens, Afrikas und Europas, zu Hochzeiten sogar vom Balkan bis nach
Nordwestindien und Ägypten.
Radikalismus: Radikalität ist eine politische, religiöse, kurzum gesellschaftliche Einstellung, die
zum Ziel hat, die gesamte gesellschaftliche Ordnung komplett aufzulösen, zu ersetzen
und/oder umzukrempeln, koste es, was es wolle.
Sayyid/Sayed/Sadat: Sayyed ist der im Namen einer Person angeführte Titel der direkten
Nachkommen des islamischen Propheten Mohammeds. Zum Beweis des Titelanspruchs wird
angeblich Stammbaum über die Abstammung geführt. Es kursieren aber auch Gerüchte
darüber, dass einflussreiche Leute ihren Titel in unruhigen Zeiten immer wieder käuflich oder
durch Beziehungen und Machtspielchen erworben haben.
Scharia: Die Scharia kommt als Wort nur ein einziges Mal im Koran vor und wird dort als langer
Wüstenpfad beschrieben. Sie wird allerdings von extremistischen Islamisten als göttliche
Gegebenheit ausgelegt. Die Scharia steht dabei für eine göttliche Norm, an deren strenge und
menschenunwürdige Konventionen sich alle zu halten haben und deren Regelbrüche harte
Strafen, wie beispielsweise Folter durch Verstümmelung und Hinrichtung durch Steinigung,
nach sich ziehen.
Staatenlosigkeit: Gemäß des Staatenlosenübereinkommens der Vereinten Nationen ist ein:e
Staatenlose:r „eine Person, die kein Staat auf Grund seiner Gesetzgebung als seinen
Angehörigen betrachtet.“. Sie hat also keine Staatsbürgerschaft, wird von keinem Staat
geschützt, hat kein Recht zu wählen, zu reisen, zu arbeiten oder auf Versicherung (z.B.
Krankenversicherung), Sozialleistungen und so weiter. Zur Staatenlosigkeit kann etwa
Ausschluss, Verbannung und Staatsauflösung führen. Laut der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 hat jeder Mensch das Recht auf Staatszugehörigkeit.
19Subsidiärer Schutz: Subsidiärer Schutz gilt für Personen, deren Asylantrag abgewiesen wurde,
aber deren Leben im Herkunftsland bedroht wird und die aufgrund der Drohung von zum
Beispiel Folter und Todesstrafe nicht in dieses zurückgeschickt werden können. Subsidiär
Geschützte haben ein Recht auf Aufenthalt, Arbeit und gegebenenfalls einen Fremdenpass.
Taliban: Die Taliban sind eine radikal islamistische Terrorgruppe, die sich unter strengem und
menschenrechtswidrigem Reglement für die Scharia ausspricht. Betroffen sind vor allem
Frauen, queere Personen und andere Minderheiten, sowie Aktivist:innen und
Systemkritiker:innen.
Terrorismus: Terrorismus ist das Ausüben und Verbreiten von Terror ohne Rücksicht auf
Verluste, – also von Anschlägen, Entführungen, Drohungen, Mord, Folter, um nur einige
Beispiel zu nennen – um religiöse, politische oder ideologische Ideen umzusetzen.
Trauma: Trauma bedeutet wortwörtlich übersetzt Erschütterung. Psychische Traumata
werden durch lebensbedrohliche Ereignisse (es kann das eigene, als auch das Leben anderer
nahestehender Personen gemeint sein), wie Gewalt, Krieg, Katastrophen und Unfälle
ausgelöst und bleiben, wenn auch häufig unter- und unbewusst, lange wirksam.
203. IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG
Mindmap Männlichkeit
Heimat Freiheit
Hoffnung
Tradition Lebensentwurf
Familie Zukunft Selbstwertgefühl
Religion, Islam Vertrauen Kommunikation
Stolz Träume Dazugehörigkeit
Utopie Aufbruch
Sprache ↔ Fantasie Scheitern
Fremdsprache Sicherheit Verantwortung
Deutsch, Arabisch,
Loslösen
Farsi, Englisch
- von Strukturen
Veränderung - von Erwartungen
Hüllen Männlichkeit - von Rollenbildern
einhüllen - von Vorurteilen
(Hüllen) fallen lassen
Rassismus
Krieg Liebe
Auch Ausgrenzung
untereinander und Sehnsucht
Unterdrückung
gegenüber anderen Hingabe
Flucht
(migrantischen Gefühle
Verlust
Jugendlichen) Intimität
Realität
Angst Gesellschaft Beziehung
Gewalt Diskriminierung Freundschaft
Zensur und Repression Vorurteile
Sexualität
in Schubladen stecken und
Homosexualität
gesteckt werden
Konfrontation
- miteinander
- mit der eigenen Realität
21Erstellen Sie mit den Jugendlichen eine Mindmap, ähnlich zu dieser hier beispielhaft
eingefügten, die im Zuge der Workshops mit den geflüchteten Jugendlichen erarbeitet wurde.
Im Mittelpunkt sollte der Begriff „Männlichkeit“ stehen. Finden Sie mit den Schüler:innen
weitere Zweige, aus denen das Männlichkeitsbild resultiert, die sich wiederum unterteilen
lassen. Möglichkeiten sind zum Beispiel „Tradition“, „Medien“, „Feminismus“ und „Herkunft“
oder auch die Überbegriffe, die in der Beispiel-Mindmap eingezeichnet sind. Auch diese
Zweige lassen sich wieder in einzelne Stichworte unterteilen. Schreiben Sie den Begriff nach
Möglichkeit an die Tafel, das Whiteboard oder ein Plakat und lassen die Schüler:innen
eigenständig Begriffe hinzufügen.
Gerät die Übung ins Stocken, weil ihren Schüler:innen zum Beispiel spontan nichts einfällt oder
sie nicht ins Sprechen kommen, stellen Sie Fragen aus dem unten angeführten Fragenkatalog
als Hilfestellung.
Diskutieren Sie anschließend in der Gruppe, was Sie gemeinschaftlich geschrieben haben.
Schaffen Sie während der Diskussion unbedingt einen wertfreien Raum und kümmern Sie sich
um einen wertschätzenden Umgang miteinander. Gibt es Unklarheiten? Unterscheiden sich
die Männlichkeitsbilder mancher Schüler:innen und woran könnte das liegen? Woher
kommen diese Vorstellungen über das Mann-Sein überhaupt und wie lassen sie sich
(gemeinsam) aufbrechen?
Stellen Sie am Ende die Frage, ob sich die Jugendlichen Veränderungen in diesem Rollenbild
wünschen und welche Veränderungen das wären.
Die Mindmap ist mit jeglichen anderen gesellschaftlich konstruierten Rollenbildern
austauschbar. Beispiele: „Weiblichkeit“, „Jugendliche“, „Geflüchtete“.
22Sie können auch lesen