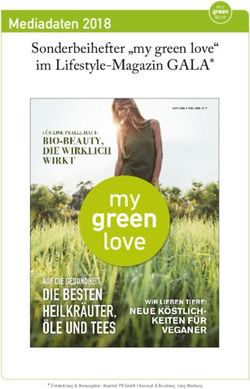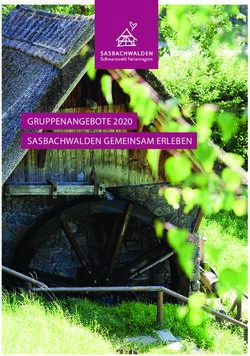ÖKOPLAN - Faunistische Potenzialansprache für den Bereich der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich dem Bebauungsplan Nr. 64
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Faunistische Potenzialansprache
für den Bereich der 12. Änderung des
Flächennutzungsplanes einschließlich
dem Bebauungsplan Nr. 64
„Nördlich Neuland“
Gemeinde Bösel
Auftraggeber:
Gemeinde Bösel
Lutz im September 2020
Tel.: 04494 / 921119
ÖKOPLAN Diplom-Biologe 26219 Bösel/Lutz
Johannes-Georg Fels An der Vehne 1
Fax: 04494 / 921118
oekoplan@ewe.netFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“
Inhaltsverzeichnis
1 Anlass und Aufgabenstellung ........................................................................................ 1
2 Untersuchungsraum / Untersuchungsmethode .............................................................. 1
3 Ergebnisse .................................................................................................................... 2
4 Bewertung ..................................................................................................................... 5
5 Zusammenfassung ........................................................................................................ 6
6 Literatur ......................................................................................................................... 7
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 1
1 Anlass und Aufgabenstellung
Die Gemeinde Bösel (Landkreis Cloppenburg) beabsichtigt im Bereich der 12. Änderung des
Flächennutzungsplanes die Ausweisung von Wohnbauflächen im Nordosten der Ortschaft Bö-
sel. Für den nördlichen Teilbereich ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Nördlich
Neuland“ vorgesehen, für die südlichen Teilflächen ist ein Bebauungsplan in Vorbereitung. Auf
der Grundlage des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind im Rahmen dieses
Planungsvorhabens die Umwelt- und Naturschutzbelange und hier insbesondere die arten-
schutzrechtlichen Aspekte der im Plangeltungsbereich vorkommenden Brutvögel darzustellen
und zu überprüfen. Eine Vielzahl der einheimischen Vogelarten wird in Anlage 1 Spalte 3 zu §
1 Satz 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) bzw. in dem Anhang A der EG-Arten-
schutzverordnung (VO(EG) Nr. 338/97) geführt. Damit zählen sie nach § 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG zu den streng geschützten Tierarten. Alle übrigen europäischen Vogelarten gelten
nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als besonders geschützt.
Je nach Alter, Strukturierung und Nutzung können sich in den unterschiedlichsten Biotopen
für Brutvögel Fortpflanzungshabitate bzw. Lebensstätten entwickeln, die im Fall einer Über-
planung artenschutzrechtlich zu berücksichtigen sind. Für das vorliegende Planungsvorhaben
war nicht grundsätzlich von vornherein auszuschließen, dass die Planfläche eine wichtige
Funktion für die Fauna und damit für den Naturhaushalt aufweist. Im Rahmen dieses Fachbei-
trages wird die von dem Vorhaben betroffene Fläche als Lebensraum für Brutvögel dargestellt.
Auf deren Grundlage ist es möglich, die Eingriffsfolgen nach § 1a BauGB als auch die zu
erwartenden artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu prognostizieren und
nach naturschutzfachlichen Kriterien zu beurteilen.
2 Untersuchungsraum / Untersuchungsmethode
Der Plangeltungsbereich befindet sich nordöstlich der Ortslage von Bösel. Das von Ackerflä-
chen, aktuell mit Anbau von Mais, Getreide und Zucker-Rüben, geprägte Gebiet liegt beidseitig
der Straße Neuland und wird im Westen von der Fladderburger Straße und im Osten von der
Schäferstraße begrenzt. Im Süden schließen sich die Siedlungsbereiche an der Drosselstraße
an, nach Norden setzen sich die Ackerflächen in den dort großräumig offenen Landschafts-
raum fort. Die Straßen werden teils von Gehölzreihen begleitet: Auf der Nordseite der Straße
Neuland verläuft eine lückige Strauch-Baumhecke aus vorwiegend Zitterpappeln, Weiden und
Brombeeren. An deren Südseite befindet sich auf einer Teilstrecke ebenfalls eine Feldhecke
und es sind einige Stieleichen mit starkem Baumholz vorhanden, die im Kreuzungsbereich mit
der Fladderburger Straße Stammdurchmesser bis zu ca. 1,0 m erreichen. In diesem Bereich
liegt zudem ein Wohnhaus mit Hausgarten. Entlang der Fladderburger Straße verläuft im nörd-
lichen Abschnitt eine Strauchhecke aus Weiden und Brombeeren, die sich nach Nordosten als
Feldhecke mit alten Stieleichen und Schwarzerlen fortsetzt, im Süden stehen einige Einzel-
bäume am Straßenrand. An der Schäferstraße befindet sich ein Einzelhaus, in dem Hausgar-
ten sind ebenfalls Einzelbäume vorhanden. Zu den Biotopstrukturen des Betrachtungsraumes
zählen darüber hinaus Ruderalfluren unterschiedlicher Ausprägung, die insbesondere als
Saumstrukturen die Straßen begleiten oder entlang der Flurstücksgrenzen verlaufen, an der
Fladderburger Straße hat sich auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerfläche eine
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 2
flächige Ruderalflur entwickelt. In der unmittelbaren Umgebung im Westen und Osten befinden
sich neben Siedlungsbereichen teilweise Altbaumbestände.
Für den Nachweis von Brutvögeln wurde anstelle einer herkömmlichen Bestandsaufnahme
eine Potenzialansprache der Fauna auf der Basis eines worst-case-Szenarios durchgeführt,
welche die Besonderheiten des Planungsraumes und die artspezifischen Habitat Ansprüche
der dort potenziell vorkommenden Arten berücksichtigt. Dieses Verfahren geht von der An-
nahme aus, dass in einem Gebiet bestimmte Tierarten vorkommen, wenn deren Habitat Be-
dingungen erfüllt sind, was sich über die Arealgröße, die Zahl der Lebensraumtypen sowie die
Strukturierung der Habitate, die Entfernung zu benachbarten Lebensraumkomplexen und den
damit für Tiere zur Verfügung stehenden Besiedlungsmöglichkeiten ermitteln lässt. Für be-
stimmte Brutvogelarten können - neben den erwähnten Faktoren - die Gehölzartenzusammen-
setzung sowie die strukturell unterschiedlichen Entwicklungsphasen von Gehölzen bei der Be-
siedlung eines Lebensraumes von Bedeutung sein.
Am 26.06.2020 (nördlicher Teilbereich) und 09.09.2020 (südlicher Teilbereich) wurden der
Planungsraum sowie die unmittelbar angrenzenden Habitate begangen und aus einer Kombi-
nation von Revierkartierung und Potenzialansprache auf das Vorkommen von Brutvögeln hin
kontrolliert. Im Verlauf dieser Begehungen wurden sämtliche im Betrachtungsraum vorhande-
nen Biotope (Ackerflächen, Gehölze, Siedlungsbiotope usw.) zum Vorkommen von Brutvögeln
untersucht und in Hinsicht auf ihre Eignung als potenzielle Lebensräume für Brutvögel ange-
sprochen und bewertet.
3 Ergebnisse
Von den 248 aktuell in Deutschland vorkommenden Brutvogelarten (exkl. Vermehrungsgäste,
Neozoen oder ehemalige Brutvögel, vgl. GEDEON et al. 2014) wurden im erweiterten Untersu-
chungsgebiet (Plangeltungsbereich zzgl. unmittelbar angrenzende Habitate) zusammen 32
Brutvogelarten zzgl. dem Jagdfasan (Phasanius colchicus) als Neozoon nachgewiesen bzw.
für diesen Standort als potenzielle Brutvögel deklariert (Tabelle 1). 26 dieser 32 Vogelarten
ließen sich dem Bereich der 12. FNP-Änderung einschließlich des Bebauungsplanes Nr. 64
zuordnen; die übrigen sechs Spezies sind solche, die ausschließlich in der näheren Umgebung
brüten. Das gesamte Artenspektrum entspricht 16,2 % der rezenten Brutvogelfauna Nieder-
sachsens und des Landes Bremen (N = 198; vgl. KRÜGER & NIPKOW 2015). Dass sämtliche 32
Brutvogelarten dem festen Artenbestand des Landkreises Cloppenburg angehören, ist in An-
betracht der in den letzten ca. zehn Jahren zahlreich durchgeführten ornithologischen Be-
standsaufnahmen des Verf. per se zweifelsfrei. Die 26 Arten des Plangebietes treten als Brut-
vögel auch in der näheren Umgebung des Untersuchungsstandortes auf. Neben den 32 Brut-
vogelarten wurde im Rahmen der Ortsbegehungen mit der Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
eine Art ausschließlich als Nahrungsgast im Plangebiet und in dessen Nähe nachgewiesen.
In Tabelle 1 sind die Brutvögel des Untersuchungsgebietes unter Angabe ihrer Häufigkeit, Ge-
fährdung und Schutzstatus aufgelistet. Insgesamt kommen drei Nicht-Singvogelspezies (Non-
passeres) (hier: Buntspecht, Kiebitz und Ringeltaube) und 29 Singvogelarten (Passeres)
vor. Dieses Verhältnis, wonach die Singvögel gegenüber den Nicht-Singvögeln deutlich über-
wiegen, ist nicht ungewöhnlich angesichts der Tatsache, dass die Passeriformes 66 % aller
rezenten Landvögel stellen (BEZZEL 1982) und eine Vielzahl der Nonpasseriformes auf große
störungsarme Lebensräume angewiesen ist.
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 3
Tabelle 1: Liste der im Jahr 2020 im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung nachgewiese-
nen und der potenziell vorkommenden Brutvögel.
Bedeutung der Abkürzungen: ● = für den 26.06.2020 bzw. 09.09.2020 vorliegende Nachweise, O = potenzielle
Kolonisten; Nistweise: a = Bodenbrüter, b = Baum-/Gebüschbrüter, G = Gebäudebrüter; RL T-W bzw. RL Nds.:
Rote Liste der in der Naturräumlichen Region Tiefland-West bzw. der in Niedersachsen u. Bremen gefährdeten
Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 2015); RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015); Ge-
fährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, / = nicht gefährdet; Schutzstatus: § =
besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr.
14 BNatSchG,s. Text.
BRUTVÖGEL Plan- nähere Nist- RL RL RL Schutz-
[AVES] gebiet Umgebung weise T-W Nds. D status
Kiebitz, Vanellus vanellus O a 3 3 2 §§
Ringeltaube, Columba palumbus ● ● b / / / §
Buntspecht, Dendrocopos major ● O b / / / §
Blaumeise, Cyanistes caeruleus ● O b / / / §
Kohlmeise, Parus major O ● b / / / §
Feldlerche, Alauda arvensis O a 3 3 3 §
Zilpzalp, Phylloscopus collybita ● ● a / / / §
Gelbspötter, Hippolais icterina O b V V / §
Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla ● ● b / / / §
Gartengrasmücke, Sylvia borin ● ● b V V / §
Klappergrasmücke, Sylvia curruca O b / / / §
Dorngrasmücke, Sylvia communis ● ● a / / / §
Kleiber, Sitta europaea ● O b / / / §
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla O ● b / / / §
Zaunkönig, Troglodytes troglodytes ● O a / / / §
Star, Sturnus vulgaris O O b 3 3 3 §
Misteldrossel, Turdus viscivorus O b / / / §
Amsel, Turdus merula ● ● b / / / §
Singdrossel, Turdus philomelos O ● b / / / §
Rotkehlchen, Erithacus rubecula ● ● b / / / §
Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros O ● G / / / §
Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenic. O O b V V V §
Heckenbraunelle, Prunella modularis O ● b / / / §
Haussperling, Passer domesticus O ● G V V V §
Feldsperling, Passer montanus O O b V V V §
Bachstelze, Motacilla alba O ● a / / / §
Schafstelze, Motacilla flava O O a / / / §
Buchfink, Fringilla coelebs ● ● b / / / §
Grünfink, Chloris chloris O b / / / §
Stieglitz, Carduelis carduelis O O b V V / §
Bluthänfling, Linaria cannabina ● O a 3 3 3 §
Goldammer, Emberiza citrinella O O a V V V §
∑ 32 spp. 26 32
Das im Untersuchungsgebiet ermittelte Vogelartenspektrum setzt sich zu einem großen Teil
aus Lebensraumgeneralisten zusammen; diese weisen in der Besiedlung der verschiedenen
Habitate eine große ökologische Valenz auf. In der Mehrzahl sind dies Vertreter für geschlos-
sene Biotope, zu denen Singvögel aus verschiedenen Vogelfamilien gehören. Siedlungs-
schwerpunkte dieser Arten, wie z. B. Amsel, Buchfink, Ringeltaube, Zilpzalp und andere, sind
die Gehölze des Plangebietes und in dessen Umgebung, zu denen neben Feldhecken auch
Siedlungsgehölze und Altbaumbestände gehören.
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 4
Stenotope Brutvögel sind neben einigen Gebäudebewohnern (Hausrotschwanz, Haussper-
ling) in erster Linie Gehölzbrüter wie Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz
und Kleiber. Weiterhin sind mit z. B. Bluthänfling, Dorngrasmücke und Goldammer Charakter-
arten halboffener Lebensräume vertreten und mit Feldlerche, Kiebitz und Schafstelze zählen
typische Vertreter landwirtschaftlicher Nutzflächen zu den potenziellen Brutvögeln des erwei-
terten Untersuchungsstandortes.
Bei näherer Betrachtung der Artenzusammensetzung zeigt sich, dass im Planungsraum na-
hezu ausnahmslos Gehölzbrüter vorkommen. Auch die Mehrzahl der wenigen für diesen
Standort als Bodenbrüter deklarierten Spezies legt die Nester i. d. R. in geringer Höhe über
dem Erdboden in Stauden oder kleinen Sträuchern an; sie zählen daher überwiegend zu den
Bewohnern der Randstrukturen der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Demgegenüber sind mit
Ausnahme der Schafstelze auf den Ackerflächen des Plangebietes keine Brutvögel zu erwar-
ten. Die beiden weiteren potenziellen Besiedler der Offenländer (Feldlerche, Kiebitz) halten
einerseits zu vertikalen Strukturen, wie z. B. die Gehölzreihen, und andererseits zu den Sied-
lungsflächen und den Straßen aufgrund von Störungswirkungen (z. B. Anwesenheit von Per-
sonen, Fahrzeugverkehr, Fußgänger mit Hunden) artspezifische Abstände bei der Besetzung
ihrer Reviere ein (vgl. BAUER et al. 2005, GASSNER et al. 2010, NIEDERSÄCHSISCHER LANDES-
BETREIB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ 2011). Aufgrund dieser Verhal-
tensweisen sind die Reviere dieser beiden gefährdeten Offenlandbrüter ausschließlich auf den
Ackerflächen der näheren nördlichen Umgebung und damit außerhalb des Plangebietes zu
erwarten. Gleichwohl können beide Arten in dem von dem geplanten Bauvorhaben ausgehen-
den Störradius brüten und daher bei Realisierung des Vorhabens beeinträchtigt werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl an Brutvögeln den Untersuchungsraum mit je-
weils nur wenigen Brutpaaren oder gar mit Einzelpaaren besiedelt. Das Auftreten mittlerer oder
sogar großer Populationen ist kaum wahrscheinlich, fehlen hierfür die für eine Ansiedlung not-
wendigen Strukturen in entsprechender Größe und Struktur. Unter Berücksichtigung dessen
dürften die insgesamt 32 Brutvogelarten - mit Rücksicht auf die im Gebiet vorherrschenden
Requisiten sowie der begrenzten Flächengröße des Plangebietes - als selten bis mäßig häufig
gelten; großräumig betrachtet sind sie jedoch überwiegend keineswegs selten und daher auch
im Kreis Cloppenburg weit verbreitet.
Die nistökologische Einteilung der 32 Brutvogelarten ergibt für die am bzw. in geringer Höhe
über dem Erdboden nistenden Arten einen Anteil von 28,1 % (N = 9) und für die in höheren
Straten siedelnden Arten einen Anteil von 65,6 % (N = 21), zwei Arten (6,3 %) sind Gebäude-
brüter. Diese Verteilung, wonach die Zahl der Gehölzbrüter mehr als doppelt so hoch liegt wie
die der Bodenbrüter, spiegelt die Konzentration der Brutvögel in den Gehölzbiotopen wider.
Ähnlich wie bei den Pflanzengesellschaften finden sich auch unter den Vögeln bei vergleich-
baren Lebensbedingungen in der Natur an verschiedenen Orten annähernd die gleichen Arten
zusammen. Von PASSARGE (1991) wurden derartige Vogelgemeinschaften (Avizönosen) für
den mitteleuropäischen Raum beschrieben. In den von Gehölzen geprägten Bereichen des
Untersuchungsraumes ist die Verbreitung der Mönchsgrasmücke-Zilpzalp-Gemeinschaft
(Sylvio-Phylloscopet um collybitae ) wahrscheinlich. Bestandsbildner dieser Gemein-
schaft sind insbesondere Finken, Mönchsgrasmücke und Zilpzalp sowie Höhlenbrüter (Blau-
meise, Kohlmeise) neben verschiedenen Ubiquisten wie Amsel und Buchfink. Diese Brutvo-
gelgemeinschaft ist im Norddeutschen Tiefland allgemein häufig und verbreitet. In Anbetracht
der geringen Besiedlung der Offenlandbiotope mit charakteristischen Vogelarten ist für die
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 5
Ackerflächen keine Brutvogelgemeinschaft zu benennen. Dies trifft gleichermaßen auf die
Siedlungsbiotope zu.
Sämtliche im Gebiet vorgefundenen Vogelarten sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) bzw. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) (Stand: 2009) besonders ge-
schützte Tierarten. Danach fallen auch weit verbreitete und nicht gefährdete Arten, wie bei-
spielsweise Amsel, Buchfink oder Kohlmeise, unter diesen Status. Mit dem Kiebitz zählt eine
nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Vogelart zu den potenziellen Kolonisten.
In dem Untersuchungsraum sind mit Bluthänfling, Feldlerche, Kiebitz und Star vier landesweit
gefährdete Brutvogelarten zu erwarten (KRÜGER & NIPKOW 2015). Unter diesen ist der Star mit
bis zu vier Brutpaaren potenzieller Brutvogel der verschiedentlich vorhandenen Altbäume oder
der Zitterpappeln an der Straße Neuland, der Bluthänfling siedelt potenziell in den Saumstruk-
turen der landwirtschaftlichen Nutzflächen mit bis zu zwei Brutpaaren. Einzelpaare der beiden
übrigen gefährdeten Spezies Feldlerche und Kiebitz sind ausschließlich in der nördlichen Um-
gebung des Plangebietes zu erwarten. Mit Feld- und Haussperling, Gartengrasmücke, Gar-
tenrotschwanz, Gelbspötter, Goldammer und Stieglitz werden sieben Arten in der landeswei-
ten Vorwarnliste (= V) geführt, von denen die Gehölzbrüter des Planungsraumes mit jeweils
ein bis drei Brutpaaren zu den Bewohnern der Gehölzreihen und Einzelbäume zählen, der
Haussperling könnte das Wohnhaus an der Schäferstraße mit ca. zwei Brutpaaren besiedeln.
Die Arten der Vorwarnliste sind Brutvögel, die aktuell als (noch) nicht gefährdet gelten, deren
Bestände in den letzten Jahren jedoch merklich zurückgegangen sind; bei Fortbestehen be-
standsreduzierender Einwirkungen ist nach den o. a. Autoren in naher Zukunft eine Einstufung
in die Gefährdungskategorie 3 nicht auszuschließen. Bundesweit sind vier Arten (Feld- und
Haussperling, Gartenrotschwanz, Goldammer) als potenziell gefährdet eingestuft, während
Bluthänfling, Feldlerche und Star als gefährdet und der Kiebitz als stark gefährdet gelten (GRÜ-
NEBERG et. al. 2015).
4 Bewertung
Für die Dokumentation der Bedeutung von Vogelbrutgebieten wird in Niedersachsen üblicher-
weise ein vom Niedersächsischen Landesbetreib für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) entwickeltes Verfahren angewendet, das über den Gefährdungsgrad, die
Brutpaarzahlen und die Artenzahl die ornithologische Bedeutung einer Fläche anhand eines
differenzierten Punktsystems ermittelt (BEHM & KRÜGER 2013). Die Anwendung des Verfah-
rens ist nur für Gebiete mit einer Größe von mindestens 80 ha praktikabel, die Flächengröße
der Planfläche einschließlich des erweiterten Untersuchungsraumes beträgt jedoch nur einen
Bruchteil dieser Mindestgröße. Aus diesem Grund erfolgt eine verbal-argumentative Bewer-
tung des Untersuchungsgebietes als Vogelbrutgebiet auf der Basis der vorliegenden Be-
standsaufnahme.
Die im Untersuchungsraum siedelnden Arten sind mehrheitlich allgemein häufige und verbrei-
tete Spezies, darüber hinaus wird die Ornis von einigen stenotopen Brutvogelarten gebildet.
Insgesamt kommen vier landes- und bundesweit (stark) gefährdete sowie sieben auf Landes-
ebene potenziell gefährdete Vogelarten vor. Eine für landwirtschaftliche Nutzflächen typische
Watvogel- und / oder Wiesensingvogel-Zönose ist im Planungsraum nicht ausgebildet, allein
die Schafstelze ist hier zu erwarten; in der näheren Umgebung zählen Feldlerche und Kiebitz
zu den potenziellen Kolonisten. Die Mehrzahl der insgesamt 32 Brutvogelarten wird von
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 6
Gehölzbrütern gestellt, die insbesondere in den Gehölzen an den Straßen sowie in der nähe-
ren Umgebung siedeln. In Anbetracht des vorliegenden Besiedlungspotenzials sowie der ver-
hältnismäßig geringen Siedlungsdichte wird dem Untersuchungsraum eine allgemeine Be-
deutung als Vogelbrutgebiet und nicht etwa eine hohe, besonders hohe oder gar herausra-
gende Bedeutung zugeordnet.
5 Zusammenfassung
Im Rahmen der in dem Bereich der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich
des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 64 und in der näheren Umgebung durchge-
führten Potenzialansprache in Verbindung mit einer einmaligen Brutvogelbestandsaufnahme
wurden 32 Brutvogelarten ermittelt, von denen insgesamt 26 Arten dem Plangebiet zuzuord-
nen waren. Das im erweiterten Untersuchungsgebiet ermittelte Vogelartenspektrum setzt sich
zu einem überwiegenden Teil aus Lebensraumgeneralisten und zu einem geringeren Anteil
aus stenotopen Brutvogelarten zusammen. Siedlungsschwerpunkte dieser Arten sind die Ge-
hölze, zu denen die Gehölzreihen entlang der Straßen sowie die Siedlungsgehölze und Alt-
baumbestände gehören. Die Offenlandbiotope sind von Brutvögeln nur spärlich besiedelt.
Dem erweiterten Untersuchungsraum wird in Anbetracht des vorhandenen Besiedlungspoten-
zials eine allgemeine Bedeutung als Vogelbrutgebiet zugeordnet.
ÖKOPLAN, im September 2020
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIEFaunistische Potenzialansprache zur 12. Änderung des FNP inkl. Bebauungsplan Nr. 64 „Nördlich Neuland“ 7
6 Literatur
BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles
über Biologie, Gefährdung und Schutz. Bd. 1 (Nonpasseriformes - Nicht-Sperlingsvögel)
und Bd. 2 (Passeriformes - Sperlingsvögel). - Aula-V., Wiebelsheim.
BEHM & KRÜGER (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. -
Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33: 55-69.
BEZZEL, E. (1982): Vögel in der Kulturlandschaft. - Ulmer-V., Stuttgart.
GASSNER, E., A. WINKELBRANDT & D. BERNOTAT (2010): UVP und Strategische Umweltprüfung
– Rechtliche und fachliche Anleitung für die Umweltprüfung, 5. Auflage. - Müller-V., Hei-
delberg.
GEDEON K., C. GRÜNBERG, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S.
FRICK, I. GEIERSBERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜ-
BING, S. R. SUDMANN,, R. STEFFENS, F. VÖKLER & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brut-
vogelarten. Atlas of German Breeding Birds.- Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und
Dachverband Deutscher Avifaunisten - Münster.
GRÜNEBERG, C. & H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2015): Rote
Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. - Ber. Vogelschutz
52: 19-67.
KRÜGER, T. & M. NIPKOW (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten
Brutvögel. 8. Fassung, Stand 2015. - Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 35: 181-260.
NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ
(2011): Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen. - https://www.nlwkn.nieder-
sachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-
lebensraumtypen-46103.html
PASSARGE, H. (1991): Avizönosen in Mitteleuropa. - Ber. Bayrische Akademie Naturschutz
Landschaftspfl. Beih. 8: 1-128.
SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUD-
FELDT (eds.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. -
Radolfzell.
ÖKOPLAN PLANUNGSBÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLGIESie können auch lesen