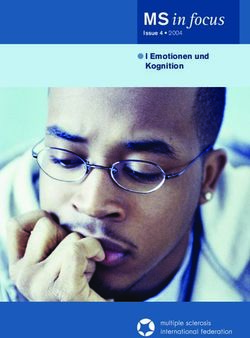Lassen Hochschulen sich steuern?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Heiner Minssen, Uwe Wilkesmann In: Soziale Welt, 54. Jg., 2003, Heft 2, S. 123-144 Lassen Hochschulen sich steuern? 1. Einleitung Weder unter Wissenschaftlern noch unter Hochschulmanagern wird jemand die These vertreten, dass die Politik die Hochschulen direkt steuern kann. Dennoch ist in den letzten Jahren der Ruf in der Politik immer lauter geworden, der einen Verwendungsnachweis des Geldes für die Wissenschaft fordert. Immerhin ist es legitim, dass der Geldgeber wis- sen will, ob sein Geld auch effizient eingesetzt wird - insbesondere bei leeren öffentlichen Kassen. Zwar zieht sich der Staat zunehmend von einer detailgenauen Steuerung durch Haushaltsvorgaben, gesetzliche Vorschriften und Genehmigungsvorbehalte für Berufun- gen, für Studiengänge und für Prüfungsordnungen zurück. Doch zugleich werden aus dem industriellen Sektor bekannte Steuerungsmechanismen und Managementstrategien zu- nehmend auch hochschulintern erprobt und angewandt, um die Leistungserstellung trotz knapper finanzieller Ressourcen zu gewährleisten1. Marktökonomische Prinzipien gewin- nen immer mehr an Bedeutung. Damit verbunden rücken betriebswirtschaftliche Schlag- worte wie Effizienz, Kundenorientierung, Leistungsbewertung und -belohnung etc. in den Vordergrund und drängen Kriterien wie Hochschulbildung als öffentliches Gut bzw. öf- fentliche Aufgabe in den Hintergrund2. Wir werden deshalb in diesem Aufsatz der Frage nachgehen, ob es die Möglichkeit einer indirekten Form der Steuerung, einer Kon- textsteuerung von Hochschulen gibt. Nach einer theoretischen Diskussion der Kon- textsteuerung von Hochschulen werden wir unsere Überlegungen mit empirischen Daten unterfüttern. Der Versuch einer Kontextsteuerung von Hochschulen besteht u.a. in der Einführung ei- ner indikatorisierten Finanzmittelzuweisung in der Titelgruppe für Forschung und Lehre. Dabei geht es im Grundsatz darum, die Leistungskriterien festzulegen, „bei denen es sich 1 Diese Entwicklung ist analog zu den neuen Steuerungsmodellen in der öffentlichen Verwaltung (vgl. Wilkesmann 2000). 2 Wir verkennen nicht, dass auch gegenläufige Entwicklungen zu beobachten sind. In der Evaluation von außeruniversitären Forschungsinstituten etwa werden oftmals Kriterien „guter“ Wissenschaft in An- schlag gebracht, obwohl gerade diese Institute sich aufgrund ihrer hohen Drittmittelabhängigkeit am
um besonders wünschenswerte Resultate der Anstrengungen von Hochschulen handelt“
(Weiler 2001, S. 53). Derartige Bemühungen, die auf der Vermutung beruhen, auch im
Wissenschaftsbereich mit Geld Verhalten beeinflussen zu können, lassen sich in allen
Bundesländern beobachten, wenngleich die Ausgestaltung der Zuweisungsmodi sich un-
terscheidet im Hinblick auf die Einführungszeiträume sowie im Hinblick auf die Finanz-
volumina und die ausgewählten Parameter, nach denen die Sachmittel für Forschung und
Lehre an den Hochschulen zugewiesen werden (vgl. Hochschul-Informations-System
2001). In Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Wissenschaft und Forschung
(MSWF) im Jahr 1993 damit begonnen, die Finanzmittel für Lehre und Forschung, also
Mittel der Titelgruppe 94 (TG 94), mittels einer sogenannten formelgebundenen Finanz-
zuweisung an die Hochschulen zu verteilen. Verteilungskriterium war zunächst die Ab-
solventenanzahl; später kamen die Kriterien „Drittmittel“ und „Promotionen“ und
schließlich die Parameter „Stellen des wissenschaftlichen Personals“ und „Studierende
des ersten bis vierten Semesters“ hinzu3. Zudem wird innerhalb der Parameter nach den
Fächergruppen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie
Naturwissenschaften gewichtet4. Erklärtes Ziel war die Beschränkung auf möglichst we-
nige Parameter, um die Formel transparent zu halten, was einerseits den Charme der For-
mel ausmacht, was zugleich aber auch Kritik auf sich gezogen hat, da mit den Kriterien
gewissermaßen per Dekret festgelegt ist, was „gute“ Wissenschaft auszeichnet (dazu
Hoffacker 2000), und zudem nicht-intendierte Effekte keineswegs ausgeschlossen sind:
die Anzahl der Promotionen kann schließlich auch durch die Absenkung der Anforderun-
gen erhöht werden5.
Wie die Hochschulen selbst auf diesen veränderten Modus der Mittelzuweisung reagier-
ten, ist ihnen überlassen worden; seitens des Ministeriums gab es keine diesbezüglichen
Anweisungen, wohl aber die Hoffnung, dass die Hochschulen auch intern zu einer Indika-
Markt beweisen müssen und deswegen immer schon stärker effizienzorientiert als Hochschulen gearbei-
tet haben.
3 Seit 2002 wird zudem eine Frauenquote, also der Anteil von Frauen am Personal, in die Berechnung ein-
bezogen; zum Zeitpunkt unserer Untersuchung spielte dieses Kriterium noch keine Rolle, so dass wir im
Folgenden darauf nicht weiter eingehen.
4 So „zählen“ beispielsweise Drittmittel in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften das Siebenfache
der Drittmittel in den Ingenieurwissenschaften, während das wissenschaftliche Personal in den Geistes-
und Gesellschaftswissenschaften mit dem Faktor 2 und in den Ingenieurwissenschaften mit dem Faktor
5 gewichtet wird (Andersen u. a. 2001, S. 19 f.).
5 Dies gilt in gewisser Weise auch für den Indikator „Drittmittel“: wer sich kriteriengerecht verhalten
will, wird tunlichst keine DFG-Projekte einwerben, die sich zwar durch ein hohes Renommee auszeich-
nen, finanziell aber (zumindest in den Sozialwissenschaften) keineswegs so lukrativ sind wie die Projek-
te anderer Förderer.
2torisierung der Mittelvergabe übergehen, um die gewünschten Verhaltensweisen bei den
Professoren, also denjenigen, die das Gut der Hochschule produzieren, zu verstärken.
Doch letztlich stand es den Hochschulen frei, auch für die interne Mittelvergabe einen In-
dikatorenschlüssel zu entwickeln oder die Mittel wie bisher zu verteilen.
Wir haben also den Versuch einer externen Steuerung der Hochschulen mittels Geld in
der Hoffnung auf die Erzeugung ausreichender Irritationen, die Auswirkung hat bis hin-
unter auf die leistungserstellenden Einheiten. Unsere im folgenden zu begründende und
mit empirischem Material zu belegende These ist nun, dass diese Form der Kontextsteue-
rung zwar Auswirkungen hat auf die zentrale Ebene von Hochschulen, die für die Güter-
erstellung entscheidenden dezentralen Einheiten, also die Professuren jedoch nicht er-
reicht, da Hochschulen Organisationen besonderen Typs sind, die weder durch Markt
noch Hierarchie, weder durch Geld noch Macht gesteuert werden können. Geld als Steue-
rungsmedium von Hochschulen erweist sich als weitgehend dysfunktional.
2. Kontextsteuerung von Hochschulen
Organisationen treffen Entscheidungen nach Maßgabe eigener Regeln und nicht in strik-
ter Abhängigkeit von den Anforderungen der Umwelt. Insofern gibt es keinen „one best
way“ der Effektivierung. Umwelt stellt für soziale Systeme ein „Rauschen“ dar, das erst
dann zu Reaktionen führt, wenn dieses Rauschen organisationsinterne Irritationen hervor-
ruft; es muss „auf die Entscheidungszusammenhänge des Systems bezogen werden“
(Luhmann 1988a, S. 173), bevor ein Sachverhalt von der Organisation als Entscheidungs-
problem thematisiert wird. Autopoietische Systeme reduzieren Umweltinformation, in-
dem sie die Information in ihren Kommunikationscode übersetzen. Dabei wählen sie die
Information selektiv aus und nur das, was in den jeweiligen Code übersetzt wird, ist in der
internen Kommunikation anschlussfähig, d. h. wird intern überhaupt wahrgenommen
(Luhmann 1988b, S. 328). Umwelt ist also keine fixe Größe, sondern Organisationen
„konstruieren“ ihre Umwelt (Klimecki u. a. 1994; Weick 1998; Baecker 1999).
Externe Steuerung von Organisationen generell und damit auch von Hochschulen kann
somit nicht als Intervention gedacht werden. „Externe“ Information muss an die basale
Selbstreferenz der Entscheidung anschlussfähig sein (bzw. gemacht werden). Dies unter-
stellt selbstverständlich keine Autarkie sozialer Systeme; alle Systeme existieren in einer
Umwelt, sind über „strukturelle Koppelungen“ systematisch mit einer Umwelt verbun-
3den; sie „beschränken den Bereich möglicher Strukturen, mit denen ein System seine Au-
topoiesis durchführen kann“ (Luhmann 1997, S. 100). Es handelt sich gewissermaßen um
eine Beziehung vorhersehbarer Irritationen. Strukturelle Koppelung bedeutet wechselsei-
tige Beeinflussung und Anpassung über systemimmanente Strukturveränderungen, d. h.
jedes Teilsystem „passt seine internen Strukturen den von anderen Teilsystemen erzeug-
ten Umweltereignissen immer wieder im Hinblick darauf an, die Geordnetheit der eige-
nen Operationen aufrecht zu halten“ (Schimank 1996, S. 191). Entscheidungen, bei-
spielsweise in der Politik, rufen Irritationen in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen
hervor, sofern diese mit dem politischen Funktionssystem strukturell gekoppelt sind.
„Strukturelle Kopplung“ meint also keineswegs „Fremdsteuerung“, denn auch wenn Ent-
scheidungen zu erwartbaren Irritationen in Fremdsystemen führen, müssen diese system-
relativ verarbeitet werden (Sydow/Windeler 2000, S. 7; Kneer 2001, S. 417).
Dies ist eine notwendige Einschränkung des früheren Steuerungsoptimismus. Während
klassische Steuerungskonzepte einen Dualismus von Staat und Gesellschaft unterstellten
und damit eine differenztheoretische Auffassung vertraten, orientieren sich neuere Kon-
zepte an einer integrationstheoretischen Perspektive (Kneer 2001, S. 422). Diese (und an-
dere) Überlegungen haben dazu geführt, dass dem Staat mittlerweile nur noch begrenzte
Steuerungsmöglichkeit zugesprochen werden (Lange/Braun 2000. S. 23). Statt dessen
wird betont, dass der Staat kein einheitlich strukturierter und handelnder Akteur ist, son-
dern sich aus arbeitsteiligen, spezialisierten und pluralistischen Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationen zusammensetzt. Die einzelnen Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationen treten zielspezifisch und in hohem Maße voneinander unabhängig mit den ge-
sellschaftlichen Bereichen ihrer Zuständigkeit in Kontakt, um über Bedarf, Vorbereitung,
Ausgestaltung und Implementation von policies zu verhandeln. Das politisch-
administrative Funktionssystem ist zudem ein System unter anderen, neben dem Systeme
wie Wissenschaft, Religion, Politik, Recht und Wirtschaft existieren; die hierarchische
Stellung und Steuerungsposition des Staates verliert an Bedeutung (Hödl/Zegelin 1999, S.
152).
Allerdings steht diese „Einschränkung“ - zumindest in der Version von Luhmann - in Ge-
fahr, Steuerung für gänzlich unmöglich zu halten. Doch durch die Unterstützung der rati-
onalen Reflexion sozialer Systeme, d. h. durch die Selbstthematisierung als Umwelt ande-
rer sozialer Systeme, lässt sich eine indirekte Form der Steuerung etablieren. Es können
Kontextbedingungen gesetzt werden, damit das zu steuernde System „selbst bei schädli-
4chen Folgen (‚negative Externalitäten’) [...] seine Optionen nach dem Gesichtspunkt
höchstmöglicher Umweltverträglichkeit und Kompatibilität auswählt“ (Willke 1995, S.
124). Diese Kontextsteuerung, also eine Steuerung durch Gestaltung der Kontextbedin-
gungen ist die komplexe Rekombination von autonomer Selbstorganisation gesellschaftli-
cher Funktionssysteme, die neben Indifferenz und desinteressierter Distanz auch eine
Vielfalt gegensätzlicher Logiken produzieren (Willke 1997, S. 88 ff.).
Nach Willke ist somit eine externe Steuerung möglich: „Eine kontextuelle Steuerung al-
lerdings ist auch von außen möglich, weil sie nicht in die interne Operationsweise ein-
greift, sondern Bedingungen setzt, an denen sich das zu steuernde System in seinen eige-
nen Selektionen orientieren kann und im gelingenden Fall im eigenen Interesse orientie-
ren wird“ (Willke 1997, S. 141, Hervorhebung im Original).
Willke unterscheidet grundsätzlich zwei Modi der Kontextsteuerung: direkte und dezen-
trale Kontextsteuerung (Teubner/Willke 1984). Direkte Kontextsteuerung operiert über
die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien Geld, Recht und Macht. In unse-
rem Fallbeispiel der indikatorisierten Mittelzuteilung bedient sich der Staat zwar weniger
dem Medium des Rechts, dafür jetzt stärker des Mediums Geld. In der öffentlichen Dis-
kussion besitzt das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium Geld einen hohen
Steuerungswert, soll es doch die angeblich „faulen Professoren“ aus ihrem Dornröschen-
schlaf wecken, indem sie u.a. nach der Anzahl der Studierenden, der abgenommen Prü-
fungen, der eingeworbenen Drittmittel etc. bezahlt werden. In dem von uns analysierten
Fall bezieht sich zwar die Zahlung nicht auf das individuelle Gehalt, sondern nur auf die
Sachmittel, die jeder Professur zur Verfügung stehen. Damit ist der absolute Betrag und
folglich die Steuerungsfunktion sehr viel geringer, dennoch ist schon auf einer logischen
Ebene deutlich, dass die Dysfunktionalitäten im Vordergrund stehen. Denn die Aufgaben
der Professoren lassen sich als multiple tasks beschreiben: Sie müssen nicht nur lehren
und Studierende im Examen betreuen, sondern auch Drittmittel einwerben, ihre For-
schungsergebnisse veröffentlichen, sich in der Selbstverwaltung engagieren etc. Wird nur
eine Handlung finanziell belohnt, so wird sich ein rationaler Akteur auf die Steigerung
des Outputs dieses Faktors konzentrieren und alle anderen vernachlässigen. Wir werden
weiter unten der empirischen Frage nachgehen, ob überhaupt ein handlungssteuernder Ef-
fekt bei den Professoren zu beobachten ist.
5Wenn die direkte Kontextsteuerung solche Probleme aufwirft, ist zu untersuchen, ob die
dezentrale Kontextsteuerung weiterhilft. Nach Willke findet die dezentrale Kontextsteue-
rung in Verhandlungssystemen statt: „Kontextsteuerungen können sich nur noch aus dem
Zusammenspiel autonomer und reflektierter Akteure in selbstorganisierten Verhandlungs-
systemen ergeben“ (Willke 1997, S. 142). Verhandlungssysteme dienen der Abstimmung
und der Koordination zwischen über- und untergeordneten Ebenen (vertikale Koordinati-
on). Anstatt Entscheidungen einfach hinnehmen zu müssen, erlauben Verhandlungssys-
teme den betroffenen Akteuren, im Vorfeld von Entscheidungen Kompromisse im diskur-
siven Prozess zu erwirken sowie die Entscheidungsfindung zu beeinflussen (Willke 1997,
S. 134 f.). Neben die vertikale Koordination tritt der Bedarf an Koordination zwischen
gleichrangigen und gleichgeordneten Systemen (horizontale Koordination), da die einzel-
nen Systeme in modernen Gesellschaften eine hohe Autonomie und Eigendynamik aus-
gebildet haben (Willke 1997, S. 136). Scharpf (1992) hat gezeigt, dass die Struktur des
Verhandlungssystems einen Einfluss darauf hat, welches Ergebnis erzielt werden kann.
Das Steuerungsmedium von Verhandlungssystemen ist die Überzeugung (Hödl/Zegelin
1999, S. 158). Die autonomen und reflektierten Akteure müssen neue basale Prozesse der
Selbstorganisation in ihren jeweiligen Organisationssystemen anstoßen. In dem von uns
untersuchten Beispiel war dies auch der Fall. Die Vertreter der Rektorate waren in dem
Aushandlungsprozess beteiligt, welche Parameter gewählt werden sollten. Innerhalb der
Hochschulen sind die einzelnen Fachbereiche an der Entwicklung eines hochschulinter-
nen Verteilungsschlüssels in der Regel beteiligt worden. Allerdings sind die Hochschulen
ein besonderer Organisationstyp. Da sie aus sehr lose gekoppelten teilautonomen Einhei-
ten besteht, sind auch interne Steuerungsmöglichkeiten begrenzt. Zwar kann das Ver-
handlungssystem der Einführung indikatorgesteuerter Sachmittelzuweisung auf der Zent-
ralebene der Hochschulen zu einer Überzeugungsänderung, d. h. zu einem Versuch der
Reorganisation auch der internen Steuerung führen, diese muss dann aber nicht auf der
Handlungsebene der Professoren wirksam werden – wie wir zeigen werden.
3. Die Hochschule – (k)eine Organisation wie jede andere?
Hochschulen entsprechen einem Typus von Organisation, der als „Profibürokratie“
(Mintzberg 1992) charakterisiert werden kann. Diese ist darauf ausgerichtet, Standards zu
internalisieren, um den Anforderungen der Klienten zu genügen und die professionelle
6Arbeit zu koordinieren. Die wesentlichen Gestaltungsparameter sind die Professionalisie-
rung, die horizontale Aufgabenspezialisierung und die vertikale und horizontale Dezent-
ralisation in einer komplexen, stabilen Umwelt (Mintzberg 1992, S. 256; Thieme 1996;
Müller-Böling 1997, S. 603).
Die Profibürokratie zeichnet sich aus durch einen sehr starken operativen Kern, in dem
die für eine Hochschule elementaren Funktionen Forschung und Lehre erbracht werden.
Er besteht aus der Gruppe der Professoren und der Gruppe des wissenschaftlichen Mittel-
baus. Die strategische Spitze hingegen ist schwach ausgeprägt. Zu ihr gehören die Hoch-
schulleitung, das Rektorat oder das Präsidialkollegium6 und die zentralen Selbstverwal-
tungsgremien. Sie tragen die Gesamtverantwortung für die Hochschule. Die Machtbefug-
nisse der Hochschulspitze sind im Vergleich zu anderen Organisationstypen begrenzt; sie
ist nicht in der Lage, die professionellen Mitarbeiter direkt zu lenken. Zwar hat sie durch-
aus Möglichkeiten der Einflussnahme (Mintzberg 1992, S. 30 ff., 268 ff.) durch Rückgriff
auf ihre Machtressourcen der Finanzierung, Planung, Regulierung und Evaluation (Be-
cher/Kogan 1992, S. 50 ff.). Doch letztlich sind die Steuerungsmöglichkeiten von Hoch-
schulleitungen gering, da in Expertenorganisationen Leitungsentscheidungen eng mit der
fachlichen Arbeit verknüpft sind (Pellert 2000, S. 46). Die hohe Professionalität der Tä-
tigkeiten im operativen Kern verleiht diesem ein erhebliches Gewicht, das eine Standardi-
sierung der Tätigkeiten und eine daraus folgenden Kontrolle weitgehend verhindert.
Eine weitere Besonderheit an der Struktur der Hochschule ist, dass sie stärker als andere
Organisationen aus lose gekoppelten Systemen besteht (Weick 1976) und zwar aus Sys-
temen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, die sich aus Professuren zusam-
mensetzen, die durch ein extrem hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit gekennzeichnet
sind. Der „operative Kern“ ist also keineswegs eine monolithische Größe, sondern besteht
selbst wieder aus Einheiten, die weitgehend unabhängig voneinander operieren (können).
6 Mit den Worten von Mintzberg (1992, S. 268) ist der Rektor der „professionelle Administrator“ der Pro-
fibürokratie Hochschule. Nun ist der Rektor in deutschen Hochschulen bekanntlich nur ein, wenn auch
herausgehobenes Mitglied des Rektorats, zu dem neben den Prorektoren auch der Kanzler gehört. Unter
dem Aspekt der Professionalität wäre die in vielen Hochschulverfassungen vorgeschriebene Begrenzung
der Amtszeit eines Rektors eigener Überlegungen wert, denn der Kanzler, in der Regel immer noch Le-
benszeitbeamter, stellt aufgrund seiner Berufserfahrung in einem personell immer wieder wechselnden
Rektorat den eigentlichen „Profi“ dar, der über Wissen verfügt, das die anderen Rektoratsmitglieder
nicht haben und nicht haben können. Man muss nicht unbedingt auf Lenin zurückgreifen, demzufolge
Wissen Macht ist; das kann man auch organisationswissenschaftlich begründen (vgl. Wilkes-
mann/Rascher 2002). Unter diesem Aspekt wäre die Frage eigener Überlegungen wert, wer an deut-
schen Hochschulen eigentlich der „professionelle Administrator“ ist: der Rektor oder der Kanzler?
7Diese Organisationsstruktur ist der nahe, die heute von öffentlichen und privaten Unter-
nehmen gefordert wird, um sich durch ständige Wandlungsfähigkeit erfolgreich am Markt
zu positionieren (Kern 2000, S. 26 ff.). Denn die Subsysteme werden weder zentral ge-
steuert noch integriert. Es hat sich eine flache Hierarchie mit starken dezentralen Einhei-
ten, einer im Vergleich zu anderen Organisationen eher schwachen Zentralleitung und ei-
ner noch schwächeren Leitung auf der Mittellinie, d. h. auf Dekanatsebene herausgebil-
det; trotz der z. T. erheblichen Größe von Universitäten gibt es im Bereich Forschung und
Lehre nur die drei Hierarchieebenen Lehrstuhl, Dekanat und Rektorat, die zudem nicht in
einem Verhältnis von Anweisung und Ausführung stehen. Jede Einheit, d. h. jedes Fach-
gebiet, jedes Institut, letztlich jede Professur unterhält selbstverantwortet Beziehungen zur
Außenwelt, zu Studierenden und Interessenten und ist somit innerhalb ihrer Einheit resp.
der Hochschule eigenständig handlungsfähig (Brinckmann 1998, S. 136). Selbst wenn es
gewollt wäre, könnten diese Einheiten gar nicht qua Hierarchie, also der in vielen Organi-
sationen üblichen Form der Steuerung koordiniert werden; schon immer findet sich in
Hochschulen ein Typ von Koordinierung, eine „diskursive Koordinierung“, auf die viele
Organisationen insbesondere im industriellen Sektor derzeit mühsam umzustellen versu-
chen (dazu Minssen 1999)7.
Allerdings haben dezentrale Strukturen die unangenehme Tendenz, ihre je spezifischen,
„lokalen“ Rationalitäten zu entwickeln. Bei einer hohen Autonomie der dezentralen Ein-
heiten ergibt sich daraus die Kehrseite der Vorteile von Dezentralität, nämlich die man-
gelnde Steuerungsfähigkeit der Gesamtorganisation; jede dezentrale Struktur erzeugt das
Problem einer Koordinierung der dezentralen Einheiten. Dies gilt in besonderer Weise für
Hochschulen, in denen sich die Disziplinen und Vertreter einzelner Disziplinen nicht nur
eher der Wissenschaftsgemeinschaft verpflichtet fühlen als der Hochschule, an der sie
forschen und lehren, sondern in denen der unentwickelten Hierarchie entsprechend sich
auch eine Formalstruktur kaum ausgebildet hat.
Deswegen sind Entscheidungsprozesse in Hochschulen nicht denkbar im Sinne von An-
weisung und Ausführung8, sondern Entscheidungen in Hochschulen basieren auf komple-
7 Dies mag ein Grund sein, dass Hochschulen in der Vergangenheit durchaus Beachtliches zuwege ge-
bracht haben; denn mit einem Personalbestand, der unter dem der 70er-Jahre liegt, werden an den deut-
schen Hochschulen mittlerweile Massen von Studierenden bewältigt, deren Anzahl doppelt so hoch ist
wie in den 70er-Jahren. Diese Zahlen allein zeigen, dass der in den Medien viel gescholtene „faule Pro-
fessor“ mehr Zerrbild als Realität ist.
8 Wobei dahin gestellt bleibe, ob Entscheidungsprozesse in Organisationen überhaupt so denkbar sind.
8xen Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen (nicht nur) in den dafür vorgesehenen
Gremien, die sich zudem im Unterschied zu anderen Organisationen durch ein hohes Maß
an Konsensorientierung und einen daraus folgenden Zeitaufwand auszeichnen9. Die rela-
tive Autonomie von Fakultäten, Fachbereichen und Professoren erschwert es, das System
Hochschule als Organisation insgesamt zu steuern - sei es extern durch die Politik bzw.
durch das Wissenschaftsministerium oder intern durch das Rektorat bzw. die Dekanate
(Hanft 2000, S. 15). Zwar hat man sich im Ministerium von der Einführung der Indikato-
risierung einen Steuerungsimpuls für die Hochschulen erhofft, doch diese Hoffnung
konnte sich nur erfüllen, wenn die Indikatorisierung auch hochschulintern als rationale
Problemlösung kommunizierbar war. Zudem erreicht die politisch-kontextuelle Steuerung
des Wissenschaftsministeriums bzw. der Politik die individuellen Akteure auf der Mittel-
linie und im operativen Kern auf unterschiedliche Weise. Dekane und Professoren von
Hochschulen werden neben politischen Kontexten auch von hochschulinternen Hand-
lungslogiken sowie durch die eigene Logik akademischer Karrieren geprägt. Individuelle
Akteure haben immer auch Handlungsspielräume mit spezifischen Handlungsorientierun-
gen bzw. Einstellungsmustern (Mayntz/Scharpf 1995, S. 52) - auch und ganz besonders in
Hochschulen.
Deshalb wollen wir uns nun nach der Organisationsebene den motivationalen Bedingun-
gen von Handeln bzw. Verhalten auf der Akteursebene zuwenden. Hier entscheidet sich
auch, ob die Versuche der Kontextsteuerung auf der - für den Lehr- und Forschungspro-
zess - relevanten Ebene der Handlungen von Professoren ankommt.
4. Die Akteursebene: Handlungsorientierungen
Organisationen müssen sicherstellen, dass die individuellen Handlungen ihrer Mitglieder
auch mit den organisationalen Zielen übereinstimmen. Mitarbeiter unterwerfen sich zwar
qua Arbeitsvertrag den Organisationszielen, aber diese beim Eintritt in die Organisation
9 Dies ist allerdings zugleich auch ein Problem der Entscheidungsfindung in Hochschulen; die „hochschu-
lischen Entscheidungsstrukturen bestehen im Kern aus der akademischen Selbstverwaltung. Zu ihr ist
zunächst einmal zu konstatieren: Die Gremien tagen regelmäßig. Wenn nötig, werden Sondersitzungen
anberaumt. Beschlüsse werden gefasst, mal mit und mal ohne längere Aussprache. Zur Entscheidungs-
findung werden auch zahlreiche Kommissionen eingesetzt. Die deutschen Hochschulen sind entschei-
dungsfähig, ja geradezu entscheidungsfreudig, um nicht zu sagen entscheidungswütig, wenn man sich
die Menge an getroffenen Entscheidungen vergegenwärtigt. Das ist freilich bereits ein Grund, warum
die meisten Beteiligten über die hochschulische Selbstverwaltung stöhnen. Man muss so entsetzlich viel
Zeit aufbringen, weil man überall mitentscheiden darf - besser gesagt: muss“ (Schimank 2001, S. 230).
9erfolgte Absichtserklärung muss kontrolliert und erneuert werden. Traditionell wird dies
über externe Anreize gemacht. Die Vergabe der Mittel aus der TG 94 nach Leistungskri-
terien folgt genau dieser Logik. Durch externe Anreize wird versucht, das Handeln der
Professoren auf spezifische Ziele von Hochschulen zu lenken (vgl. Wilkesmann 2001).
Dabei haben Hochschulen es aber mit einer ganz spezifischen Klientel zu tun. Die dezen-
tralen Einheiten von Hochschulen bestehen aus Mitgliedern, den Professoren, die sich
nicht so sehr ihrer eigenen Organisation als vielmehr ihrem je spezifischen Fach verbun-
den fühlen. Der Bezugspunkt des wissenschaftlichen Personals ist die (weltweite) scienti-
fic community des eigenen Fachs10, nicht aber die Hochschule, der man angehört. Es ist
die scientific community, die fachliche Leistungen belohnt, manchmal auch bestraft,
durch die Professoren Reputation erlangen (Pellert 2000) und die letztlich über Karriere
entscheidet; Hochschulleitungen verfügen nicht wie Wirtschaftsunternehmen über derar-
tige Steuerungsmöglichkeiten (Hanft 2000, S. 15), denn der Wissenschaftler richtet sich
„primär am Urteil der Fachgemeinschaft aus und behandelt demgegenüber die Verpflich-
tungen der lokalen Selbstverwaltung nachrangig“ (Paris 2001, S. 210). Mögliche Sanktio-
nen der Hochschulleitung können demgegenüber nur sekundär bleiben; notfalls bewirbt
man sich eben auf andere Professuren, was zudem noch Reputationsgewinn verspricht11.
Verhaltenssteuerungen von Professoren durch Hochschulleitungen sind also begrenzt;
mehr noch als in anderen Organisationen kommt es auf die Motivation des Personals an.
Professoren haben, wie gesagt, multi-task Aufgaben zu erfüllen. Es sind Tätigkeiten in
der Forschung, Lehre und Selbstverwaltung zu erbringen, die jeweils komplexe Aufga-
benbündel umfassen (Wilkesmann 2001). Traditionell wird in der Universität auf die in-
trinsische Motivation der Wissenschaftler gesetzt. Da die tägliche Forschungs- und Lehr-
arbeit nur schwer oder unter sehr hohen Transaktionskosten beobachtbar und damit kon-
10 In Deutschland scheint dies besonders ausgeprägt zu sein; im internationalen Vergleich jedenfalls zeigen
deutsche Professoren die geringste Verbundenheit mit ihrem Fachbereich und ihrer Hochschule (vgl.
Enders/Schimank 2001, S. 167).
11 Wenn aber die Fachgemeinschaft, nicht die Hochschule über Reputation und damit über Karriere be-
stimmt, also nicht die Organisation in der Lage ist, über Karriere zu entscheiden, dann ist die Steuerung
des Personals schwierig. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu entschärfen, könnte eine stärkere Hierar-
chisierung nach dem Vorbild amerikanischer Hochschulpräsidenten und deans sein, wie sie unter ande-
rem vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft (vgl. dazu Stucke 2001) ins Spiel gebracht worden
ist. Dies übersieht aber die völlig anderen institutionellen Bedingungen des amerikanischen Hochschul-
systems (vgl. die Beiträge in Breinig u. a. 2001) und löst zudem das Problem nicht, dass man es auf ab-
sehbare Zeit an deutschen Hochschulen mit einem Personal zu tun hat, das sich einer lebenslangen Be-
schäftigungssicherheit erfreut und zudem seine beruflichen Bezüge weitgehend außerhalb der eigenen
Hochschule hat.
10trollierbar ist, werden Wissenschaftler ihrer endogen erzeugten Motivation überlassen12.
Dies wird auch durch den Karriereweg unterstützt. Die Qualifikationsphasen der Promo-
tion und Habilitation sind lange Strecken des „einsamen“ Arbeitens, die in der Regel nur
von intrinsisch hoch motivierten Personen durchschritten werden können. In der Arbeits-
psychologie konnte der Zusammenhang von hoher intrinsischer Motivation und großen
Handlungsspielräumen nachgewiesen werden (Hackman/Oldham 1980). Der große Hand-
lungsspielraum, den Hochschullehrer genießen, unterstützt prinzipiell das Auftreten von
intrinsischer Motivation und es sind, wie empirische Studien (vgl. die Zusammenfassung
bei Enders/Schimank 2001) zeigen, gerade diese intrinsisch motivierenden Aspekte der
Tätigkeit, die eine wesentliche Quelle der Arbeitszufriedenheit von Professoren darstel-
len.
Ob Akteure ihre Handlungen als intrinsisch oder extrinsisch motiviert wahrnehmen, ist
eine Frage der Attribution. Aus der Motivationsforschung ist bekannt, dass das Verhältnis
von intrinsischer und extrinsischer Motivation nicht additiv sein muss, dass vorhandene
intrinsische Motivation durch extrinsische Anreize sogar zerstört werden kann, mithin
Verstärkungs-, aber auch Verdrängungseffekte auftreten können (Frey/Osterloh 2000, S.
29). Externe Faktoren in Form von Belohnungen haben zudem immer zwei Aspekte, ei-
nen informierenden und einen kontrollierenden Aspekt. Der informierende Aspekt ver-
stärkt die erlebte Kompetenz und somit die internale Kontrollüberzeugung, wohingegen
der kontrollierende Aspekt die externe Kontrollüberzeugung bzw. das Gefühl der Fremd-
steuerung verstärkt (Frey/Osterloh 2000, S. 30). Der Verdrängungseffekt tritt ein, wenn
externe Faktoren als kontrollierend empfunden werden. Sie vermindern dann die Selbst-
bestimmung, Selbsteinschätzung und die Ausdrucksmöglichkeit und die intrinsische Mo-
tivation wird in dem kontrollierten Bereich eingeschränkt. Die intrinsische Motivation
wird hingegen verstärkt, wenn externe Faktoren als unterstützend empfunden werden. Die
Selbstbestimmung wird über die Selbsteinschätzung und einen damit verbundenen größe-
ren Verhaltensspielraum entwickelt (Frey 1997, S. 24 f.).
Wann und ob ein Verdrängungs- oder Verstärkungseffekt bei einem Individuum eintritt,
hängt von seinen subjektiven Wahrnehmungen ab. Gleiche exogene Faktoren können bei
einem Individuum verstärkend wirken und bei dem anderen verdrängend (Frey 1997, S.
12 „Wissenschaftliches Tun ist, aller Verbetrieblichung und Vernetzung der Funktionen zum Trotz, grund-
sätzlich Einzelarbeit. Ob in der Lehre vor großem Publikum, nächstens am Schreibtisch oder im aus-
1125). Der Verdrängungseffekt ist bei materiellen Belohnungen größer als bei symboli-
schen, bei erwarteten Belohnungen größer als bei unerwarteten sowie bei komplizierten
Problemen stärker als bei einfachen. Ein Bonus- und Malussystem wie die indikatorisierte
Finanzmittelzuweisung kann deshalb prinzipiell motivationssteigernd sein, es kann aber
auch bewirken, dass das unmittelbare Ziel (Leistung in Lehre und Forschung) aus den
Augen verloren wird (Frey/Osterloh 2000, S. 29).
Dies macht es möglich, dass selbst in dem Fall, dass alle Hochschulen die Mittel intern
nach Indikatoren zuweisen, dass also die Kontextsteuerung durch das Ministerium erfolg-
reich war, dies noch keineswegs bedeuten muss, dass sich an der Leistungserstellung et-
was geändert hat. Die Leistungen von Hochschulen werden durch Professoren erbracht:
sie sind letztlich verantwortlich für die Absolventenzahlen, für die Anzahl der Promotio-
nen und für die Einwerbung von Drittmitteln, also für die Parameter, an denen sich der
Indikatorisierung zufolge der Erfolg in Forschung und Lehre bemisst. Nun ist bereits an
anderer Stelle (etwa Dilger 2001; Eckardstein u. a. 2001) darauf hingewiesen worden,
dass eine Anreizgestaltung mittels Geld in Hochschulen zumindest problematisch ist. Da-
durch kann eine Diskrepanz zwischen Organisationsebene und Akteursebene entstehen.
Was sich auf einer Organisationsebene als erfolgreiche Kontextsteuerung darstellt, weil es
den hochschulinternen Kommunikationscode geändert hat, mag auf einer Akteursebene
völlig folgenlos bleiben oder sogar nicht-intendierte Effekte haben. Auch wenn in Hoch-
schulen intern auf eine Indikatorisierung der Mittelzuteilung umgestellt ist, muss dies
keineswegs eine Verhaltensänderung von Professoren implizieren; sie können davon nicht
berührt sein oder sich sogar zu einem Verhalten veranlasst sehen, dass den Zielen einer
Indikatorisierung geradezu widerspricht. Dies ist eine empirisch zu entscheidende Frage,
und der wollen wir uns jetzt zuwenden13.
sichtslosen Kampf mit der Sache - in allen Aspekten unserer beruflichen Tätigkeit sind wir in einem e-
xistentiellen Sinne allein“ (Paris 2001, S. 207).
13 Die folgenden Befunde beruhen auf einem Projekt, das - gefördert vom nordrhein-westfälischen Minis-
terium für Schule, Wissenschaft und Forschung - in den Jahren 2000 bis 2002 durchgeführt wurde. Im
Rahmen dieses Projektes wurden u.a. alle Rektorate, Dekanate und alle Professoren in Nordrhein-
Westfalen mit einem standardisierten Fragebogen schriftlich befragt; zur Anlage der Untersuchung, zu
weiteren Ergebnissen und zu bemerkenswerten Erfahrungen bei der Projektdurchführung vgl. Minssen
u. a. 2003. An der Projektdurchführung waren neben uns Uwe Andersen und Beate Molsich beteiligt,
denen wir auf diesem Wege danken.
125. Empirische Evidenzen zur Kontextsteuerung von Hochschulen
Ein Großteil der Rektorate nordrhein-westfälischer Hochschulen führte sehr rasch nach
der Einführung der formelgebundenen Finanzmittelverteilung des Wissenschaftsministe-
riums im Jahr 1993 auch intern ein Parametermodell ein. Bis zum Jahr 1995 stellten drei
von vier der Rektorate die Finanzmittelverteilung von der herkömmlichen auf die parame-
tergebundene Verteilung um; im Jahr 2000 verteilen alle Rektorate ihre Finanzmittel nach
einem indikatorisierten Finanzierungsmodell. Dabei überwiegen nach Auffassung der
Rektorate die Gewinne der Fachbereiche die Verluste - eine Einschätzung, die von den
Dekanaten geteilt wird.
Die Bewertung der formelgebundenen Finanzmittelverteilung ist äußerst positiv: in der
weit überwiegenden Mehrheit der Rektorate wird die Parameterverteilung als gut einge-
schätzt; niemand stimmt der Aussage zu, dass das MSWF mit der Umstellung der Fi-
nanzmittelzuweisung nur einer Mode folge. Mehrheitlich wird positiv hervorgehoben,
dass das neuartige Finanzierungsmodell eindeutige Zielwerte vorgebe, leistungsorientier-
tes Verhalten in Forschung und Lehre sowie Transparenz fördere, und in keinem Rektorat
wird die Auffassung vertreten, dass eine finanzielle Belohnung bestimmter Aktivitäten
mit der Freiheit von Forschung und Lehre nicht vereinbar sei oder dass eine finanzielle
Belohnung bestimmter Aktivitäten nur der Kontrolle der Handlungen von Professoren
diene. Allerdings gibt es auch eine freilich sehr kleine kritische Minderheit: jeweils zwei
Rektorate sind der Auffassung, dass die finanzielle Belohnung bestimmter Aktivitäten
angesichts bisheriger Leistungen überflüssig sei und dass sich sowieso nichts ändere.
Sieben Jahre nach Einführung der formelgebundenen Finanzmittelverteilung durch das
MSWF an die Hochschulen werden auch in zwei Drittel aller Fachbereiche die Mittel in-
dikatorisiert an die Professoren weitergegeben, in jedem dritten Fachbereich sogar voll-
ständig. Insofern hat die Veränderung der Mittelzuweisung durch das MSWF also Aus-
wirkungen bis auf die Fachbereiche hinein gezeigt. Die Parameter wurden offenbar nicht
einfach vom Rektorat oder gar vom MSWF übernommen, sondern jeweils fachbereichs-
spezifisch zugeschnitten, indem sie aus älteren Parametern weiterentwickelt wurden. Dies
geschah insbesondere innerhalb des Fachbereichsrats bzw. innerhalb der Fachbereichs-
kommission für Struktur und Finanzen. Und immerhin jedes dritte Dekanat nimmt für
sich in Anspruch, das Verteilungsmodell des Fachbereichs selbst entwickelt zu haben.
13Rund drei Viertel der Dekanate beurteilen die Indikatorisierung sowohl für ihren Fachbe-
reich als auch insgesamt als gut bis sehr gut. Dabei ist diese Einschätzung umso positiver,
je mehr die Dekane sich informiert und beteiligt gefühlt haben. Insgesamt aber ist die
Einschätzung nicht so positiv wie in den Rektoraten; immerhin jeder fünfte Dekan stimmt
der Aussage zu, dass das MSWF nur einer Mode folge, und jeder dritte Dekan ist der
Auffassung, dass eine finanzielle Belohnung bestimmter Aktivitäten angesichts bisheriger
Leistungen überflüssig und eine finanzielle Belohnung nicht mit der Freiheit von For-
schung und Lehre vereinbar sei.
Die Finanzmittelsituation für die Professoren hat sich im letzten Jahrzehnt oftmals nicht
geändert; eine starke Gruppe von 42 % gibt an, dass sie in der Ausstattung der TG 94 seit
1993 weder gewonnen noch verloren hätte. Wir haben aber auch Gewinner und Verlierer;
nahezu jeder Vierte hat seit 1993 Finanzmittel gewonnen, und mehr als jeder Dritte hat in
diesem Zeitraum Finanzmittel verloren. Es gibt also eine relative Mehrheit, deren Aus-
stattungssituation sich ihren Angaben zufolge in den letzten Jahren nicht verändert hat,
doch zugleich öffnet sich eine Schere zwischen Gewinnern und Verlierern. Dabei gibt es,
auch wenn dies in unseren Expertengesprächen oft vermutet wurde, keine statistisch
nachweisbaren Unterschiede zwischen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auf der
einen und Naturwissenschaften bzw. Ingenieurwissenschaften auf der anderen Seite, und
auch der Hochschultyp hat auf Gewinne und Verluste keinen Einfluss: zwar geben Pro-
fessoren in den Gesamthochschulen und in den Fachhochschulen deutlich häufiger Ver-
luste an als ihre Kollegen aus den Universitäten; zugleich gibt es in den Gesamthochschu-
len und in den Fachhochschulen aber auch besonders viele Gewinner.
Dies legt den Schluss nahe, dass Gewinner- bzw. Verlierersituationen weniger von den
strukturellen Rahmenbedingungen abhängen als vielmehr von dem individuellen Ver-
handlungs- und vor allem Akquisitionsgeschick der einzelnen Professoren. Auf jeden Fall
ist die Entwicklung der Finanzmittelsituation an den einzelnen Professuren in den letzten
Jahren weitgehend unabhängig von der erfolgten oder nicht erfolgten Einführung einer
indikatorisierten Finanzmittelzuweisung im jeweiligen Fachbereich.
Nach Angaben der Professoren erhalten 42 % ihre Finanzmittel nicht nach Parametern.
Wenn wir freilich die Aussagen der Dekane zu Grunde legen, denen zufolge in zwei Drit-
tel aller Fälle den Professoren die Mittel indikatorisiert zugewiesen werden, muss daraus
der Schluss gezogen werden, dass ein nicht unerheblicher Anteil unter den Professoren
14sich offenbar wenig Gedanken darüber macht, wie die eigene Ausstattung zustande
kommt. Überhaupt scheint die Beschäftigung mit den Modalitäten der Mittelzuweisung
nicht sehr ausgeprägt, und zwar nicht nur unter den Professoren. In den Rektoraten
herrscht überwiegend Unkenntnis darüber, ob und in welchem Ausmaß die Mittel in ihren
Fachbereichen indikatorisiert zugewiesen werden, und jeder dritte Dekan hat „überse-
hen“, dass seinem Fachbereich die Mittel nach Parametern zugeteilt werden14. Es ist also
nicht nur so, dass man über Geld nicht spricht, sondern man interessiert sich auch nicht
sehr dafür, wie die Mittelzuweisung zustande kommt - sei es, weil die Mittel der TG 94
zu gering sind, als dass man sich ernsthaft über sie Gedanken machen müsste (was für
drittmittelstarke Professoren sicherlich zutrifft), sei es, weil ein Klagen über die stetige
Minderausstattung umso einfacher ist, je weniger man sich bewusst darüber ist, dass Ver-
luste und Gewinne auch über eigene Leistung gesteuert werden könnten.
Wir haben also den Fall einer nach Leitungsebene abnehmenden Informiertheit. Ange-
sichts der strukturell konsensorientierten Entscheidungsverläufe in Hochschulen kann
dies kaum auf mangelnde Informationen der jeweils höheren Leitungsebene zurückge-
führt werden. Insofern muss eine fehlende Bereitschaft zur Aufnahme von Informationen
konstatiert werden, die von der jeweils höheren Leitungsebene mitgeteilt werden.
Zugleich gilt dies aber auch in anderer Richtung; die Rektorate zeigten sich erstaunlich
schlecht informiert über die Verbreitung einer indikatorisierten Mittelzuweisung inner-
halb der Fachbereiche ihrer eigenen Hochschule. Informationen werden also entweder
nicht mitgeteilt oder mitgeteilte Informationen werden nicht verstanden - Kommunikation
in Hochschulen ist in einem hohe Maß kontingent.
Die Einführung der neuen Modi der Mittelverteilung wird unter den Professoren zwar
nicht so positiv beurteilt wie in den Rektoraten und auch noch den Dekanaten, doch im-
merhin fast die Hälfte aller Professoren bewertet die parameterorientierte Mittelverteilung
insgesamt und 44 % in Bezug auf die eigene Professur als positiv. Dabei ist die Einschät-
zung umso positiver, je informativer und partizipativer der Einführungsprozess verlaufen
ist, und dies scheint oftmals der Fall gewesen zu sein.
14 Wir sind in unserer Untersuchung in vielerlei Hinsicht auf erstaunliches Unwissen gestoßen. Dass aller-
dings jedem dritten Dekan nicht klar ist, nach welchem Modus seinem Fachbereich die Mittel zugewie-
sen werden, hätten wir vorher für schlechterdings ausgeschlossen gehalten.
15Zwei Drittel fühlten sich ausführlich informiert durch die Dekane und mehr als die Hälfte
haben sich selbst aktiv informiert und berichten von ausführlichen Diskussionen in den
entsprechenden Gremien; fast drei Viertel der Professoren haben sich an fachbereichsin-
ternen Diskussionen und Verhandlungen beteiligt und immerhin noch mehr als die Hälfte
an hochschulinternen Diskussionen. Es lässt sich also durchaus eine in den Fachbereichen
weit verbreitete Diskurs- und Konsenskultur konstatieren. Auf der anderen Seite aber hat
jeder Fünfte erst im Zuge seiner Berufung von der formelgebundenen Finanzmittelzuwei-
sung erfahren, und fast jeder Dritte sah de facto keine Mitwirkungsmöglichkeit. Nicht ü-
berraschend ist bei letzteren die Einschätzung der parameterorientierten Mittelzuweisung
deutlich negativer als bei denjenigen, die sich informiert und beteiligt gefühlt haben.
Insgesamt 49 % aller befragten Professoren beurteilen die formelgebundene Finanzmittel-
zuweisung positiv15; für diese Bewertung ist, wie gesehen, der Einführungsprozess wich-
tig, aber er ist nicht ausschlaggebend. Denn im Meinungsspektrum der Professoren exis-
tieren signifikante Differenzen, die nicht allein durch Information und Partizipation beim
Entscheidungsprozess für die Einführung der Indikatorisierung zu erklären sind. Inner-
halb der Professorenschaft existieren nämlich zwei relativ deutlich voneinander abgrenz-
bare Gruppen. Dies zeigt eine Faktorenanalyse der Variablen, mit denen wir die Beurtei-
lung der Parameterorientierung im Einzelnen abgefragt haben (vgl. Backhaus et al. 1996,
S. 189ff). Sie ergibt zwei Hauptkomponenten, die 56 % der Varianz erklären16 (Abbil-
dung 1 im Anhang). Die erste Hauptkomponente lädt hoch auf Items, die Leistung in For-
schung, Lehre und Selbstverwaltung sowie Transparenz als Folge der Indikatorisierung
betonen. Hier werden also ökonomische Steuerungskriterien hervorgehoben, die nicht im
Gegensatz zur Freiheit von Lehre und Forschung gesehen werden. Wir bezeichnen diese
Gruppe deswegen als „Ökonomisten“. Sie umfasst 33 % der befragten Professoren.
Die zweite Hauptkomponente lädt hoch auf den Items, die Kontrolle der Professoren,
Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre sowie die materielle Steuerung des
Verhaltens durch die parametergestützte Mittelvergabe in den Vordergrund stellen. In
diesem Fall werden also die traditionellen Werte der Selbstregulation der Wissenschaft
15 Fast gleiche Ergebnisse finden sich in einer Befragung von Professoren und Wissenschaftlern der Freien
Universität Berlin; vgl. Hübner/Rau 2001.
16 Hauptkomponentenanalyse ohne Rotation, Auswahl der Hauptkomponenten nach dem Kaiser-Kriterium
durch Eigenwert größer eins; bei einem recht guten KMO-Wert von 0,83. Die Orginalitems sowie die
Ladung der einzelnen Items sind in Abb. 1 im Anhang aufgelistet. Diese Einschätzungsfragen sind auf
einer Siebener-Likert-Skala abgefragt worden.
16betont, die im Widerspruch zu einer Indikatorisierung der Mittelvergabe stehen; wir be-
zeichnen diese Gruppe deswegen als „Traditionalisten“17. In dieser Gruppe versammeln
sich 67 % der Professoren.
Zur weiteren Berechnung sind die vier Items „fördert leistungsorientiertes Verhalten in
der Forschung (1), in der Lehre (2), in der Selbstverwaltung (3) und fördert Transparenz
(4)“ zur Dimension „Ökonomisten“ zusammengefasst worden (Cronbachs α ,840). Eben-
so sind die vier Items „fördert nur Verhaltensweisen, die materiell belohnt werden (1), fi-
nanzielle Belohnung bestimmter Aktivitäten ist angesichts der bisher erbrachten Leistung
überflüssig (2), ist nicht mit Freiheit von Forschung/Lehre zu vereinbaren (3), dient nur
zur Kontrolle der Handlungen von Professoren (4)“ zur Dimension „Traditionalisten“ zu-
sammengefasst worden (Cronbachs α ,699).
Die Differenzierung in diese beiden Gruppen findet sich auch bei den Antworten auf die
Frage, warum das MSWF die Mittel parameterorientiert verteilt. Bei einem KMO-Wert
von 0,77 erklären die beiden Hauptkomponenten eine Varianz von 51 %. Auch hier fin-
den sich die Gruppen der „Ökonomisten“ und der „Traditionalisten“ (Abbildung 2 im
Anhang)18; die „Traditionalisten“ sehen in der Indikatorisierung in erster Linie den Ver-
such des MSWF, sich zu entlasten (und, so wird man wohl hinzufügen dürfen: die Lasten
auf die Hochschulen abzuwälzen), wobei es unkritisch einer Mode folge, während die
„Ökonomisten“ die Erzeugung von mehr Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit sowie eine
gerechtere Verteilung der Mittel als Motiv für die Umstellung auf Parameterorientierung
in den Vordergrund rücken. Wie zu erwarten, haben die „Ökonomisten“ eine sehr hohe
positive Einschätzung der parameterorientierten Mittelverteilung, während die Mitglieder
der Gruppe der „Traditionalisten“ sich zu der neuen Mittelvergabe indifferent bis ableh-
nend verhält.
17 Mit der Differenzierung zwischen „Ökonomisten“ und „Traditionalisten“ soll keine Präferenz suggeriert
werden etwa in dem Sinne: „Traditionalisten“ versus „Modernisierer“. „Ökonomisten“ zeichnen sich
dadurch aus, dass sie der Formel „Geld gegen Leistung“ auch für den Bereich von Lehre und Forschung
einiges abgewinnen können, sie werden dadurch aber nicht schon zu Modernisierern, die allen Verände-
rungen gegenüber aufgeschlossen gegenüber stehen; und „Traditionalisten“ auf der anderen Seite ver-
schließen sich nicht grundsätzlich gegenüber Veränderungen oder gehören gar in besonderer Weise zu
den „faulen Professoren“, betonen aber die Notwendigkeit, humboldtsche Bildungsideale bei Innovati-
onsprozessen nicht völlig außer Acht zu lassen – eine Auffassung, für die sich durchaus gute Gründe
beibringen lassen. – Wir sind uns der Vorläufigkeit unserer Bezeichnung bewusst und verwenden sie
deswegen nur mit Anführungszeichen.
18 Auch hier wurde wieder eine Hauptkomponentenanalyse ohne Rotation durchgeführt, die Auswahl der
Hauptkomponenten erfolgte nach dem Kaiser-Kriterium durch Eigenwert größer eins. Die Orginalitems
17Die Beurteilung der formelgebundenen Mittelzuweisung spaltet die Professoren also in
zwei Lager: Eine Gruppe stellt die leistungsorientierte Anreizwirkung heraus, die andere
Gruppe sieht dies eher als Bedrohung ihres Handlungsspielraums an. Dies kann nachhal-
tige Folgen für die Arbeitsmotivation haben. Wenn nämlich unterstellt wird, das Professo-
ren bisher intrinsisch motiviert waren, da keine anderen Anreize existierten, dann ist bei
der Gruppe der „Traditionalisten“ keineswegs ein Motivationsschub in Richtung der Kri-
terien, die durch die Indikatorisierung ein besonderes Gewicht bekommen haben, zu er-
warten, sondern ganz im Gegenteil sogar eher ein Abbau ihrer Motivation zu befürchten.
Denn werden externe Anreize vergeben, so besteht die Gefahr, dass dadurch die intrinsi-
sche Motivation zerstört wird, da die externen Anreize die intrinsische Motivation ver-
drängen.
Eine Verstärkung der intrinsischen Motivation dürfte für die Professoren zu konstatieren
sein, die der Gruppe der „Ökonomisten“ zuzurechnen und die auch bisher schon hoch in-
trinsisch motiviertes Verhalten in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung gezeigt haben;
sie werden die Anreize durch die formelgebundene Mittelvergabe als Unterstützung
wahrnehmen und weiterhin entsprechend hoch motiviert sein. Wird also unterstellt, dass
die Professoren aus beiden Gruppen bisher intrinsisch motiviert waren, dann hat die neue
Mittelverteilung bei der Gruppe der „Ökonomisten“ nur wenig Effekte, da sie ohnehin das
Verhalten an den Tag gelegt hat, dass durch die Indikatorisierung angestoßen werden soll,
und bei der Gruppe der „Traditionalisten“ ist sogar ein negativer Effekt zu befürchten, da
sie die Indikatorisierung als manifeste Kritik an ihrem bisher gezeigten Verhalten inter-
pretieren. Allenfalls in dem Fall, dass bei einem Mitglied aus der Gruppe der „Ökono-
misten“ bisher keine intrinsische Motivation vorlag - ein Fall freilich, der empirisch kaum
vorfindbar sein dürfte -, kann die neue Mittelvergabe einen Motivationseffekt ausüben.
Der motivationale Steuerungseffekt durch parametergestützte Mittelzuweisung ist damit
sehr gering, zumal die Gruppe der „Traditionalisten“ sehr viel größer ist als die der „Öko-
nomisten“19.
Wer verbirgt sich nun hinter den beiden Gruppen der „Ökonomisten“ und der „Traditio-
nalisten“? Zu finden sind sie, so der Rektor einer Hochschule, in jedem Fachbereich, aber
sowie die Ladung der einzelnen Items sind in Abb. 2 im Anhang aufgelistet. Diese Einschätzungsfragen
wurden auf einer Siebener-Likert-Skala abgefragt.
19 Selbst in unserem Sample. In der Grundgesamtheit sind die Unterschiede vermutlich noch viel größer,
da wir davon ausgehen müssen, dass viele „Traditionalisten“ sich an der Befragung gar nicht erst betei-
ligt haben.
18in den Geisteswissenschaften seien die „Traditionalisten“ ausgeprägter als in anderen
Fachbereichen. Dies ist eine durchaus naheliegende Auffassung, die auch durch andere
Studien gestützt zu werden scheint, denen zufolge Mitglieder der Geistes- und Sozialwis-
senschaften einer leistungsbezogenen Mittelverteilung erheblicher skeptischer gegenüber-
stehen (Hübner/Rau 2001). Aus unseren Daten jedoch lässt sich dies nicht ablesen: Wir
haben keine statistisch nachweisbaren Unterschiede zwischen den Fächern gefunden; „Ö-
konomisten“ wie „Traditionalisten“ gibt es gleichermaßen in naturwissenschaftlichen
Fachbereichen wie in ingenieur- oder geisteswissenschaftlichen Fachbereichen. Die Mit-
glieder beider Gruppen differenzieren sich auch nicht nach Geschlecht oder Besoldungs-
stufe, nicht nach Hochschultyp und auch nicht in Bezug auf die Information zur neuen
Mittelvergabe. Lediglich die über 60-jährigen sind in der Gruppe der „Traditionalisten“
etwas überrepräsentiert; doch signifikante Differenzen lassen sich nicht feststellen, so
dass die hoffnungsfrohe Erwartung eines Kanzlers, dass die „Ökonomisten“ mit dem Ge-
nerationenwechsel „aussterben werden“, wohl etwas verfrüht ist (vgl. zur Dokumentation
der Daten: Minssen et al. 2003).
Entsprechend ist die allgemeine Einschätzung der formelgebundenen Finanzmittelzuwei-
sung weder vom Alter, Geschlecht noch Besoldungsstufe abhängig, aber sie hängt positiv
vom Einstellungsmuster „Ökonomisten“, negativ vom Einstellungsmuster „Traditionalis-
ten“ und positiv von dem aktiven Informieren über die Hintergründe der formelgebunde-
nen Finanzmittelzuweisung ab. Dies belegt eine Regressionsrechnung (vgl. Backhaus et
al. 1996, S. 3ff) (Abbildung 3 im Anhang).
Kurz und knapp: es existieren keine soziodemographischen Kriterien oder sonstige Diffe-
renzmerkmale, die die beiden Gruppen unterscheiden. Aus diesem Grunde liegt die Ver-
mutung nahe, dass die beiden Gruppen in erster Linie Einstellungsmuster repräsentieren.
Einstellungen werden nach der klassischen Definition von Rosenberg und Hovland als
„predispositions to respond to some class of stimuli with certain classes of response“ Ro-
senberg/Hovland 1960, S. 3) bestimmt. Es sind zeitlich relative stabile Muster, die im be-
ruflichen Sozialisationsprozess erlernt werden (Stroebe/Jonas 1990). Dies gilt ebenso für
wissenschaftliche Sozialisationsprozesse, denn „die Konstruktion der wissenschaftlichen
Persönlichkeit geschieht (...) in Auseinandersetzungen mit anderen WissenschaftlerInnen
in einem sozialen Spiel“ (Engler 2001, S. 43), durch das Sichtweisen geprägt werden.
Dabei entstehen im Lauf der Zeit verfestigte Einstellungen, die auch die Wahrnehmung
von Veränderungen, in unserem Fall: die Veränderungen im Wissenschaftssystem struk-
19Sie können auch lesen