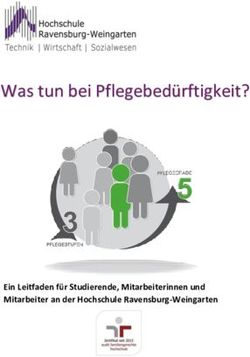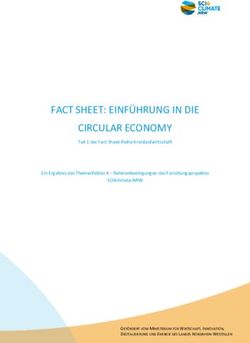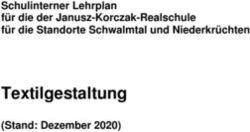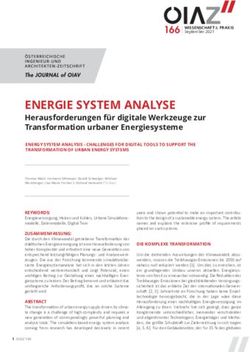Leonard Bernstein: Symphonie Nr. 2 "The Age of Anxiety" - Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks – Education 2017-18
Leonard Bernstein: Symphonie Nr. 2 »The Age of Anxiety«
Unterrichtsmaterial zu ECHTZEIT am 13. Juni 2018 in der Philharmonie im
Gasteig
Sir Antonio Pappano, Dirigent
Kirill Gerstein, Klavier
Autorin: Gabriele Puffer, Universität AugsburgInhalt 1. Allgemeine Hinweise 2. Lehrplanbezug 3. Informationen zum Werk 4. „Vier einsame Menschen in einer Bar“ – der Prolog 5. „Dichtung illustrieren, erweitern, verdeutlichen“ – Bezüge zwischen Programm und Musik im Überblick 6. „Ich kann keinen Tag ohne Musik leben“: Wer war Leonard Bernstein? 7. Bildnachweise, Literatur und Links Anhang: Arbeitsblätter
1. Allgemeine Hinweise
Die hier zusammengestellten Unterrichtsmaterialien dienen dazu, Schülerinnen und Schü-
ler1 ab Jahrgangsstufe 8 auf den Besuch der ECHTZEIT am 13. Juni 2018 vorzubereiten.
Die einzelnen Unterrichtseinheiten sind als weitgehend voneinander unabhängige Module
konzipiert. Sie können je nach den örtlichen Gegebenheiten ausgewählt, miteinander kom-
biniert und dem Niveau der Klasse bzw. des Kurses angepasst werden.
Aus urheberrechtlichen Gründen konnten Partiturausschnitte und Hörbeispiele nicht in
diese Materialien aufgenommen werden. Alle Taktangaben beziehen sich auf die 1950 in
New York erschienene Partitur2, Zeitangaben auf die ebenfalls 1950 entstandene Auf-
nahme des Werks mit dem New York Philharmonic Orchestra unter Leitung des Kompo-
nisten.3
2. Lehrplanbezug
Lehrplanbezug 8.-12. Jahrgangsstufe (Auswahl)
Mittelschule4
Jgst Lehrplanrubrik Methoden und Inhalte
.
10 Ein musikalisches
Werk Werkerschließung aus verschiedenen Blickwinkeln: Analyse und Inter-
pretation
Nachgestaltung durch Bewegung und Bild, ggf. szenische Gestaltung
sich mit dem kulturgeschichtlichen Umfeld auseinander setzen, Zu-
sammenhänge zwischen Werkgestalt, musikalischer Aussage und ge-
schichtlichen Bedingungen entdecken
9 Rhythmus als Ge-
staltungsmittel in Hören und Besprechen von Beispielen besonderer rhythmischer Aus-
Musik des 20. prägung
Jahrhunderts
8 Ein historischer
Musiker Erkunden der Lebensgeschichte: Zusammentragen von Fakten, z. B.
aus Lexika, Biographien, Aufsätzen, Briefen, Tagebüchern
Präsentation von Ergebnissen (z. B. Schautafel, Videofilm, Hörspiel)
Hören und Beschreiben von Werken oder Werkausschnitten
Englisch 8.2.1:
landeskundliche typisch amerikanische Musik- und Kunstrichtungen, z. B. Spirituals,
Schwerpunkte Jazz, Rap und Pop Art
1
Im Folgenden wird der Lesbarkeit wegen entweder die weibliche oder die männliche Form verwendet. Ge-
meint sind normalerweise immer beide Geschlechter.
2
Bernstein o. J. (1950)
3
Bernstein 1950/ 1998
4
https://www.isb.bayern.de/mittelschule/lehrplan/
Seite 3Realschule5
Jgst Lehrplan- Ziele und Inhalte
rubrik
10
Musik und unterschiedliche Funktionen der Musik zur Darstellung eines außermusi-
Programm kalischen Inhalts erkennen
ausgewählte Werke im Hinblick auf ihren außermusikalischen Inhalt hören
und musikalische Mittel beschreiben
über die Bedeutung eines Programms für das Verstehen des Werkes
sprechen
9
Musik des 20. ausgewählte Persönlichkeiten kennen lernen
Jahrhunderts Einblick in Notations- und Kompositionsweisen gewinnen (Musik zwi-
schen Form und Freiheit)
8
Jazz Einflüsse des Jazz auf andere Bereiche der Musik nachvollziehen (dabei
Anwendung des Wissens zum Thema „musikalische Merkmale erkennen,
beschreiben“
Gymnasium6
Jgst Lehrplan- Ziele und Inhalte
rubrik
11/12 Musik und
Tradition Umgang mit Konventionen
10 Musik im Kon-
Musikalische Neuansätze ab dem 20. Jahrhundert
text
neues musikalisches Material und neue Organisationsformen
verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit der Tradition
Musik und ihre
Grundlagen Stilmittel der Musik ab dem 20. Jahrhundert
9 Musikpraxis: sich bei Höraufgaben auf einen längeren Werkausschnitt konzentrieren
musikalische Zusammenhänge beim Hören vollständiger Werke begrei-
Musik hören
fen
5
https://www.isb.bayern.de/realschule/lehrplan/realschule-r6/
6
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/lehrplan/gymnasium/
Seite 43. Informationen zum Werk
Grundlage von Leonard Bernsteins zweiter Symphonie ist The Age of Anxiety. A Baroque
Eclogue, ein Langgedicht des britisch-amerikanischen Dichters W. H. Auden (1907-1973).7
Es erschien 1947 im Druck und wurde 1948 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Bern-
stein war nach eigenen Angaben sofort fasziniert von dem Stoff und beschloss, ihn zu
vertonen. Zunächst dachte er an ein Ballett, ließ sich aber dann dazu überzeugen, die
Lektüreeindrücke zu einem Werk für den Konzertsaal zu verarbeiten.8 Den Kompositions-
auftrag erteilte Serge Koussevitzky, Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra und
Bernsteins langjähriger Mentor; ihm ist die Symphonie auch gewidmet. Das Werk entstand
in den Jahren 1948/49, parallel zu einer regen internationalen Reisetätigkeit Bernsteins als
Dirigent. Uraufgeführt wurde The Age of Anxiety am 8. April 1949 mit dem Boston Sym-
phony Orchestra unter der Leitung von Koussevitzky, Bernstein selbst übernahm den Part
des Solopianisten.
Zum Zeitpunkt der Uraufführung war Bernstein war 31 Jahre alt und hatte einen eindrucks-
vollen Aufstieg hinter sich. Als Komponist konnte er bereits auf drei große Uraufführungen
zurückblicken: 1944 waren seine erste Symphonie Jeremiah, das Ballett Fancy Free und
das Musical On the Town in New York uraufgeführt worden. Als Gastdirigent hatte er mit
fast allen größeren Orchestern der USA zusammengearbeitet, ab 1947 begann mit Enga-
gements in Montreal, London, Prag, Paris, Brüssel und Tel Aviv seine internationale Diri-
gentenkarriere.9 Auch als Solopianist und Liedbegleiter war Bernstein bereits in jungen
Jahren gefragt. Während der 1950er Jahre avancierte er dann zu einem der weltweit be-
gehrtesten Musiker.
Bernstein schuf mit The Age of Anxiety ein Werk, das in seiner klanglichen Gestalt auch
für ein weniger geübtes Publikum gut zugänglich sein müsste: Die Symphonie ist mit 30
Minuten Dauer von sehr überschaubarer Länge. Wie alle Kompositionen Bernsteins ist die
Musik harmonisch zwar mit Chromatik und Dissonanzen angereichert, aber dennoch tonal
und auf Dreiklangsharmonik basierend konzipiert.10 Farbenreiche Orchesterklänge, der
fast immer unmittelbar „gestische“ Duktus der musikalischen Motive, die an vielen Stellen
recht eingängige Melodik und Rhythmik sowie Einflüsse aus der Unterhaltungsmusik sind
weitere Merkmale der Musik, die „niedrigschwellige“ Zugänge möglich machen müssten.
7
Auden 2011.
8
Schüssler-Bach 2018.
9
Hamm 1999.
10
Vgl. Hamm 1999.
Seite 5Formal wie gattungsmäßig ist Bernsteins zweite Symphonie nicht leicht einzuordnen.11 Der
Komponist bezeichnet sein Werk zwar ausdrücklich als „Symphonie“, knüpft aber nicht an
das romantische Ideal reiner Instrumentalmusik an. Betrachtet man Titel, Besetzungen und
Programmatik von Bernsteins drei Symphonien, so steht zu vermuten, dass er die Bezeich-
nung „Symphonie“ eher in der Nachfolge Gustav Mahlers auffasste: Keines der Werke
(erste Symphonie: Jeremiah, 1942; zweite Symphonie: The Age of Anxiety, 1948; dritte
Symphonie: Kaddish, 1963), steht in der traditionellen viersätzigen Form – zumindest nicht
in unmittelbar erkennbarer Weise. Auch die Besetzung sprengt den traditionellen Rahmen:
In der zweiten Symphonie tritt ein Klaviersolist zum Orchester, in der dritten kommen Spre-
cher, Gesangssolisten und zwei Chöre hinzu. Jeder der Symphonien liegt ein außermusi-
kalisches Programm zugrunde. Dabei verfolgte Bernstein immer den Anspruch, sich so-
wohl ästhetischen und gestalterischen Ansprüchen zu stellen, die sich aus der traditions-
reichen Geschichte der Gattung "Symphonie“ ergeben, als auch weltanschauliche und spi-
rituelle Anliegen einfließen zu lassen.12 In allen seinen Symphonien befasst er sich mit der
Krise des Glaubens als zentralem Thema des 20. Jahrhunderts13 und gibt sich dabei
gleichermaßen als weltanschaulich liberaler Pazifist zu erkennen wie als „hymnensingen-
der Gottsucher“.14
Gedicht und Symphonie The Age of Anxiety können als „Sinnbild für eine ganze Genera-
tion“ aufgefasst werden, die die Welt aus der Perspektive der USA nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs betrachtet: verunsichert durch die Schrecken der Shoah, geprägt von
Orientierungslosigkeit nach dem Ende der Kampfhandlungen und beeinflusst durch das
gesellschaftliche Klima der beginnenden antikommunistischen McCarthy-Ära.15 Darüber
hinaus kann der Titel aber auch auf die „Sieben Lebensalter des Menschen“ bezogen wer-
den, denen sich der zweite Abschnitt von Gedicht und Symphonie explizit widmet: den
Entwicklungsphasen des Menschen von der Kindheit über das Erwachsenenalter bis hin
zu Alter und Hinfälligkeit, mit all ihren Unsicherheiten und inneren Verwerfungen.
Existenzielle Verunsicherung, Verlorenheit und soziale Vereinzelung sind am Beginn von
Bernsteins Symphonie durch ein solistisches Klarinetten-Duo im ppp eindrucksvoll musi-
kalisch in Szene gesetzt. Der Komponist selbst sprach von „der einsamsten Musik, die ich
kenne.“16 Diese „Einsamkeitsmusik“ basiert auf einer melodische Wendung, die für die
11
Deshalb auch vom Thematisieren dieser Fragen in einem Unterrichtsbaustein abgesehen: Um die Beson-
derheiten von Bernsteins Komposition würdigen zu können, muss man bereits recht gut mit den Normen
und Konventionen der Gattungen Symphonie und Klavierkonzert vertraut sein, was bei den meisten Schü-
lern nicht der Fall sein dürfte. Ähnliches gilt für das Prinzip der Variation. Der inhaltliche Schwerpunkt des
Materials liegt deshalb auf Beziehungen zwischen Bernsteins Musik und dem ihr zugrunde liegenden
Programm.
12
Braider 1998.
13
Wilker 2017.
14
Schüssler-Bach 2018.
15
Frei 2017, Wilker 2017.
16
Vgl. Wilker 2017, S. 93.
Seite 6Gesamtarchitektur der Sinfonie
von zentraler Bedeutung ist:
Dazu komplementär gestaltet Bernstein ein „Reinheitsthema“,17 das im Epilog als musika-
lischer wie spiritueller Gegenentwurf zum Hauptthema eingeführt wird und sich am Ende
durchsetzt:
Ein drittes zentrales thematisches Element ist erstmals am Ende des Prologs zuhören:
eine auf unbetonter Zählzeit beginnende, absteigende Skala, die alle 12 Töne der Klavia-
tur enthält, aber nicht chromatisch ist:
Bernstein beschrieb diese Linie als musikalisches Sinnbild eines Abstiegs zum Unbewuss-
ten.18 Am Ende des Epilogs erklingt sie machtvoll in umgekehrter Richtung und kann dann
als Symbol einer „Bewusstwerdung“ gedeutet werden.19
Bernstein entschied sich für eine romantisch-symphonische Orchesterbesetzung, die er
mit zwei Klavieren und Schlagwerk anreicherte, was eine Reihe zusätzlicher, klanglich
reizvoller Möglichkeiten eröffnet:
Piccolo Percussion
Flöte I, II Snare Drum, Bass Drum
Tenor Drum, Tam-Tam
Oboe I, II
Becken, Temple Blocks
Englischhorn
Klarinette in A (Bb) I, II Triangel, Glockenspiel
Bassklarinette in Bb Xylophon, Celesta
Harfe
Fagott I, II
Pianino (im Orchester)
Kontrafagott
Horn in F I, II, III, IV Piano (Solo)
Trompete in C I, II, III Violine I, II
Viola
Posaune I, II, III
Violoncello
Tuba
Bass
Pauken
17
Bernstein o. J. (1950), S. III.
18
Bernstein o. J. (1950), S. II.
19
Wilkers 2017, S. 93.
Seite 7Der anspruchsvolle Part des Solopianisten, der The Age of Anxiety zugleich auch als Kla-
vierkonzert erscheinen lässt, ist nach Aussage des Komponisten autobiografisch inspiriert
und fügt Audens Diagnose kollektiver Befindlichkeit einen individuellen Aspekt hinzu: „Ich
glaube, dass das Konzept einer Sinfonie mit Soloklavier aus meiner persönlichen Identifi-
kation mit dem Gedicht resultiert. So gesehen repräsentiert der Pianist den autobiographi-
schen Protagonisten, der gleichsam vor einem orchestralen Spiegel steht, in dem er sich
analytisch in modernem Ambiente betrachtet.“20
Der Titel und der Verweis auf das gleichnamige Gedicht von W. H. Auden sowie das eng
an Audens Text geknüpfte außermusikalische Programm, das Bernstein im Vorwort der
Partitur entfaltet,21 rücken die Komposition in die Nähe zur Sinfonischen Dichtung. Die
Verknüpfung zwischen Sprache und Musik geht dabei sehr weit: Audens Gedicht vereint
sprachlich virtuos verschiedenste Ebenen von der kunstvollen Lyrik bis hin zu umgangs-
sprachlichen Wendungen; damit korrespondiert die enorme stilistische Bandbreite, die Le-
onard Bernstein in den engen zeitlichen Rahmen seiner Symphonie integrierte. Sie reicht
von Anklängen an Mahler und Brahms über Zwölftontechnik bis hin zu Anklängen an Film-
musik; im Abschnitt The Masque bezieht er zeitgenössische Jazz-Elemente in den sym-
phonischen Kontext ein und folgt damit dem Vorbild von George Gershwins Rhapsody in
Blue. In The Seven Stages inszeniert Bernstein eine „innere Reise“ bzw. „Traum-Odyssee“
der vier Protagonisten der Handlung22 als „musikhistorisches Traumbild“, in dem in rascher
Folge Passagen in den musikalischen Personalstilen namhafter Vertreter der klassischen
Moderne vorbeiziehen: Bartók, Strawinsky, Prokofjew, Schönberg, Britten und Schostako-
witsch.23
Dieses auch für Bernsteins spätere Kompositionen noch charakteristische Einbeziehen
sehr heterogener musikalisch-historischer Stilmittel trug ihm wiederholt den Vorwurf des
Epigonalen und des Eklektizismus ein. Er selbst verteidigte dieses Vorgehen: „Wen auch
immer man sich anschaut, einschließlich Bach und Beethoven, man kann ihm den Vorwurf
des Eklektizismus machen. Je größer der Komponist, desto einfacher kann man ihm Ek-
lektizismus nachweisen. […] Wer bist Du, wenn du nicht die Summe aus der Vergangen-
heit ziehst?“24 Die musikalisch heterogenen Einzelkomponenten stehen niemals unverbun-
den nebeneinander, sondern sind durch vielfältige motivisch-thematische Bezüge zu ei-
nem organischen Ganzen verflochten.
20
Bernstein 1993, zit. n. Wilker 2017, S. 93.
21
Bernstein o. J. (1950).
22
Bernstein o. J. (1950), S. II.
23
Wilker 2017, S. 94.
24
Wilker 2017, S. 100.
Seite 8Nicht nur durch die engen programmatischen Bezüge, sondern auch im formalen Gesamt-
konzept seiner Symphonie orientiert sich Bernstein an Audens Langgedicht. Dieses be-
steht aus sechs Teilen, die je eine Überschrift tragen und so auch in Bernsteins Partitur
erscheinen. Bernstein weicht allerdings auch von Audens formalen Konzept ab: Er fasst
jeweils drei dieser Teile zu einem zusammenhängenden musikalischen Satz zusammen,
die musikalischen Proportionen entsprechen nicht denen des Texts. Bernsteins beide
Sätze sind etwa gleich lang, was den Teilen Dirge, Masque und Epilogue deutlich höheres
Gewicht verleiht, als sie es in Audens Dichtung haben. Dem recht kurzen Prologue folgt
der zeitlich ausgedehnteste Abschnitt, The Seven Ages. Die übrigen Teile sind mit einer
Dauer von je ca. 5 Minuten zeitlich alle in etwa gleich gewichtet:
W. H. Auden, The L. Bernstein, The Age of Anxiety (1949) Dauer26
Age of Anxiety
25
(1947)
Part One: Prologue Part I The Prologue 2:20
(S. 3-21) Lento moderato
The Seven Ages 8:23
Part Two: The Seven
Ages (S. 23-46) L’istesso tempo
The Seven Stages 5:52
Part Three: The
Seven Stages (S. 47- Molto moderato, ma movendo
81)
Part Four: The Dirge Part II The Dirge 5:38
(S. 83-86) Largo
The Masque 4:27
Part Five: The
Masque (S. 87-102) Extremely fast
The Epilogue 5:20
Part Six: Epilogue (S.
103 – 108) L’istesso tempo
Betrachtet man den zweiten Teil der Symphonie genauer, so liegt der Schluss nahe, dass
Bernsteins Abweichung von Audens Disposition auch mit der Absicht begründet sein
könnte, an die traditionellen Satztypen der klassisch-romantischen Symphonie anzuknüp-
fen: Part I entspräche dann einem sehr ausgedehnten, in der Form frei gestalteten Kopf-
satz mit langsamer Einleitung. Part II enthält die Pendants zum langsamen Satz (The
Dirge), zum Scherzo (The Masque) und zum Finalsatz, der in eine hymnisch-triumphale
25
Vgl. Auden (2011)
26
Dauern aus Bernstein 1950/ 1998 (Einspielung unter Leitung des Komponisten)
Seite 9Apotheose mündet.27 Interessanterweise ist ausgerechnet das vom zeitgenössischen Jazz
inspirierte The Masque für Klavier und Percussionsinstrumente, das beim ersten Hören als
hektische Abfolge rasch wechselnder musikalischer Elemente erscheint, in Sonatensatz-
form gestaltet.
Zudem nützt Bernstein die formbildende Kraft unterschiedlicher harmonischer Ausdrucks-
mittel und -intensitäten: Beginn und Ende der Symphonie sind klar tonal gestaltet, auf Ba-
sis von Dreiklangsharmonik, die mit Chromatik und Dissonanzen angereichert ist. In Pro-
logue und Variation I erzeugt der Komponist eine archaisch anmutende Atmosphäre, der
Epilog erinnert in seiner opulenten Harmonik eher an symphonische Filmmusik. In The
Dirge (Klagegesang), am Punkt größter zeitlicher Entfernung zu beiden Polen und als äu-
ßerster Kontrast zu ihnen, wird dodekaphones Material verarbeitet und „der Zustand der
Verlorenheit nach dem Verlust einer Vaterfigur […] mit den Mitteln der Dissonanz und Ato-
nalität dargestellt.“28 Die Variationsfolgen des ersten Teils und The Masque in Teil 2 bilden
mit ihren komplexen, aber stets noch tonal gebundenen harmonischen Abläufen jeweils
eine Art Brücke zwischen den Extremen.
Auch in den Variationssätzen The Seven Ages und The Seven Stages handhabt Bernstein
ein tradiertes musikalisches Gestaltungsprinzip auf unübliche Weise: Die Variationen ver-
arbeiten kein gemeinsames Thema, sondern sind in assoziativer Art miteinander verkettet:
Jede Variation greift ein Element der jeweils vorhergehenden auf und entwickelt es weiter.
Musikalische Einheit entsteht unter anderem durch das kontinuierliche Aufscheinen von
Hauptthema und Skalen-Motiv in verschiedenen Verarbeitungen.
27
Wilker 2017, S. 94 f.; o. J. (1950), S. III.
28
Wilker 2017, S. 95.
Seite 104. „Vier einsame Menschen in einer Bar“ – der Prolog
Dauer: Je nach Leistungsfähigkeit der Gruppe und gewähltem Vorgehen ca. 30 Minuten
Ziele
Die Schülerinnen sollen
einen ersten Eindruck der Klanglichkeit von Leonard Bernsteins Musik erhalten,
einen inhaltlichen Einstieg in das Werk bekommen,
den Beginn der Symphonie genau kennenlernen.
Materialien
Aufnahme des Prologs (bis zum Ende der Flöten-Melodie, zwei Takte vor Var. I, ca.
2’15)
Projektion: Bar-Szenen (siehe Anhang)
Vorgehen
„Der Dichter und der Komponist Leonard Bernsteins erzählen uns gemeinsam eine Ge-
schichte. Das Geschehen beginnt an einem Novemberabend in einer New Yorker Bar.
Welche Stimmung herrscht dort
– welches Bild passt?“
Zeigen der Projektion und Vor-
spielen des Prologs bis Ende
von Takt 6 (nach ca. 28“)
Kurzes Gespräch: Warum passt
(nur) das Bild des Einsamen?
(Instrumentierung, Tempo, ext-
rem zurückgenommene Laut-
stärke, Tonalität, „leere“ Zusam-
menklänge etc.)
„In dieser Bar halten sich vier
Menschen auf, die sich bisher
nicht kannten. Nach einiger Zeit
kommt ein Gespräch in Gang.“
Seite 11 Einteilen der Schülerinnen in Gruppen à 5-6.
Auftrag: „Baut ein Standbild und orientiert euch dabei an der Musik!
Stellt euch die vier Personen möglichst genau vor. Wie sehen sie aus? Wie alt sind sie?
Wie sehen sie aus, unmittelbar bevor der erste zu sprechen beginnt? Wie sind sie im
Raum verteilt? Stehen sie nebeneinander an der Bar? Sitzen sie einzeln an Tischen?
Wie stehen bzw. sitzen sie im Verhältnis zueinander? Sie müssen einerseits ‚einsam‘
sein, sie sind sich ja nie zuvor begegnet. Andererseits muss es möglich sein, ein Ge-
spräch zu beginnen. Probiert verschiedene Möglichkeiten!“
Schritt 1: Anhören des gesamten Prologs, ohne bereits aktiv zu werden & ohne zu
sprechen; möglichst genaues Vorstellen der Akteure und der Szene!
Schritt 2: Ausprobieren in der Gruppe, ohne Musik (ca. 5 Minuten).
Schritt 3: Erproben des Gefundenen mit Musik (ca. 3 Min.)
Schritt 4: Präsentation der entwickelten Lösungen im Plenum, zur Musik (10-12 Min.).
Welche Lösung, welches Lösungselement überzeugt am meisten? (Kriterien: Plausibi-
lität, möglichst gute Passung von Haltung, Mimik, evtl. auch Gestik zur Musik und zum
Thema!)
Weiterführung: Gemeinsame Überlegung: Worum könnte es im Gespräch der Vier ge-
hen? Welche Themen, welche Ereignisse wären nach einem solchen Einstieg zu erwar-
ten? – Hier lässt sich der nächste Unterrichtsbaustein anschließen.
Seite 125. „Dichtung illustrieren, erweitern, verdeutlichen“ – Bezüge
zwischen Programm und Musik im Überblick
Dauer: Je nach Leistungsfähigkeit der Lerngruppe und gewähltem Vorgehen ca. 90 Minu-
ten.
Ziele
Die Schüler*innen sollen
einen Überblick über den Verlauf der Symphonie bekommen,
einzelne Abschnitte genauer kennenlernen,
einige Zusammenhänge zwischen außermusikalischem Programm und musikali-
scher Gestaltung erschließen.
Materialien
Hörbeispiele:29
o HB 1: Beginn von Part I („Prologue“, Klarinetten-Duo), bis ca. 0’43 (Takt 11)
o HB 2: Beginn von Part I, Abschnitt 2 (The Seven Ages, Klavier-Solo), bis ca.0‘43);
o HB 3: Beginn von Part II (The Dirge), Anfang bis ca. 0’40 (Takt 8/ vor dem Klavier-
einsatz)
o HB 4: Beginn von Part II, Abschnitt 2 (The Masque), Anfang bis ca. 0’34 (Ziffer 11)
o HB 5: Part II, Ende von Abschnitt 3 („Epilogue“), ca. 3’20 (Ziffer J, Streicher/ Flöte/
Harfe)
Sortierkarten: Abschnitte der Handlung, Beschreibung der Musik, Wellenform-Bilder,
Themen (siehe Anhang)
o Auswahl je nach gewünschtem Vorgehen und Leistungsfähigkeit der Klasse
o Verwendung auf dem Overhead-Projektor, evtl. auch ausgedruckt als Grund-
lage für Kleingruppenarbeit (1 Kartensatz pro Gruppe)
Vorgehen:
Einstieg im Plenum: Erkunden zweier kontrastierender Ausschnitte:
Zeigen der beiden Textkarten „Prolog“ und „Epilog“ sowie der Beschreibungskarten 1
und 5; Anhören von HB 1 und 5 → Was gehört zusammen?
29
Alle Taktangaben beziehen sich auf die 1950 in New York erschienene Partitur (Bernstein o. J. (1950),
Zeitangaben auf die ebenfalls 1950 entstandene Aufnahme des Werks mit dem New York Philharmonic
Orchestra unter Leitung des Komponisten (Bernstein 1950/1998).
Seite 13 Information durch die Lehrkraft:
Leonard Bernsteins zweite Symphonie heißt „The Age of Anxiety“. Das lässt sich mit
„Das Zeitalter (oder Lebensalter) von Unsicherheit und Angst“ übersetzen.
In dieser Symphonie wird mit musikalischen Mitteln eine Geschichte erzählt: Vier ein-
same Menschen treffen sich in den 1940er Jahren zufällig in einer New Yorker Bar.
Sie alle leben in einer unsicheren Zeit und blicken ängstlich in die Zukunft. So kommen
sie ins Gespräch. Miteinander durchleben sie einen Abend und eine Nacht.
Am Ende haben zumindest einige von ihnen einen Ausweg aus ihrem Unglück und ihrer
Verunsicherung entdeckt.
Wie verläuft diese Nacht? In welcher Reihenfolge geschehen die Ereignisse?
Sortieraufgabe (Gruppenarbeit, alternativ: Plenum): Vorspielen aller 5 Musikbeispiele
(einschließlich der bereits bekannten), in der richtigen Reihenfolge. -> Was gehört zu-
sammen? In welcher Reihenfolge? Ordnet die Karten richtig zu!
Gemeinsames Besprechen, dabei nach Bedarf nochmaliges Anhören der Ausschnitte
und ergänzende Informationen durch die Lehrkraft.
Zum Abschluss: Anhören des gesamten letzten Teils (Epilog) im Zusammenhang
(Dauer ca. 5’15). Evtl. Mitzeigen im Wellenform-Bild (M##).
Inhaltliche Information dazu:
Hier ist der positive Wendepunkt der Geschichte zu hören:
Zuerst verbreitet das Klavier nochmals hektische, jazzige Partystimmung.
Schon bald kommt aber eine ruhige Trompeten-Melodie dazu, mit der der Komponist
eine Lösung für alle Probleme ausdrücken wollte. Diese Melodie setzt sich allmählich
gegen das Chaos durch.
Am Ende spielt fast das gesamte Orchester diese Melodie, die für Leonard Bernstein
„Reinheit“ symbolisiert.
Leitfrage: Wie könnte die „Lösung“ der persönlichen Probleme, die die vier Personen
der Handlung entdeckt haben, aussehen? Was könnte gemeint sein?
(Weiterführende Überlegung: Eine Lösung ist zwar gefunden. Das Einsamkeits-
Thema vom Anfang ist aber auch immer noch zu hören. Das Happy End ist also in der
Musik strahlend, aber nicht perfekt. Wie lässt sich dies deuten?)
Seite 146. „Ich kann keinen Tag ohne Musik leben“: Wer war Leonard
Bernstein?
Dauer: Je nach Leistungsfähigkeit der Lerngruppe ca. 30 Minuten.
Ziel
Die Schülerinnen sollen einen Eindruck bekommen von der Vielseitigkeit des „musikali-
schen Universalgenies“ Leonard Bernstein
Materialien
Arbeitsblatt mit Kreuzworträtsel „Ich kann keinen Tag ohne Musik leben“: Wer war Le-
onard Bernstein?
Rundfunksendung „25. August 1918: Leonard Bernstein wird geboren“, Quelle:
https://www.br-klassik.de/audio/whg-25081918-leonard-bernstein-wird-geboren-
100.html (Dauer: 2:34)
Vorgehen
Plenum:
Austeilen des Kreuzworträtsels
Einstieg mit Anhören der Rundfunksendung
Einzel- oder Partnerarbeit:
Anschließend erlesen sich die Schüler*innen die noch fehlenden Informationen aus
der Quelle https://www.br-klassik.de/programm/sendungen-a-z/mittagsmusik/portraet-
leonard-bernstein-100.html
Plenum:
Besprechung der Lösung.
Weiterführende Möglichkeit: Gemeinsames Anschauen des Abschnitts The Masque (als
des bekanntesten Ausschnitts) aus The Age of Anxiety. Video mit dem London Symphony
Orchestra und Krystian Zimerman, Piano, unter Leitung des Komponisten:
Online zugänglich unter https://www.youtube.com/watch?v=SWK6iNROqYQ, Dauer: 2’45.
Das Stück kann als prototypisch für Bernsteins zweite Symphonie wie für seine Musik ins-
gesamt verstanden werden: Stilistisch enthält es deutliche Anklänge an den New Yorker
Jazz der 1930er und 1940er Jahre, formal folgt es den Vorgaben der Sonatensatzform.
Bernstein ist im Video einerseits als Dirigent repräsentiert, andererseits als Komponist, der
sich einerseits über Genregrenzen hinwegsetzte und andererseits souverän über die
„Handwerkstechniken“ der klassischen Komposition verfügte.
Seite 157. Bildnachweise, Literatur und Links
7.1 Bildnachweise
Titelseite: Leonard Bernstein, 1955
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonard_Bernstein_NYWTS_1955.jpg
Bar-Szenen:
“Charlie's Tavern, New York, N.Y., between 1946 and 1948”,
Quelle: https://loc.gov/item/gottlieb.10331
Øystein Alsaker: “Lonely coffee in an empty café”,
Quelle: https://www.flickr.com/photos/oalsaker/5345810039/
“O'Reilly's bar on Third Avenue in the Fifties”,
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:O%27Reilly%27s_bar_on_Third_Ave-
nue_in_the_Fifties_8d21771v.jpg
Arbeitsblatt “Kreuzworträtsel”:
Leonard Bernstein, 1971
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonard_Bernstein_1971.jpg
Alle anderen Abbildungen: G. Puffer
7.2 Literatur
Auden, Wystan H.; Jacobs, Alan (Hg.) (2011): The age of anxiety. A baroque eclogue.
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press (W. H. Auden).
Bernstein, Leonard (o. J. (1950)): The Age of Anxiety. Symphony No. 2 for Piano and Or-
chestra. {after W. H. AUDEN). New York: G. Schirmer, Inc.
Bernstein, Leonard (1950/1998): The Age of Anxiety (Symphony Nr. 2). Lukas Foss. New
York Philharmonic. Unter der Leitung von Leonard Bernstein. CD: Sony Music Enter-
tainment Inc.
Braider, Jackson (1950/1998): Ein Schritt weiter. In: Leonard Bernstein: The Age of Anxi-
ety (Symphony Nr. 2). New York Philharmonic. Unter der Leitung von Leonard Bern-
stein: Sony Music Entertainment Inc.
Seite 16Frei, Marco (2017): Gilles Vonsattel über "The Age fo Anxiety" von Leonard Bernstein. In:
Abendzeitung, 14.03.2017. Online verfügbar unter https://www.abendzeitung-muen-
chen.de/inhalt.muenchner-philharmoniker-gilles-vonsattel-ueber-the-age-fo-anxiety-von-
leonard-bernstein.ce6ea78d-99c2-4426-bd88-cf9f0572ba8e.html [30.4.18].
Gentry, Philip (2011): Leonard Bernstein's The Age of Anxiety: A Great American Sym-
phony during McCarthyism. In: American Music 29 (3), S. 308–331. Online verfügbar
unter https://muse.jhu.edu/article/456575/pdf [30.4.18].
Hamm, Charles (1999): Bernstein, Leonard. In: Ludwig Finscher und Friedrich Blume
(Hg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2., neubearb. Ausg. 26 Bände. Kassel:
Bärenreiter (Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Personenteil 2: Bag-Bi), Sp. 1419–
1422.
Oja, Carol J. (2007): Leonard Bernstein, Symphony No. 2, "The Age of Anxiety". Written
for the concert Making Music: Composer-Conductors, performed on Feb 9, 2007 at
Avery Fisher Hall at Lincoln Center. American Symphony Orchestra. Online verfügbar
unter http://americansymphony.org/symphony-no-2-the-age-of-anxiety-194965/
[30.4.18].
Schüssler-Bach, Kerstin (2018): Bernstein, Leonard: Symphony No.2: The Age of Anxiety
(1949) 36' for piano and orchestra, after WH Auden. Online verfügbar unter
https://www.boosey.com/pages/cr/catalogue/cat_detail?site-lang=de&musicid=7138
[30.4.18].
Tommasini, Anthony: Not Just ‘West Side Story’: Celebrating Bernstein’s Symphonies.
Online verfügbar unter https://www.nytimes.com/2017/10/20/arts/music/leonard-bern-
stein-new-york-philharmonic.html [30.4.18].
Wallin, Sarah: Bernstein - The Age of Anxiety, Symphony No. 2 (after W.H. Auden). On-
line verfügbar unter http://programnotes.wikia.com/wiki/Bernstein_-
_The_Age_of_Anxiety,_Symphony_No._2_(after_W.H._Auden) [30.4.18].
Wilker, Ulrich (2017): Krisenszenarien und Weltanschauungsmusik: Bernsteins Sinfonien.
In: Andreas Eichhorn (Hg.): Leonard Bernstein und seine Zeit. Laaber: Laaber-Verlag
(Große Komponisten und ihre Zeit), S. 86–102.
Seite 177.3 Weblinks
Rundfunksendungen über Leonard Bernstein:
„Das Kalenderblatt“: Leonard Bernstein dirigiert zum ersten Mal die New Yorker Philhar-
moniker
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/leonard-bernstein-dirigiert-
zum-ersten-mal-new-yorker-philharmoniker-100.html Dauer: 3:46
25. August 1918: Leonard Bernstein wird geboren
https://www.br-klassik.de/audio/whg-25081918-leonard-bernstein-wird-geboren-100.html
(Dauer: 2:34)
9. Mai 1948: Leonard Bernstein gibt sein erstes Konzert in Deutschland
https://www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/was-heute-geschah-leonard-bern-
stein-bayerische-staatsoper-konzert-100.html
"Ich kann keinen Tag ohne Musik leben"
https://www.br-klassik.de/programm/sendungen-a-z/mittagsmusik/portraet-leonard-bern-
stein-100.html
Leonard Bernstein – der Musikvermittler
https://www.br-klassik.de/audio/klassik-stars-zum-anhoeren-leonard-bernstein-100.html
Videos:
Offizieller Youtube-Channel über Leonard Bernstein: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCGmGJfwD5NaYvJt57mc1fVw
Leonard Bernstein dirigiert "The Masque" aus "The Age of Anxiety":
https://www.youtube.com/watch?v=SWK6iNROqYQ
Video mit dem London Symphony Orchestra und Krystian Zimerman, Piano, unter Leitung
des Komponisten
Seite 188. Anhang Arbeitsblätter und ergänzende Materialien
5. Sortierkarten
Trauergesang Maskerade
Prolog
Die vier beklagen den Verlust des großen Die Gruppe will eine Party feiern, aber alle sind
Vier einsame Menschen – eine junge Frau und
"Übervaters" (der in Wahrheit nie existiert müde und voller Schuldgefühle. Aus Angst, den
drei Männer – sitzen in einer Bar. Sie alle sind
hat): Sie vermissen einen großen Anführer, der anderen den Spaß zu verderben, mag keiner
verunsichert, hängen ihren Gedanken nach
immer weiß, wo das Problem liegt, der stets zugeben, dass er eigentlich nach Hause und ins
und versuchen, sich durch Trinken von ihren
eine Lösung findet, und der ihnen alle Bett möchte. Die Vier sind einerseits in
Problemen abzulenken.
Verantwortung abnimmt. Partystimmung, andererseits nervös und
Epilog
Die sieben Lebensalter
Nach einer durchwachten, durchfeierten und
Die vier einsamen Barbesucher kommen ins durchdiskutierten Nacht haben die vier Gefährten Klarheit
Gespräch. Sie reden über die „sieben gewonnen. Ihnen ist deutlich geworden, dass ihr Glaube
Lebensalter“ des Menschen, beginnend mit ihnen helfen wird, aus ihrer Einsamkeit und Unsicherheit
der Kindheit. herauszufinden. Alle finden sich zusammen zu einer
zuversichtlichen Aussage neu erlebten Glaubens.In einem kurzen Klavier‐Solo wird ein
Dies ist der Beginn eines hektisch‐nervösen
Zwölfton‐Akkord aufgeschichtet.
und dynamisch sehr kontrastreichen Stücks:
Zwei Solo‐Klarinetten spielen leise und in Nach oben hin wird diese Tonfolge immer
Klavier und Percussionsinstrumente spielen in leiser: Eine selbstsichere Behauptung, die in
getragenem Tempo eine melancholische
hohem Tempo und äußerst virtuos zusammen. eine Frage mündet?
Melodie
Deutlich hörbar sind Jazz‐Elemente
Es folgt eine Art Trauermarsch, der
eingebettet.
klanglich von den Oboen dominiert wird
Die Streicher spielen eine sanfte Melodie, Am Beginn steht ein etwa 40 Sekunden
die Heiterkeit und Zuversicht ausstrahlt, dauerndes Klavier‐Solo, das die Klarinetten‐
ähnlich dem Happy End in Filmmusiken. Melodie aus dem Prolog aufgreift und
Allmählich kommt das ganze Orchester weiterführt.
hinzu.
Später kommt das Orchester dazu, Celesta
Das Werk endet mit einer großen und Glockenspiel setzen glitzernde
Schlusssteigerung. Klangakzente.5. Lösung:
Prolog
Vier einsame Menschen – eine junge Frau
Zwei Solo-Klarinetten spielen leise und
und drei Männer – sitzen in einer Bar. Sie
in getragenem Tempo eine
alle sind verunsichert, hängen ihren
melancholische Melodie
Gedanken nach und versuchen, sich durch
Trinken von ihren Problemen abzulenken.
Dies ist der längste Abschnitt der
Die sieben Lebensalter
Symphonie.
Die vier einsamen Barbesucher Am Beginn steht ein etwa 40
kommen ins Gespräch. Sie reden über Sekunden dauerndes Klavier-Solo,
die „sieben Lebensalter“ des das die Klarinetten-Melodie aus dem
Menschen, beginnend mit der Kindheit. Prolog aufgreift und weiterführt.Trauergesang In einem kurzen Klavier-Solo wird
Die vier beklagen den Verlust des ein Zwölfton-Akkord aufgeschichtet.
großen "Übervaters" (der in Wahrheit Nach oben hin wird diese Tonfolge
nie existiert hat): Sie vermissen einen immer leiser: Eine selbstsichere
großen Anführer, der immer weiß, wo Behauptung, die in eine Frage
das Problem liegt, der stets eine mündet?
Lösung findet, und der ihnen alle Es folgt eine Art Trauermarsch, der
Maskerade Dies ist der Beginn eines hektisch-
nervösen Stücks, das wie ein
Die Gruppe will eine Party feiern, aber
dynamisch rasch wechselnden
alle sind müde und voller
„Klangband“ aussieht:
Schuldgefühle. Aus Angst, den anderen
den Spaß zu verderben, mag keiner Klavier und Percussionsinstrumente
zugeben, dass er eigentlich nach spielen in hohem Tempo und äußerst
Hause und ins Bett möchte. Die Vier virtuos zusammen.
Epilog Die Streicher spielen eine sanfte
Melodie, die Heiterkeit und
Nach einer durchwachten,
Zuversicht ausstrahlt, ähnlich dem
durchfeierten und durchdiskutierten
Happy End in Filmmusiken.
Nacht haben die vier Gefährten Klarheit
Allmählich kommt das ganze
gewonnen. Ihnen ist deutlich geworden,
Orchester hinzu.
dass ihr Glaube ihnen helfen wird, aus
ihrer Einsamkeit und Unsicherheit Das Werk endet mit einer großenLöse das Kreuzworträtsel mit Hilfe der Informationen, die du unter https://www.br-klassik.de/programm/sendungen-a-z/mittagsmusik/portraet-leonard-bernstein-100.html findest!
Sie können auch lesen