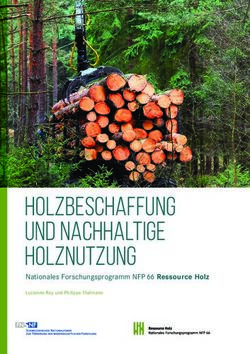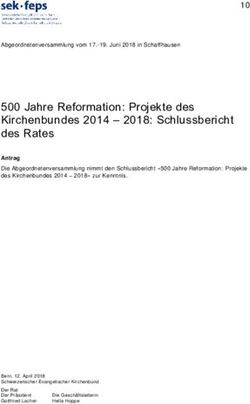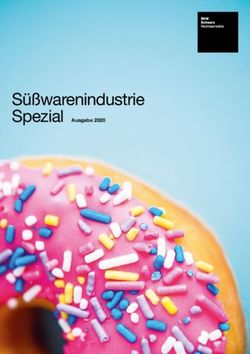Mythen und Märchen IMPacts Ausgabe 04 - Dezember 2012 - Alexandria (UniSG)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Editorial
ALTERNATIVE FOLGESEITE
Wahres und
Wesentliches
von Mythen und
Märchen abgrenzen
Christian Laesser
Mythen und Märchen – so der thematische Titel dieses Simone Strauf und Roland Scherer setzen sich mit einem
Heftes und abendfüllender TV Shows. Die Idee hierzu in Regional Science weitum verbreiteten wissenschaftli-
entstand anlässlich einer Diskussion in der Direktion des chen Ansatz – Wertschöpfungsstudien – auseinander. Sie
Instituts (nicht vor dem Fernseher). Wir waren uns einig, nehmen Kritik an diesen Studien auf und zeigen, wie der
dass unser Wissen in vielen Domänen eher auf nicht Ansatz in Richtung einer regionalen Zahlungsbilanz bzw.
hinterfragten und Wahrheit beanspruchenden Mythen weitergehenden Wirkungsanalyse weiterentwickelt werden
und – im vereinzelten schlimmsten Fall – auf über die kann, um so für Regionen aussagekräftigere Informatio-
Zeit immer weiter entwickelten und ausgeschmückten nen zu gewinnen.
Märchen basiert. Der Logos (als Gegensatz zum Mythos)
hat es zunehmend schwerer, da der Versuch, die Wahrheit Elisabeth Dalucas und Johannes Rüegg-Stürm postulie-
von Behauptungen mittels verstandesgemässer Beweise zu ren, das Potential des „Fiktionalisierens“, seine Spiel- und
begründen, immer mit einem vergleichsweise grösseren Gestaltungsmöglichkeiten systematischer für die Weiter-
Aufwand verbunden ist. Dazu kommt, dass gerade nicht- entwicklung von Organisationen auszuschöpfen. Sie ge-
faktenbasiertes Halbwissen oft mit der grössten Lautstärke hen davon aus, dass Organisationen ständig mit Fiktionen
verbreitet wird. arbeiten und dies überhaupt erst Entwicklung und Inno-
vation in Unternehmen ermöglicht.
In einem Zeitalter räumlicher und zeitlicher Ubiquität
von Information wird die Destillation von relevantem Kuno Schedler geht – im letzten Hauptartikel dieser
und faktenbasiertem Wissen (Logos) immer zentraler, Ausgabe – der Frage nach, wie es kommt, dass sich Or-
allerdings auch immer komplexer, da sich eben dieses ganisationen, die an sich in Wettbewerb stehen und auf
faktenbasierte Wissen erst aus der Wolke von Halbwissen der Suche nach Differenzierung sein sollten, in formal-
herausdifferenzieren muss. Was ist richtig (faktenbasiert)? organisatorischen Belangen oft sehr ähnlich sehen. Und
Was ist wichtig? Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, diese er liefert auch gleich den Schlüssel für die Antwort, basie-
Wolke zu lichten und herauszustreichen, auf was sich un- rend auf dem Neo-Institutionalismus: Institutionalisierte
ser Blick und unsere Aufmerksamkeit lenken sollten. Erwartungen, durch deren Erfüllung sich Organisationen
Der thematische Auftrag, das Thema dieses Heftes abtei- „legitimieren“. Und diese Erwartungen basieren oft auf
lungsspezifisch zu diskutieren wurde einmal mehr in der Mythen.
vollen Bandbreite der Möglichkeiten ausgeschöpft.
Wir wünschen eine interessante Lektüre
So räumt in einem ersten Beitrag der Schreibende zusam- und ein erfolgreiches Jahr 2013.
men mit seinem Kollegen Pietro Beritelli mit ein paar
alten Zöpfen aus dem Tourismus auf. In einem strecken-
weise eher polemischen Ansatz wird unter anderem nach-
gewiesen, dass das touristische Österreich in einem fairen
Vergleich mit der Schweiz nicht einfach besser ist, dass
Tourismus nur beschränkt nachhaltig sein kann, und dass
die grosse finanzielle Kelle - fokussiert auf die touristische Prof. Dr. Christian Laesser
Promotion - nur selten zielführend sein kann. Direktor IMP-HSG
IMPacts Ausgabe 04 I 1Inhalt
4 8 12 16
Mythen und Märchen Zum Mehrwert von Zur Funktion von Legitimation durch
im Tourismus – Einige Wertschöpfungsstudien Fiktion im Management Organisationale
(polemische) Kurzge- Mythen
schichten
Editorial 1
Inhalt 2
Mythen und Märchen im Tourismus –
Einige (polemische) Kurzgeschichten 4
Christian Laesser, Pietro Beritelli
Zum Mehrwert von Wertschöpfungsstudien 8
Simone Strauf, Roland Scherer
Zur Funktion von Fiktion im Management 12
Elisabeth Dalucas, Johannes Rüegg-Stürm
Legitimation durch Organisationale Mythen 16
Kuno Schedler
IMPactuel 20
Veranstaltungen und Publikationen
Eignerstrategie als Instrument zur Steuerung
öffentlicher Unternehmen 22
Roger W. Sonderegger
Mögliche Ansätze für Bergbahnen,
kalte in warme Betten zu transformieren 23
Samuel Heer, Christian Laesser
2 I IMPacts Ausgabe 04Inhalt
23 26 27 28
Mögliche Ansätze für Zum Zusammenspiel Zum Einsatz von Case The Sino-Swiss Manage-
Bergbahnen, kalte in grenzüberschreitender study teaching in der ment Training Program
warme Betten zu Netzwerke Lehre Action Learning pro-
transformieren gram in Inner Mongolia
Die Steuerung mit Kennzahlen in den
kreisfreien Städten Deutschlands 24
Isabella Proeller, Alexander Kroll
INTERREG IVB Projekt “TransNetAero” 25
Andreas Wittmer
Zum Zusammenspiel grenzüberschreitender Netzwerke 26
Roland Scherer
Zum Einsatz von Case study teaching in der Lehre 27
Martin Gutjahr, Simone Strauf
The Sino-Swiss Management Training Program Action
Learning program in Inner Mongolia 28
Josef Mondl
Die Rationalität der Aufgabenträger im regionalen
Busverkehr 29
Mirco Gross
Seminarankündigungen 30
Autorenverzeichnis, Impressum, Bildnachweis 32
IMPacts Ausgabe 04 I 3Mythen und Märchen im Tourismus – Einige (Polemische) Kurzgeschichten
Mythen und Märchen im
Tourismus – Einige (pole
mische) Kurzgeschichten
Christian Laesser, Pietro Beritelli
Tourismus ist global in einer Umbruchphase – mit Folgen für überrascht, dass unser Nachbarland in der Beurteilung der
die Schweiz. Stichwörter sind neue Märkte und neue Desti- Gäste besser abschneidet als die Schweiz, wenn man weiss,
nationen, ein sich schnell änderndes Kundenverhalten, eine dass Schweizer selbst bei einem nicht wie heute verzerrten
wachsende Zahl globaler Player auf der Anbieterseite und Wechselkurs
sich global verschiebende wirtschaftliche Gewichte. In solchen
Zeiten wird eine nüchterne Betrachtung auf den existieren- • in Österreich bei den Übernachtungen systematisch
den und zukünftigen Tourismus in der Schweiz zwingend. eine Klassifikationskategorie höher auswählen als in der
Wir machen dies in der Folge anhand einer Reihe von (mit- Schweiz;
unter etwas polemischen) Kurzgeschichten, in denen wir eini- • über 30% mehr ausgeben als in der Schweiz (pro Tag
ge im Raum stehende Thesen auf den Prüfstand stellen. und pro Aufenthalt);
• auch in Relation zu ihrem Einkommen mehr für einen
Es ist unbestritten: Die Schweiz hat touristisch sicherlich Urlaub in Österreich als in der Schweiz ausgeben und
Verbesserungspotential, auch wenn sie im touristischen damit ein höheres Involvement haben.
World Competitiveness Report konstant in den obers-
ten Rängen klassiert ist. In wiederkehrenden Vergleichen Zum Vergleich: Frankreich schneidet im Vergleich zur
(v.a. auch in den Medien) Schweiz systematisch schlechter ab.
der Gästezufriedenheit «Die Tourismusbranche ist genauso Und die Gründe sind die gleichen
scheint aber Österreich anders wie jede andere Branche.» wie oben, nur gehen sie in die andere
gegenüber der Schweiz Richtung (vgl. auch Tabelle).
regelmässig besser abzuschneiden. Was ist hier los? Schlussfolgernd muss in der Beurteilung der touristischen
Das Problem beider Beurteilungen (Competitiveness Re- Schweiz Augenmass behalten werden und es muss insbe-
port und Gästevergleich Österreich) ist, dass wir deren sondere klar werden, woran bzw. an welchem Benchmark
Grundlagen und Beurteilungsmechanismen zu wenig hin- die Schweiz genau bemessen wird.
terfragen. So ist die Rangierung im Competitiveness Re-
port v.a. von einer subjektiven Beurteilung infrastruktu- Reisen Reisen Reisen
nach nach
reller und politischer Gegebenheiten getrieben. Man muss Merkmal in die Öster- Frank-
Schweiz
sich also fragen, ob nicht weitere Komponenten ebenfalls reich reich
wichtig sind. Zufriedenheit mit Reise 0.87 0.88 0.78
insgesamt (-1 bis +1)
Zufriedenheit mit Destination
In Sachen Gäste-Beurteilung von Österreich ist zunächst 0.68 0.79 0.62
(-1 bis +1)
einmal festzustellen, dass insgesamt dieser Unterschied Zufriedenheit mit Unterkunft 0.76 0.83 0.61
(-1 bis +1)
in Bezug auf die gesamte Reise nicht sehr gross ist (vgl.
Marktanteil ***** und **** Hotel 14.1% 50.8% 10.1%
Tabelle). Differenzen sind v.a. in der Beurteilung der Un-
Marktanteil * und ** Hotel 4.2% 3.0% 15.4%
terkunft feststellbar (wie auch in den Medien oft vorge-
Ausgaben pro Person und Reise 710 CHF 1‘046 CHF 987 CHF
bracht). Allerdings: Der Beurteilung Österreichs gegen-
Ausgaben pro Person und Tag 176 CHF 210 CHF 197 CHF
über der Schweiz gerade in dieser Domäne liegen zum Teil
Ausgaben pro Person und Tag
fundamentale Reiseverhaltensunterschiede zu Grunde, in Relation zu Einkommen 0.3% 0.5% 0.3%
welche das schlechtere Abschneiden der Schweiz relativie-
Kerndaten zu Schweizer Reisen in die Schweiz, Österreich und
ren und damit den Mythos „Österreich ist besser als die Frankreich. Quelle: Reisemarkt Schweiz 2004 und 2007; eigene
Schweiz“ in Rauch aufzulösen vermögen. Wer ist noch Berechnungen (Zufriedenheitsskala: -1=unzufrieden; +1=zufrieden)
IMPacts Ausgabe 04 I 5Mythen und Märchen im Tourismus – Einige (Polemische) Kurzgeschichten
Der obige Apfel-Birnen-Vergleich ist wenig zielführend sondere Natur, wo Schutz- und Nutzungsinteressen auf
und könnte im schlimmsten Fall sogar zu unternehmeri- einander prallen - einigermassen gerecht verteilt werden.
schen Fehlentscheidungen führen. Daten und Fakten – so Lehnen wir uns also zurück im Vertrauen auf die Nach-
etwa aus dem Reisemarkt Schweiz des IMP-HSG oder aus haltigkeits-Selbstregulation des Systems, welches besten
dem Tourismus Monitor Schweiz von Schweiz Tourismus falls punktuell mit positiven oder negativen Anreizen
– sind also gefragt. gesteuert werden muss.
Tourismus (in der Schweiz) kann nachhaltig Mehr Promotion für mehr Tourismus
sein Die touristische Schweiz ist derzeit aufgrund der wirt-
Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde, unabhängig schaftlichen Lage enorm unter Druck. Der teure Schwei-
davon, ob diese Münder wissenschaftlich oder praktisch zer Franken und eine abschwächende europäische Kon-
argumentieren. Lassen Sie uns diese Diskussion für einen junktur hinterlassen immer deutlichere Spuren in den
Moment kurz reflektieren. Nachfragekennzahlen unseres Landes, aber auch in den
Vorauszuschicken ist einmal, dass Tourismus aus einer Bilanzen und Erfolgsrechnungen der touristischen Un-
Perspektive Gesamtsystem auf Grund der zentralen Rolle ternehmen. Als Gegenmittel wird mittels erhöhtem öf-
der hierzu notwenigen Mobilität per se ökologische Nach- fentlichem Mitteleinsatz die Promotion der touristischen
haltigkeitskriterien verletzt. Dies bedeutet letztlich, dass Schweiz insbesondere in den neuen Märkten hochgefah-
auch die Schweiz in ihrem Bestreben, mit ihren touristi- ren und gleichzeitig die Marktdurchdringung in verschie-
schen Angeboten globale Märkte anzusprechen, Nachhal denen europäischen Stammmärkten intensiviert. Damit
tigkeitskriterien verletzt und durch Mobilität induzierte reagieren wir mit alten Mitteln (Strukturen und Prozesse)
Externalitäten generiert. Nachhaltig kann deshalb der auf neue Herausforderungen (Marktgegebenheiten). Die
Tourist in seinem Verhalten nur sein, wenn er in der Wirkung dieser Massnahmen bleibt umstritten, nicht zu-
Schweiz einmal angekommen ist und mittels von den letzt weil sie kaum zu messen ist. Dies hängt nicht zuletzt
Anbietern gesetzten Anreizen und/ oder Geboten und damit zusammen, dass Märkte immer fragmentierter und
Verboten entsprechend gesteuert wird. damit immer weniger gleichartig werden. Sprich: Die
Kundensteuerung mit Nachhaltigkeitszielen ist das Zau ‚grosse Kanone‘ trifft nicht mehr auf Fliegen. Auch zeigen
berwort. Im Hinblick auf das global zu erwartende sich international immer mehr Fälle, bei welchen wir tou-
Wachstum und die Tatsache, dass die Schweiz in vielen ristisches Wachstum ohne geballte Promotionsmassnah-
emergenten Wirtschaften dieser Welt eine ‚aspirational‘ men beobachten können (bspw. deutsches Bodenseeufer,
Destination darstellt, die künftig viele Touristen anziehen neue Destinationen in China).
wird, sollten wir baldmöglichst in eine entsprechende Dis-
kussion über Kundensteuerung einsteigen. Und wir soll- Der derzeit bestehende Druck sollte deshalb genutzt wer-
ten aufhören zu glauben, dass Tourismus eine nachhaltige den, das touristische Vermarktungssystem der Schweiz
Aktivität sein kann und vielmehr zugeben, dass wir die weiter auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Zwei
durch Tourismus verursachten Externalitäten so weit wie Themen stehen hier im Vordergrund:
möglich und notwendig zu minimieren versuchen. 1. Klarheit schaffen über unsere das Land übergreifenden
Lassen Sie uns deshalb nun die systemische Sicht auf eine Value Propositions in unterschiedlichen Märkten
unternehmerische herunterbrechen und damit eine Mi- 2. Anpassung von Strukturen und Prozessen entlang tou-
kroperspektive einnehmen. Es steht oft der Vorwurf im ristischer Potentiale und vermarktbarer Geschäftsfel-
Raum, dass Unternehmen sich nicht ‚nachhaltig‘ verhal- der – und nicht wie bis anhin innerhalb vorgegebener
ten (unabhängig von der Nachhaltigkeitsdomäne). Wir politischer Grenzen
halten dagegen und stellen die These in den Raum, dass es
insbesondere im Tourismus viele über Generationen fami- Was die Value Proposition (und damit Punkt 1) anbe-
liengeführte Unternehmen und Unternehmen mit einem langt, ist feststellbar, dass auf die Frage, was die Schweiz
strategisch denkenden Aktionariat gibt, die nicht nur das als Ferienland ausmacht, derzeit vor allem Begriffe wie
eigene Unternehmen, sondern die auch das System Tou- Vielfalt, Naturschönheit, Authentizität, gute Produkte
rismus insgesamt nachhaltig weiter entwickeln wollen und und dergleichen fallen. Wir halten dagegen und behaup-
können. Strategische Zielsetzungen schliessen automatisch ten, dass diese oberflächlichen Value Propositions kaum
– wenn auch oft implizit - langfristige Nachhaltigkeits- längerfristig Zahlungsbereitschaft von Touristen in der
ziele mit ein und stellen so die Überlebensfähigkeit von Schweiz von über +25% gegenüber unseren Nachbarn
Akteuren und System (als Summe der Akteure) sicher. rechtfertigen liessen.
Gestützt werden sie in ihrem Verhalten durch die direkte
Demokratie, welche tendenziell kurzfristige Fehllösungen Wir müssen also dringend wissen, weshalb wir heute
verhindert und teilweise sicherstellt, dass Eigentumsrechte unter den bestehenden widrigen Umständen (teurer
an den für den Tourismus zentralen Grundlagen - insbe- Schweizer Franken, hohe Preise, vermeintlich mittelmäs-
sige Leistungen; vgl. Punkt 1) überhaupt noch Gäste im
6 I IMPacts Ausgabe 04Mythen und Märchen im Tourismus – Einige (Polemische) Kurzgeschichten
Land haben. Darüber hinaus sind Leistungsinnovationen Tourismus ist anders als andere Branchen
basierend auf der Nutzbarmachung internationaler Nach- Zum Schluss wagen wir uns auf ein Minenfeld und hinter-
fragepotentiale gefragt. Erst diese Innovationen liefern ein fragen die weitum akzeptierte Meinung, wonach Touris-
brauchbares Fundament für zukünftige Vermarktungsak- mus anders ist als andere Branchen.
tivitäten. Unbestritten bleibt, dass touristische Unternehmen in ih-
Zu Punkt 2: Leistungsentwicklungen und deren Vermark- rer grossen Mehrzahl standortgebunden und damit bzgl.
tung werden in Zukunft idealerweise nach Geschäftsfel- ihrer unternehmerischen Konfiguration eingeschränktere
dern gegliedert. Unter Geschäftsfeldern im Tourismus Entwicklungsoptionen haben als beispielsweise standort
werden ungebundene Unternehmen. Unbestritten bleibt auch,
-- klar abgrenzbare Leistungs- und Angebotsbündel dass die regulatorischen Rahmenbedingungen herausfor-
-- für relevante Touristenströme mit klar identifizierbaren dernd sind, da nicht nur das direkte touristische regulato-
Gästen rische Umfeld auf diese Branche wirkt, sondern aufgrund
-- welche sich in durch ihr Verhalten klar definierten Räu- der Standortgebundenheit auch das indirekte (bspw.
men und Zeitpunkten bewegen Landwirtschaftspolitik). Unbestritten bleibt auch, dass
-- und hierbei unsere Angebote nutzen touristische Leistungen in mehr oder minder organisierten
verstanden. und koordinierten Netzwerken erbracht werden und da-
mit die Geschäftslogik oft weniger nur eine rein betriebs-
Die Örtlichkeiten, welche Gäste während ihres Aufent- wirtschaftliche, sondern eine systemisch-kooperative sein
haltes aufsuchen, definieren letztlich den geographischen muss, die über klassische Zulieferstrukturen und –prozesse
Perimeter der Destination. Dieser wird somit variabel und hinausgeht und eher ein insgesamt kollaboratives Leis-
führt zur Auflösung der geographisch und politisch rigi- tungssystem in Netzwerken darstellt.
den Vermarktungsstrukturen und –prozesse, wie dies im In der Beziehung zwischen Unternehmen mit dem Ge-
Konzept des IMP-HSG zum Destination Management samtsystem Tourismus findet ein vielfältiger Austausch von
der dritten Generation umfassend diskutiert wird. Für Effekten statt; das Unternehmen gibt an das und emp-
eine beispielhafte Morphologie, wie Geschäftsfelder abge- fängt vom System gleichermassen positive wie negative
grenzt werden können, sei auf den Kasten verwiesen. Effekte. Dies gilt aber auch für andere Branchen, insbe-
Kurzes Fazit dieser Diskussion: Es sind mehr Mittel not- sondere wenn sie exportorientiert wie der Tourismus sind.
wendig und ihr Einsatz muss präziser werden. Während jedoch in anderen exportorientierten Branchen
hauptsächlich nur nach unternehmerischen und vor allem
geschäftsgetriebenen Prinzipien gearbeitet wird, verharrt
Beispielhafte Morphologie zur der Tourismus in einer modellorientierten Arbeitsweise,
Abgrenzung von Geschäftsfeldern welche sich zu stark an den vermeintlichen Anforderungen
und Nutzen des Gesamtsystems orientiert. Damit verbun-
Angebot den ist auch eine suboptimale Teilung der Verantwortung.
Potentiale und Attraktionen im touristischen Raum Hiervon zeugt nicht zuletzt die weitum immer noch grosse
Dominanz der Politik in der Branche, die Rolle und Be-
Portfolio von ausgeführten und gewünschten deutung ‚übergeordneter‘ koordinierender Institutionen,
Aktivitäten der potentiellen Gäste die hohe Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln bspw. in
Benötigte Infrastruktur für diese Gäste der Vermarktung der Angebote und die hohe Zahl wenig
Typ meiner Destination geschäftsgetriebener Kooperationen (um der Kooperation
Willen).
Es bleibt deshalb der Ruf, dass touristischeUnternehmen,
Vermarktung d.h. die touristischen Leistungsträger, wieder vermehrt die
Marketing-Prozesse (Funnel), wie Gäste koordinierende Arbeit der Institutionen treiben (und nicht
angesprochen werden umgekehrt) und damit den Lead bzgl. Inhalt der Arbeit
und der damit verbundenen Prozesse übernehmen sollen.
In Konsequenz sollten – falls weiter öffentliche Fördermit-
Nachfrage tel in diese Branche fliessen - nicht mehr Institutionen,
Lebensphase meiner Gäste sondern die gemeinsam zu lösenden Aufgaben co-finan-
ziert werden.Wenn schon eine hohe Staatsquote im Touris-
Bedürfnisse/ Motivation meiner Gäste mus besteht, dann sollte sich der Einsatz der öffentlichen
Marktabgrenzung, woher meine Gäste kommen Mittel an den privaten Geldgebern orientieren, welche die
Reisekontext meiner Gäste Allokation ihrer eigenen Mittel umso effektiver und effizi-
enter gestalten, damit der Tourismus das wird, was er sein
Reisetyp meiner Gäste sollte: Eine unternehmerische Branche mit Eigenheiten
Quelle: Eigene Darstellung wie andere Branchen auch.
IMPacts Ausgabe 04 I 78 I IMPacts Ausgabe 04
Zum Mehrwert von Wertschöpfungsstudien
Zum Mehrwert von
Wertschöpfungsstudien
Simone Strauf, Roland Scherer
Seit einigen Jahren haben Wertschöpfungsstudien regelrecht um was für ein Projekt oder eine Einrichtung es sich
Konjunktur: kaum eine Woche vergeht, in der nicht in der handelt, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Die
Durchführung eines Megaevents, wie z.B. eine Winter-
Presse die Ergebnisse einer derartigen Studie vorgestellt wer-
olympiade, braucht konkrete Aussagen über die poten-
den. Die inhaltliche Bandbreite, mit der sich die verschiede-
nen Studien beschäftigen, ist beinahe grenzenlos und reicht ziellen wirtschaftlichen Effekte, die aus diesem Anlass für
von öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, über ein- den Kanton (und für die ganze Schweiz) resultieren. Nur
zelne Branchen und Cluster hin zu Grossveranstaltungen und so kann die notwendige politische Unterstützung für die-
Events. Auch das IMP-HSG hat bereits eine Reihe von Wert- ses Projekt und damit auch die jeweils notwendige Volks-
abstimmung gewonnen werden. Da beispielsweise Gross-
schöpfungsstudien veröffentlicht und konnte vielfältige Erfah-
rungen im Zusammenhang mit ihrer Erstellung und Anwen- veranstaltungen oft in erheblichem Umfang öffentlicher
dung sammeln. Diese Erfahrungen flossen in eine inhaltliche Subventionen bedürfen, werden die Abstimmungen zur
Weiterentwicklung des methodischen Ansatzes ein, um den- Durchführung dieses Events auch zu Abstimmungen über
Wert der Wertschöpfungsstudien für die Praxis zu erhöhen. deren Finanzierung. Dies hat zur Folge, dass bei vielen
grösseren Anlässen und Investitionsvorhaben ex ante-Stu-
Die Bewertung der regionalwirtschaftlichen Effekte von dien durchgeführt werden, um dem Stimmvolk Zahlen zu
(öffentlichen) Programmen, Projekten und Investitions- den erwarteten wirtschaftlichen
vorhaben ist bereits seit Mitte der 70er Jahre Gegenstand Effekten vorlegen zu können. Hierbei findet eine Ökono-
der regionalwissenschaftlichen Forschung. Hierzu wurden misierung von Bereichen des (öffentlichen) Lebens statt,
verschiedene methodische Ansätze entwickelt und an- die oftmals dazu führt, dass die eigentliche Funktion der
gewendet (z.B. Input-Output-Analyse, Kosten-Nutzen- Einrichtung oder des Investitionsvorhabens in den Hin-
Analyse, Inzidenzanalyse). Oftmals untersuchen regional- tergrund tritt. Der Satz „Es ist gut, weil es der Stadt und
wirtschaftliche Wirkungsanalysen, welche Auswirkungen der Region wirtschaftlich viel bringt“ dient sowohl den
öffentliche Aktivitäten auf ökonomische Grössen wie Pro- Initianten und Projektverantwortlichen wie auch der
duktion, Wertschöpfung, Beschäftigung und Einkommen öffentlichen Hand zur Legitimation und wird über die
innerhalb bestimmter räum- Medien in die Öffentlichkeit
«Regionalwirtschaftliche Wirkungs
licher Grenzen haben. Neben getragen.
analysen sollten nicht (nur) zu Legi-
diesen sog. tangiblen Effekten, Doch nicht nur im Vorfeld
timation, sondern als strategisches
die primär die monetären Ef- von geplanten Projekten und
Instrument genutzt werden.»
fekte abbilden, fanden in den Investitionsvorhaben werden
neueren Studien auch vermehrt sog. intangible Effekte Analysen über regionalwirtschaftliche Effekte erstellt.
Eingang in die Analysen. Die intangiblen Effekte bilden Zunehmend kann festgestellt werden, dass diese auch im
eine Vielzahl von Wirkungen ab, die sich in der Regel Nachgang von Projekten oder Veranstaltungen in Auf-
nur schwer quantifizieren lassen, langfristig aber positive trag gegeben werden. So hat z.B. das IMP-HSG in den
Effekte haben können. vergangen Jahren Studien zu Hochschulen, Kultur- und
Auslöser für Studien zur Analyse der regionalwirtschaft- Kongresszentren, Sport- und Kulturveranstaltungen oder
lichen Effekte sind meist öffentliche Diskussionen, die Flughäfen erarbeitet, um deren regionalwirtschaftliche
über ein konkretes Projekt, eine öffentliche Einrichtung Auswirkungen analysieren zu können. Auslöser dieser ex-
oder ein Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit post-Analysen können sehr unterschiedlich sein. Gleich-
Subventionen oder der Vergabe öffentlicher Mittel, ge- wohl zeigt sich eine Tendenz, mit Hilfe der (positiven)
führt werden. Diese Diskussionen können, je nachdem Ergebnisse die eigenen Aktivitäten in gutem Licht er-
IMPacts Ausgabe 04 I 9Zum Mehrwert von Wertschöpfungsstudien
scheinen zu lassen und die regionale Bedeutung eindrück- hen zwischen den methodischen Ansätzen grundlegende
lich aufzuzeigen. Damit können die Veranstaltungen oder Unterschiede, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen
Projekte im Nachhinein positiv bewertet werden, um bei bei der gleichen Fragestellung führen können. Auf der
Wiederholungen oder neuen Investitionen, Argumente anderen Seite spielt bei ökonomischen Wirkungsanalysen
für die (finanzielle) Unterstützung der Politik und der öf- von Events oder von öffentlichen Infrastruktureinrichtun-
fentlichen Hand anbringen zu können. gen wie Theatern oder Sportstätten das Problem der Auf-
tragsforschung eine wichtige Rolle. So sehen Dietl/Pauli
Die Validität von Wertschöpfungsstudien (1999) bei einer vergleichenden Analyse von Studien über
In den letzten Jahren hat sowohl in der Wissenschaft als wirtschaftliche Auswirkungen öffentlicher Sportstät-
auch in der Öffentlichkeit eine zunehmende Diskussion ten die Gefahr einer extrem positiven Bewertung. Zwei
über den Wert von Wertschöpfungsstudien stattgefunden. Gründe werden hierfür verantwortlich gemacht: einerseits
Dabei wird aus verschiedenen Blickwinkeln fundamenta- werden in der Regel nur positive Studien publiziert, die
le Kritik geäussert und deren Aussagekraft und Seriosität zumeist von den Stadionbefürwortern in Auftrag gege-
grundsätzlich in Frage gestellt. Der Basler Ökonom Silvio ben wurden. Studien mit eher negativen Ergebnissen
Borner spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer verschwinden dagegen meist in den Schubladen der Auf-
„Voodoo-Ökonomie“ (2010:19). Er kritisiert insbeson- traggeber. Andererseits wird das Problem der (wirtschaft-
dere die in Wertschöpfungsstudien oftmals berechneten lichen) Abhängigkeit der Gutachter thematisiert: „An ex-
Multiplikatoreffekte, die er als Zaubertrick bezeichnet, pert whose testimonity harms his employer’s case doesn’t
um wundersame Einkommensvermehrungen nachzuwei- get much repeat business“ (Curtis, 1993:7).
sen. Zu Recht weist er auf eine methodische Gefahr hin, Grundsätzlich ist eine Überprüfung der regionalen Wir-
die bei klassischen Wertschöpfungsstudien besteht und kungen, die von einem Projekt, einer Veranstaltung oder
schlussendlich zu einer Fehlinterpretation der Ergebnisse einer (öffentlichen) Einrichtung auf den jeweiligen Stand-
führt: addiert man z.B. die Ergebnisse einzelner Wert- ort ausgehen, zu begrüssen und entspricht dem aktuellen
schöpfungsstudien zu verschiedenen Branchenclustern, so Zeitgeist. Der Bedeutungsgewinn von derartigen Wir-
kann die Zusammenschau schnell ein Vielfaches des ge- kungsbewertungen basiert auf zwei Entwicklungen, die
samten regionalen Volkseinkommens erreichen. Nicht nur im politisch-administrativen Umfeld auch in der Schweiz
die Addition von Teilergebnissen, sondern auch der Ver- allgemein beobachtet werden können:
gleich einzelner Studien beinhaltet ein grosses Fehlerpo- 1. Die Politik gerät aufgrund knapper öffentlicher Mittel
tenzial. Analysen zur Berechnung der regionalwirtschaftli- zunehmend unter einen Legitimationsdruck und muss
chen Effekte beziehen sich auf einen definierten Zeitraum nachweisen, dass ihre Aktivitäten einen konkreten Nut-
und einen klar abgegrenzten Raum. Damit zeigen sie eine zen stiften.
Momentaufnahme der Wirkungen, die eine Aktivität vor 2. Neue Modelle der Verwaltungsführung steuern zuneh-
dem Hintergrund der definierten Parameter hat. Ein Ver- mend über die Vorgabe konkreter Leistungsziele, deren
gleich verschiedener Studien wird – selbst bei Anwendung Erreichung durch die jeweilige Institution nachgewie-
der gleichen Methodik – dadurch erheblich erschwert. sen werden muss.
Hinzu kommen die unterschiedlichen methodischen An- Die unterschiedlichen Kritiken an räumlichen Wirkungs-
sätze, die eine Vergleichbarkeit von Wertschöpfungsstudi- analysen, insbesondere an Wertschöpfungsstudien, sind
en nahezu unmöglich machen. u.E. gerechtfertigt und man muss sich intensiv mit diesen
Ein weiteres Problem, insbesondere bei der Berechnung auseinandersetzen. Nur so können Ansatzpunkte gefun-
der indirekten und induzierten Effekte, ist die Kausali- den werden, wie die Validität räumlicher Wirkungsana-
tät der Umsätze in Bezug auf die Veranstaltung oder die lysen erhöht und damit schlussendlich auch die (öffent-
Investition. Je weiter man die Wirkungsketten ausführt, liche) Akzeptanz für die Ergebnisse derartiger Analysen
umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Aus- erhöht werden kann. Aufgrund der in den vergangenen
gaben substituiert und nicht mehr ursächlich zugeordnet Jahren gewonnen Erfahrungen erscheinen uns folgende
werden können. Wissenschaftlich gesehen sind es vor al- Punkte entscheidend, um den Wert räumlicher Wir-
lem die Multiplikatoreffekte, die stark umstritten sind und kungsanalysen deutlich zu erhöhen:
oftmals zu einem Spiel der grossen Zahl führen. Die lang-
fristigen, teilweise nur qualitativ messbaren Effekte, die Von der Wertschöpfungsbetrachtung zur
ebenfalls für einen Standort von grosser Bedeutung sind, regionalen Zahlungsbilanz
werden dagegen oftmals kaum berücksichtigt. Die Fokussierung rein auf die Berechnung der Wert-
Die methodische Kritik an den Wertschöpfungsstudien schöpfungseffekte führt oftmals zu missverständlichen Er-
steht aber nicht allein, sondern insgesamt ist der Grad gebnissen, da bei der Berechnung der Wertschöpfungsef-
der Validität räumlicher Wirkungsanalysen in der wis- fekte lediglich die Verwendungsseite betrachtet wird und
senschaftlichen Diskussion zum Teil umstritten. Einige nicht der eigentliche Exporterlös, der durch ein Projekt,
Autoren identifizieren zwei grundlegende Probleme von einen Event oder eine öffentliche Institution entsteht.
räumlichen Wirkungsanalysen: Auf der einen Seite beste- Regionalökonomisch relevant ist aber gerade dieser Ex-
10 I IMPacts Ausgabe 04Zum Mehrwert von Wertschöpfungsstudien
porterlös, da nur von diesem ein spürbarer Effekt auf die So ist z.B. ein Spital primär für die medizinische Versor-
wirtschaftliche Entwicklung einer Region ausgeht. Eine gung der Bevölkerung zuständig, erst an zweiter Stelle ist
hinsichtlich der wirtschaftlichen Wirkung relevantere es Akteur in einem regionalen Gefüge. Werden räumliche
Grösse ist daher die regionale Zahlungsinzidenz, bei der Wirkungsanalysen als strategisches Instrument verstan-
im Sinne einer räumlichen Gewinn- und Verlustrechnung den, können sie dazu beitragen, sowohl einen Mehrwert
der effektive Kaufkraftzufluss für eine bestimmte Region für die Region zu schaffen, als auch selber vom Potenzial
berechnet wird. Auf eine Berechnung der Steuerrück- der Region zu profitieren. Gelingt es, eine Schnittmenge,
flüsse, die aus dieser Zahlungsinzidenz für eine Region zwischen den Interessen einesSpital
Spital Projektes oder einer Ein- RegionRegion
entstehen, sollte sowohl aufgrund der sehr komplexen richtung und den Interessen der Standortregion zu finden,
Steuergesetzgebung wie auch aufgrund der hohen Unsi- kann dies zu einem Mehrwert für beide Seiten führen.
cherheiten bezüglich der anzuwendenden Steuersätze – M S
insbesondere bei Privatpersonen - verzichtet werden. Wer- Spital M Region S
den dennoch Berechnungen bezüglich der Steuereffekte
F W
vorgenommen, ist die Validität begrenzt bzw. muss vor F M S W
dem Hintergrund vieler Annahmen in der Berechnung
immer eine hohe Spanne abgebildet werden. Auch die F
A
W
L
Berechnung der Arbeitsplatz- bzw. Beschäftigungseffekte, A L
A L
besonders der indirekten und induzierten, ist mit Vorsicht M = Medizinische Versorgung
F = Forschung
S = Standortattraktivität
MM== Medizinische
Medizinische Versorgung W = Wettbewerbsfähigkeit
zu geniessen, zumal wie bereits erwähnt, u.a. Substituti- S = Standortattraktivität
Versorgung S = Standortattraktivität
FF== Forschung
Forschung A = Aus- und Weiterbildung W = Wettbewerbsfähigkeit L = Lebensqualität
A = Aus- und Weiterbildung
W = Wettbewerbsfähigkeit
L = Lebensqualität
onseffekte eine genaue Berechnung erschweren. A = Aus- und Weiterbildung L = Lebensqualität
Mehrwert für
Mehrwert für das Prozessmanagement desdas Prozessmanagement
Spitals des Spitals
Mehrwert für das Prozessmanagement der Region
Mehrwert
Dynamische Mehrwert
für das
Schnittmenge für das
Prozessmanagement
zwischen Spital Prozessmanagement
und Region des Spitals der Region
Keine rein monetäre Betrachtung der wirt- Dynamische
Mehrwert für das Schnittmenge
Prozessmanagement zwischen
der Region Spital und Region
Dynamische Schnittmenge zwischen Spital und Region
schaftlichen Effekte Mehrwert durch räumliche Wirkungsanalysen für z.B. ein Spital
Auch wenn Aussagen zu regionalen Umsätzen und zur und seine Standortregion, Quelle: in Anlehnung an Goddard, 2000
Wertschöpfung meist besonders interessieren, soll-
ten räumliche Wirkungsanalysen umfassender angelegt Räumliche Wirkungsanalysen können dann helfen, die
werden und über die Berechnung der monetären Effekte Effekte, die auf die Region wirken, strategisch zu nutzen
hinausgehen. Die monetären Effekte, beziehen sich nur und damit die positiven Wirkungen für die Region zu
auf einen relativ kurzen Zeitraum und lösen keine lang- erhöhen. Umgekehrt kann auch eine Einrichtung oder
fristigen Wirkungen aus. Zahlreiche Studien haben nach- Institution von ihrer Standortregion profitieren, wenn
gewiesen, dass es gerade die nicht-monetären Effekte, die beispielsweise im Bereich der Aus- und Weiterbildung
sog. intangiblen Effekte sind, die langfristig einen spürba- oder der Forschung kooperiert wird. Damit räumliche
ren positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Standor- Wirkungsanalysen einen Mehrwert bieten, ist es einerseits
tes haben (können). Die Erfassung der intangiblen Effek- notwendig, dass sich eine Einrichtung oder ein Projekt
ten ist jedoch ebenfalls mit einer Reihe von methodischen als regionaler Akteur wahrnimmt und Verantwortung
Herausforderungen verbunden, da auch hier oftmals ein übernimmt, anderseits aber auch die übrigen regionalen
Kausalitätsproblem bei der genauen Zuordnung einer Akteure an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Dies
beobachtbaren Wirkung zu der ihr zugrunde liegenden kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn räum-
Intervention vorliegt. Mit Hilfe des Ansatzes des „Ver- liche Wirkungsanalysen nicht nur einmalig z.B. anlässlich
netzten Denkens“ ist es u.E. aber möglich, entsprechen- eines Jubiläums oder einer anstehenden Volksabstimmung
de Wirkungsketten zu identifizieren und für diese sogar durchgeführt werden. Die Erarbeitung eines laufenden
quantifizierbare Wirkungsindikatoren festzulegen. Eine Monitorings der räumlichen Wirkungen im Sinne eines
Messung und damit Bewertung der langfristig wirksamen regelmässigen Regionalisierungsberichts kann ein erfolg-
Effekte wird dadurch möglich. Dies hilft, genauere Aus- versprechender Ansatz sein.
sagen über den langfristigen Wert eines Projektes, eines
Events oder einer Institution für einen Standort treffen zu Quellen
können und erlaubt eine umfassendere Betrachtung. Borner, Silvio (2010): Voodoo-Ökonomie. In: Die Welt
woche vom 15.07.2010, S. 19.
Wirkungsanalysen als integraler Bestand- Curtis, G. (1993): “Waterlogged” in: Texas Monthly.
teil von Strategieentwicklung September S. 7.
Entscheidend für den Erfolg von räumlichen Wirkungs- Dietl, H.; Pauli, M. (1999): Wirtschaftliche Auswirkungen
analysen ist es, ihre Funktion nicht einzig in der Legiti- öffentlich finanzierter Stadionprojekte. Paderborn. Arbeits-
mation (öffentlicher) Finanzmittel zu sehen, sondern sie berichte Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Universität
als integralen Bestandteil der Strategieentwicklung von Paderborn. Neue Reihe Nr. 61.
regional bedeutsamen Projekten und Institutionen zu ver- Goddard, J.B. (2000): The response of HEIs to regional
stehen. Grundsätzlich muss aber gelten, dass die Erfül- needs. Newcastle upon Tyne, UK.
lung der jeweiligen Kernaufgaben im Vordergrund steht.
IMPacts Ausgabe 04 I 11ALTERNATIVE FOLGESEITE 12 I IMPacts Ausgabe 04
Zur Funktion von Fiktion im Management
Zur Funktion von
Fiktion im Management
Elisabeth Dalucas, Johannes Rüegg-Stürm
Fiktives gilt im allgemeinen Sprachgebrauch als Denkbares, stümpfe in Bären. Alle nicht Beteiligten bekommen es mit
doch zumindest heute noch Irreales. Die Verfertigung von der Angst zu tun, wenn die Spielenden die Präsenz der
Fiktionen, das ist die Position dieses Artikels, ist unerlässliche Bären feststellen. Doch es kann geschehen, dass die Spie-
Voraussetzung für gelingende Innovation, sei es Produktinno- lenden „zum Bären gehen“ und enttäuscht feststellen, dass
vation oder organisationale Innovation, die einen strategi- da nicht ein Baumstumpf, sondern ein Fels steht. Aber
schen Wandel verkörpern kann. Fiktionen verkörpern ein gleich dahinter befindet sich tatsächlich ein Baumstumpf
Realisierungspotential, das Management unter Bedingungen im Dickicht. Es besteht also Gefahr, und die Spielenden
von Ungewissheit und Unsicherheit strategisch nutzen kann. rennen rasch davon, um anderen von ihrer unheimlichen
Nur, wird diese Chance auch genutzt? Die Antwort lautet: zu Begegnung zu erzählen.
wenig zielgerichtet. Es könnte deshalb erfolgversprechend sein,
das Potential des „Fiktionalisierens“, seine Spiel- und Gestal- Reale und fiktive Bären
tungsmöglichkeiten systematischer für die Weiterentwicklung Was macht dieses Spiel zu einem Vorgang, den man als
von Organisationen auszuschöpfen. Fiktionalisieren bezeichnen kann? Die Bären sind fiktional,
weil die Baumstümpfe ausschliesslich für die Mitspieler
Ausgangspunkt dieses Beitrages ist die These, dass Organi- Bären sind, nicht aber für Unbeteiligte. Die Vereinbarung
sationen ständig mit Fiktionen arbeiten und dies über- der Spielenden – „lasst uns sagen, Baumstümpfe sind Bä-
haupt erst Entwicklung und Innovation in Unternehmen ren“ – hat die Fiktion geschaffen. Der Fels hingegen ist
ermöglicht. In einem ersten Schritt wird daher nachfol- real vorhanden. Gleichzeitig ist er – solange die Spielenden
gend versucht, das Potential des Fiktionalen in den Blick glaubten, es handle sich um einen Baumstumpf – auch
zu bekommen, um dieses dann an einem Beispiel aus der ein Bär und damit auch eine Fiktion. Die Ähnlichkeit des
unternehmerischen Praxis zu reflektieren. Daraus werden Felsens, seine den Baumstumpf nachahmende Qualität,
konkrete Schlussfolgerungen für das Management abge- hat die Spielenden zu einem fiktionalen und gemeinsam
leitet. verfertigten Make-Believe geführt.
«Warum es im Management
Erfunden oder wahr oft notwendig ist, einen Busch Die Vorstellung eines Bären im
Alltagssprachlich gelten für einen Bären zu halten.» Dickicht ist an sich hingegen real,
Fiktionen als erfunden und wenn sich eine Person ein solches
ausgedacht, während Realität Wahrheit und Wirklichkeit Bild macht. Im Dickicht ist nicht der Bär Fiktion, sondern
signalisiert. Realität ist im Hier und Jetzt situiert, Fiktion der Baumstumpf als Requisit (prop), der sich den Spielen-
tendenziell in der Zukunft. Fiktionen werden gemeinhin den real darstellt. Dass die Spielenden davon rennen, macht
mit Ungewissheit verbunden, während Wirklichkeit (wenn allerdings klar, dass der Baumstumpf für sich alleine keine
auch scheinbar) Gewissheit und Stabilität anzeigt. Das la- fiktionale Wahrheit schaffen kann. Die Spielenden rennen
teinische fingere kann sowohl bilden und gestalten, als auch davon, weil sie einer sozialen Konvention gehorchen: Bären
erdichten bis hin zu lügen (fingieren) bedeuten. sind gefährlich. Fiktionalisieren heisst, temporär und im
Der amerikanische Philosoph Kendall L. Walton (1990) Konsens der Beteiligten eine Realität verfertigen, die wie im
sieht das Fiktive beispielhaft im Kinderspiel dargestellt. oben beschriebenen Spiel fragil und flüchtig zugleich ist.
Seine Beschreibung ermöglicht es, das Potential des Fikti-
ven im Spiel – über das zukünftig Ungewisse hinaus – zu Fiktion in Organisationen
erkennen. „Let’s say that stumps are bears“, ist eine mögli- Im Kontext von Organisationen stellt sich die Frage, ob
che Vereinbarung von Spielenden und verwandelt Baum- sich ein solches Fiktionalisieren ebenso charakterisieren
IMPacts Ausgabe 04 I 13ALTERNATIVE
Zur FunktionFOLGESEITE
von Fiktion im Management
lässt und welche Bedeutung einer solchen Tätigkeit zu- ablaufen. Von der Handhabung auftretender Divergenzen
kommen kann? Am Beispiel eines Rekrutierungsprozesses hängt die Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit eines
wird nachfolgend dargestellt, wie sich das Fiktionalisieren Organisationssystems ab. Können sich die Akteure nicht
in Organisationen entwickelt. auf ein (wenigstens temporär gültiges) Bild einigen, dann
scheitert der Prozess, weil die Fiktion als handlungsleiten
Als Ausgangspunkt eines Rekrutierungsprozesses dient in des Referenzsystem nicht zustande kommt und damit die
der Regel eine meist von mehreren Akteuren verfasste Stel- Entwicklungsfähigkeit der Organisation als Ganzes in Fra-
lenbeschreibung. Inhaltliche Basis bilden Erfahrungen mit ge gestellt ist.
vergleichbaren Aufgaben und Kontexten sowie erwartete
Ergebnisse und Wirkungen der Funktionserfüllung. Die Organisation als soziales System
Akteure entwerfen in einem gemeinschaftlichen Prozess ein Die notwendige Bedingung für den Fiktionalisierungs
momentanes Bild von dem, wie die Person, die Leistungen modus ist ein offenes Organisationsverständnis (vgl. Scott,
und die Beziehungsgestaltung inner- und ausserhalb der 1987). Aus systemischer Sicht sind Organisationen soziale
Organisation vorzustellen sei. Sie schaffen eine temporär Systeme, die beobachten und sich selbst beobachten; sie kons
gültige Realität, die sich in der Gestalt eines Bewerbenden truieren simultan sowohl sich selbst als auch ihre relevanten
repräsentieren wird und an der die nachfolgenden Ent- Umwelten (vgl. Luhmann, 2000). Kommunikation, Dis-
scheidungen gemessen werden: „Let’s say that this profile is kurse und Aushandlungsprozesse sind die „Instrumente“,
the person we need.“ mit denen sich Organisationen differenzieren und Grenzen
ziehen zwischen innen und aussen. Grenzziehungen wie-
Das Auswahlverfahren wird durchgeführt. Im Verlaufe derum sind die Voraussetzung, die es einer Organisation
dieses Prozesses gewichten alle Akteure – auch alle Bewer- ermöglichen, Komplexität durch Ausschluss ebenso wie
benden sowie mittelbar auch die In- und Umwelt der durch Einbezug zu reduzieren oder durchlässig oszillieren
Organisation – Aspekte des entworfenen Bildes und fügen zu lassen.
laufend neue hinzu. Man konstruiert dynamisch ein Bild,
in dem sich die gewählten Aspekte in der Stellenerfül- Oder wie es Karl Weick bereits 1969 notiert hat: „Organi-
lung realisieren und nicht gewählte Aspekte bedeutungslos sieren ist zuallererst gegründet auf Einigung darüber, was
werden:„Let’s say that these aspects are the job.“ Wirklichkeit und was Illusion ist“. Organisationsprozesse
Mit der Wahl eines Bewerbenden entscheiden sowohl die sind Prozesse der Verständigung in offenen Systemen. Die
Akteure der Organisation als auch die Bewerbenden, ob Akteure nutzen dabei drei Modalitäten
eine Vereinbarung zustande kommt. Die „Entscheidung“ -- sie verknüpfen rekursiv Erfahrungen mit zukünftig
weist allerdings rein formalen Charakter auf, weil das (in Möglichem,
der Zukunft liegende) Gelingen – der Erfolg des Bewer- -- sie konstruieren schöpferisch zukünftig Wahrscheinliches
bungsverfahrens, der Erfolg des Bewerbenden – offen und
bleibt. Beteiligte und unbeteiligte Akteure kommen expli- -- sie verfertigen gemeinschaftlich temporär Reales.
zit und implizit überein, dass das Leistungsprofil mit der
gewählten Person erfüllt ist:„Let’s say that this candidate Der Kern von Management besteht in diesem (provo-
fulfills the relevant expectations.“ kativen) Sinne in der Ermöglichung gemeinschaftlicher
Verfertigung von Wirklichkeit im Modus des Fiktiven, das
Ein erfolgreiches Rekrutierungsverfahren, das typischer- Realität erzeugt. Das erste Bild, die Stellenbeschreibung,
weise von hoher Ungewissheit geprägt ist, erweist sich als hatte temporäre Gültigkeit, denn es diente als Grundlage
ein Vergemeinschaftungsprozess. Je mehr Akteure sich der für das zweite Bild, das Auswahlverfahren. Dieses zweite
Schaffung eines gemeinsamen Bildes, einer temporären Bild, die zweiten Bilder, wiederum bildeten laufend reale
Realität anschliessen, desto tragfähiger sind die späteren Entscheidungsgrundlagen. Gelingen wird der Prozess,
Performance-Chancen des gewählten Kandidaten in der wenn sich die Akteure immer wieder auf weitere Bilder
Organisation, weil sich die Interaktion mit dem gewählten einigen bzw. sich gegenseitig vergewissern und überein-
Kandidaten an einem gemeinsamen fiktiven Referenzsys- kommen, welches Bild temporär real ist und damit auch,
tem orientiert. welches der Bilder sich als im Kollektiv verfertigte Self-
Fulfilling-Prophecy effektiv realisiert. Die Gestaltung des
Bei den gemeinsamen Bildern handelt es sich um dyna- Heute versteht sich ebenso als Gestaltung des Morgen (vgl.
mische Fiktionen, denn die in der Zukunft liegenden Heidegger, 1993).
Gegenwarten „werden nicht weniger oder mehr wahr-
scheinlich sein, sondern genauso, wie sie sind.“ (Esposito, Erfolgreiches Management verkörpert nicht nur die Fähig-
2007). Dynamisch bedeutet erstens, dass sich die Bilder keit, gemeinschaftlich zu validieren (wie es Weick nennt),
aufgrund fortlaufend verfertigter Erwartungs-Erfahrungs- sondern das Vermögen gemeinschaftlich und auf Zeit Rea-
Divergenzen weiterentwickeln. Zweitens kann dieser lität zu verfertigen, was hier als fiktionalisieren bezeichnet
Verfertigungsprozess eher harmonisch oder eher divergent wird.
14 I IMPacts Ausgabe 04Zur Funktion von Fiktion
ALTERNATIVE
im Management
FOLGESEITE
Learning from Fiction werden müssen. Als Medien der fiktionalen Bildkreation
Nicht nur in der Managementtheorie wurde festgestellt, geeignet sind alle auf Kommunikation und Interaktion
dass Entscheidung nicht als Punktlandung, sondern als angelegten Gefässe wie Workshops und Diskussionsrun-
sich entwickelnder Prozess (vgl. Mintzberg, 1990), ja auch den, die vom Management zwar als horizontaler Aushand-
als Nicht-Entscheidung im Sinne der Anerkennung von lungsprozess moderiert, nicht aber mit vorgegebenen Zie-
Entscheidungslücken (vgl. Lübbe, 1971) verstanden wer- len geführt werden sollten.
den kann. Wenn nun Entscheidung als Fiktion, als Make-
believe (vgl. Walton, 1990) begriffen wird, dann wird sie Die Managementleistung besteht in der Steuerung des
zum Requisit und nimmt eine dem Kollektiv entsprechen- Fictionalizing. Mit der Öffnung hin zu möglichen, unbe-
de kontextuelle Rolle ein. Entscheidungen sind „organi- kannten und im Kollektiv verfassten Bildern mit unge-
sationsinterne Ereignisse, mit deren Hilfe eine unsichere wissem Ausgang kann sich die Organisation mit neuen
Situation (man könnte so oder auch anders vorgehen) Ideen versorgen. Mit einer temporären Schliessung des
kommunikativ in eine vorübergehende Sicherheit und Möglichkeitsraumes, der Anerkennung des „Let’s say that“,
Orientierung stiftende Festlegung transformiert wird.“ des „Angenommen, dass“ stabilisiert sich die Organisation.
(Wimmer, 2012) Dabei stellt der Zyklus von Öffnen und Schliessen die Be-
dingung für eine neuerliche Öffnung dar (Rüegg-Stürm;
In der Managementpraxis relativiert sich mit einem Grand, 2013). Damit dieser Prozess zur gemeinsamen
Verständnis von Entscheidung als Requisit der dezisive Praxis wird, ist eine vertrauensvolle Unternehmenskultur
Charakter einzelner Prozessschritte. Wird Führung und notwendig, die zum einen von der allgemeinen Meinung
Management als temporäre Ermöglichung gemeinschaft- abweichende Positionen als organisationsverändernde
licher Verfertigung von Realität verstanden, können die Irritationen wertzuschätzen vermag und zum anderen
von den Akteuren vereinbarten Bilder zumindest tempo- bewusst eine gewisse Fluktuation von Mitarbeitenden in
rär stabilisiert werden. Sie müssen nicht als (end)gültig Kauf nimmt, weil damit laufend abweichende Ideen in die
verstanden, sondern können „ausprobiert“ werden, was Organisation einfliessen (March, 1991).
die innere Verfasstheit einer Organisation deutlich verän-
dert. Die Führungsleistung besteht dann in der Steuerung Um es mit einem Altmeister des Fiktiven zu formulieren:
dieser Vergemeinschaftungsprozesse bzw. in der achtsamen Management sollte dem Unmöglichen (alias Fiktiven), das
Handhabung der für die Organisation verkraftbaren Ab- wahrscheinlich ist, den Vorzug einräumen vor dem Mögli-
weichungen und Innovationen. chen, das unglaubwürdig ist (Aristoteles, Poetik 1451b).
Organisationales Fiktionalisieren vollzieht sich als inten- Quellen
tionaler Akt des Managements, um spielerisch eine tem- Esposito, Elena (2007). Die Fiktion der wahrscheinlichen
poräre Übereinkunft als mögliches und wahrscheinliches, Realität, Frankfurt: Suhrkamp
nicht aber als wahres oder falsches Handlungsmuster zu Jauss, Hans-Robert (1983). Zur historischen Genese der
verfestigen oder zu verwerfen. Allgemeiner formuliert: Scheidung von Fiktion und Realität, in: Henrich, Dieter und
was wir für Wirklichkeit halten, ist so oder so nur ein Bild, Iser, Wolfgang. Funktionen des Fiktiven, München: Fink,
und stellt uns letztlich vor die Unumgänglichkeit zu Fik S. 423-431
tionalisieren, auch und gerade in Organisationen (vgl. Ru- Lübbe, Hermann (1971). Theorie und Entscheidung, Studi-
dolph, 2012). Fiktion schafft temporäre Realität vermittels en zum Primat der praktischen Vernunft, Freiburg: Rombach
sprachlicher Übereinkunft. Fiktionalisieren als Tätigkeit Luhmann, Niklas (2000). Organisation und Entscheidung,
heisst, etwas-temporär-Reales-schaffen. Opladen: Westdeutscher Verlag
Mintzberg, Henry et al. (1990). Studying Deciding: An Ex-
Der Romanist Hans-Robert Jauss geht noch einen Schritt change of Views Between Mintzberg and Waters, Pettigrew,
weiter und postuliert das „Geniessen der gewussten Fik- and Butler, in: Organization Studies, 11/1, p. 1-16
tion“ (1983) und damit auch der in Kauf genommenen Rüegg-Stürm, Johannes; Grand, Simon (2013): Das
willentlichen Aussetzung der Ungläubigkeit – willing St. Galler Management-Modell: Umwelt, Organisation und
suspension of disbelief, (Coleridge, 1871). Als organisatori- Management aus systemisch-integrativer Perspektive.
sches Vergnügen führt die gewusste Fiktion zur Komplexi- Bern: Haupt, in Vorbereitung
tätsentlastung für das Management und schafft Erpro- Walton, Kendall L. (1990). Mimesis as Make-Believe,
bungsräume für Akteure. Besonders geeignet hierfür sind On the Foundations of the Representational Arts, Cambridge:
Situationen, die von mehrfach hoher Unsicherheit geprägt Harvard University Press
und für das Bestehen der Organisation erfolgskritisch Weick, Karl E. (1995). Der Prozess des Organisierens, Frank-
sind. Dazu gehören Strategieprozesse ebenso wie die Erar- furt: Suhrkamp
beitung von Businessplänen, Akquisitions- und Innovati-
onsprozesse, weil hier zwingend zukünftige Entwicklun-
gen „vorausgesagt“ oder eben gemeinsame Bilder verfertigt
IMPacts Ausgabe 04 I 15ALTERNATIVE FOLGESEITE 16 I IMPacts Ausgabe 04
Legitimation durch Organisationale Mythen
Legitimation durch
Organisationale Mythen
Kuno Schedler
Wie kommt es eigentlich, dass sich Organisationen, die an warten, dass formale Vorgaben zur Corporate Governance
sich in Wettbewerb stehen und auf der Suche nach Differen- einer Organisation eingehalten werden. Nur dadurch,
zierung sein sollten, in formal-organisatorischen Belangen dass die Organisation diese Erwartungen erfüllt, kann sie
oft sehr ähnlich sehen? Unter anderem dieser Frage gehen ihr langfristiges Überleben sicherstellen: Kunden kaufen,
die sogenannten „Neo-Institutionalisten“ in der Organisa Lieferanten liefern, Regulierer intervenieren nicht. Daraus
tionstheorie nach. Ihre Erkenntnisse sind für Managerinnen lässt sich schliessen, dass selbst die effizienteste Organisa-
und Manager spannend – nicht nur für wettbewerbliche tion nicht allein dadurch überlebt, effizient zu sein, wenn
Organisationen, sondern auch für staatliche und Non-Profit sie die institutionalisierten Erwartungen ihrer relevanten
Organisationen. Das Schlüsselwort sind „institutionalisierte Stakeholder nicht erfüllt. Oder mit anderen Worten: Jede
Erwartungen“, durch deren Erfüllung sich Organisationen Organisation muss sich bei ihren unterschiedlichen Refe-
„legitimieren“. renzgruppen legitimieren, indem sie deren Erwartungen
(tatsächlich oder scheinbar) erfüllt.
Institutionen sind Regeln, Werte, Verhaltensweisen
und Sprachregelungen, die für selbstverständlich erach- Nun bilden sich solche Erwartungen nicht einfach iso-
tet, die also nicht hinterfragt werden. Sie ermöglichen es liert, sondern sie sind das Ergebnis von Austauschprozes-
der Organisation, überhaupt effizient funktionieren zu sen im Umfeld der Organisation. Tritt zum Beispiel eine
können. Erst die Tatsache, dass eine Vielzahl von institu- Organisation als Konkurrenz auf, die dank einer besonde-
tionalisierten Prozessen existiert, erlaubt die routinisierte ren Arbeitsmethode den Wettbewerb dominiert, so wird
Zusammenarbeit in der Organisation, dank der nicht diese Methode in der Regel von den anderen kopiert. Dies
ständig die Regeln des Zusammenwirkens neu ausgehan- geschieht nicht selten mit innovativen Geschäftsmodellen
delt werden müssen. In der Schule ist die Schulglocke eine (z.B. Internet-Verkauf ), innovativen Produktdesigns (z.B.
Institution: wenn sie klingelt, geht der Unterricht los. Das iPhone – Oberfläche) oder Qualitäts- und Risikoabsiche-
wird nicht hinterfragt, ist für alle Beteiligten selbstver- rungsmethoden (z.B. ISO-9000). Finden sie genügend
ständlich. Fahrpläne, Breitenwirkung, so entsteht
hierarchische Struktu- «Organisationale Mythen beeinträchtigen eine selbstverständliche
ren, Salärauszahlungen, die Eigenständigkeit der Organisation, Erwartungshaltung, dass
freundliche Bedienung von schaffen aber Legitimation» „gute Organisationen“
Kunden – alles Selbstver- oder „gute Produkte“ diese
ständliche hat sich irgendwann einmal institutionalisiert, formalen Eigenschaften haben müssen. Diese nicht hin-
so dass es heute nicht mehr hinterfragt wird. terfragten Ansprüche an formale Organisationselemente
bezeichnen wir als „organisationale Mythen“.
Die relevante Umwelt einer Organisation wird auch als
(Um)Feld bezeichnet. Konkurrenten, Regulierer, Kunden, In Wikipedia ist ein Mythos wie folgt definiert: „Ein
Lieferanten gehören zum Umfeld der Organisation. In Mythos ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine
diesem Umfeld bilden sich Erwartungen an die Organisa- Erzählung, mit der Menschen und Kulturen ihr Welt-
tion, die für selbstverständlich erachtet werden: Kunden und Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. (...)
erwarten beispielsweise, dass ein Händler nur Waren ver- Mythen erheben einen Anspruch auf Geltung für die von
kauft, die auf ethisch vertretbare Art und Weise produ- ihnen behauptete Wahrheit.“ Der Begriff des Mythos
ziert wurden. Lieferanten erwarten, dass die abnehmende sagt also – im Gegensatz zum Märchen – nicht, dass die
Organisation die Zahlungsfristen einhält. Regulierer er- Erzählung nicht der Wahrheit entspricht. Mythen können
IMPacts Ausgabe 04 I 17Sie können auch lesen