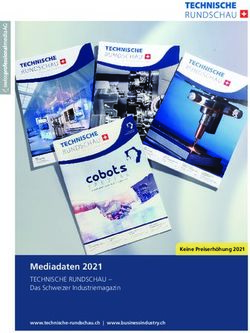NFP 51 Integration und Ausschluss - Bulletin Nr. 2, Dezember 2005
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
NFP 51 Integration und Ausschluss
Bulletin Nr. 2, Dezember 2005
www.nfp51.ch
Schwerpunkt
Editorial
Soziale Sicherheit und Demokratie stehen in
Der «weiche Garantismus»
einem direkten Zusammenhang. Beide haben der Schweiz
zum Ziel, Teilhaberechte zu garantieren und für
alle die faktische Mög-
Teilhaberechte in der Sozialpolitik
lichkeit zu schaffen, an
Prof. Dr. rer. soc. Michael Opielka
gesellschaftlichen Ein-
richtungen und Entschei-
dungen zu partizipieren.
Auch in der Schweiz gilt der Sozialstaat seit langem als
Sozialstaatlichkeit bedeu-
krisenhaft und problematisch. Arbeitslosigkeit und Armut
tet vor allem Existenz-
werden von Sozialpolitikwissenschaftlern als Hinweis
sicherung, sozialen Aus-
darauf gewertet, dass die «Inklusion» aller Bürgerinnen und
gleich, intergenerative
Bürger in alle Funktionssysteme der Gesellschaft – so die
Solidarität. Sie hat aber
klassische Bestimmung der Sozialpolitik bei Talcott Parsons
gleichzeitig auch einen
und Niklas Luhmann – zunehmend misslingt. Doch sind
direkten Einfluss auf die politische Mitwirkung
Zweifel an einer allzu negativen Deutung des Sozialstaats
in unserer Gesellschaft und auf deren
angebracht. Aus international vergleichender Perspektive
Ausgestaltung.
kann die Schweizer Sozialpolitik geradezu als Paradigma
Ob die Schweiz dabei einen «Sonderweg» eines neuen, «garantistischen» Wohlfahrtsstaates (Wohl-
beschreitet, der als Vorbote eines neuen Typs fahrtsregimes) interpretiert werden.
bezeichnet werden kann, wie Michael Opielka «Garantismus» in der Sozialpolitik heisst zweierlei:
betont, kann offen bleiben. Wie die gegenwärti- (1) Sozialpolitische Rechte und Pflichten beziehen sich auf
gen Diskussionen in mehreren europäischen den Bürgerstatus (und nicht auf den Arbeitnehmerstatus).
Ländern zeigen, sind nämlich die Fragen nach (2) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Grundrecht auf
Mass, Ausgestaltung und vor allem politischer Teilhabe an allen sozialen Funktionssystemen.
Priorisierung in der Sozialpolitik trotz aller sys-
temtechnischer Unterschiede die gleichen. Was Wohlfahrtsregime der Schweiz: vom Liberalismus zum
für die Schweiz – im Sinne Opielkas – vielleicht «weichen» Garantismus
in besonderem Masse gilt, ist die breite politi- Noch in den 1970er Jahren galt die Schweiz aufgrund ihrer
sche Verankerung des Wohlfahrtssystems. relativ niedrigen Sozialleistungsquote1 in den meisten ver-
Der gefestigte gesellschaftliche Konsens über gleichenden Studien als liberaler Wohlfahrtsstaat, der am
den Generationenvertrag und die t ehesten mit Grossbritannien, den USA oder Australien,
nicht aber mit anderen kontinentaleuropäischen Staaten
verglichen wurde, wie etwa von Gøsta Esping-Andersen
(Esping-Andersen 1990, S. 81), dem klassischen Theoreti-
ker der «Wohlfahrtsregime». Spätestens seit den 1990er
Jahren wurde dieser Schweizer «Sonderweg» in der Sozial-
politik jedoch empirisch revidiert, sodass auch eine theo-
retische Revision ratsam erscheint. Die Schweizer Sozial-leistungsquote hat sich dem europäischen Mittelwert
t solidarische Umverteilung erweist sich immer
angeglichen und ihn inzwischen sogar übertroffen – eine
wieder als resistent gegenüber Abbautendenzen,
rasante Entwicklung innerhalb von weniger als 20 Jahren
Ökonomisierungstrends, Individualisierungs-
(vgl. Abbildungen 1 und 2).
und Privatisierungsversuchen.
Dennoch haben auch wir die Befürchtung des Die Erklärung der Demokratieforschung für diese Ent-
Soziologen Zygmunt Baumans, der Sozialstaat wicklung lautet, dass die basisdemokratische Struktur der
sei zum Sicherheitsstaat degeneriert, ernst zu Schweiz die Einführung neuer Leistungs- und Umvertei-
nehmen. Bauman zufolge haben die Regie- lungssysteme zwar erheblich erschwert; sind diese jedoch
rungen den existenziellen Schutz der Bürgerin- erst eingeführt, erweisen sie sich als hochresistent.
nen und Bürger aufgegeben und gebärden sich
stattdessen als der letzte Schutzwall für das Da sich die Schweiz also nicht mehr ohne Weiteres als
individuelle Überleben der BürgerInnen gegen Modell des liberalen Wohlfahrtsstaates bezeichnen lässt,
unheimliche Gefahren, die irgendwo im Dunkel wurde jüngst vorgeschlagen, ihren «Sonderweg» als Vor-
lauern sollen. boten eines neuen Regimetyps zu fassen, der die klassi-
In den kommenden Jahren stehen mehrere Revi- sche, von Esping-Andersen beschriebene Trias liberal/kon-
sionen zu verschiedenen Sozialversicherungs- servativ/sozialistisch um die «garantistische» Dimension
zweigen an. Die Diskussion um die Dynamik von erweitert (Opielka 2004b). In der Schweiz mit ihren unge-
Integration und Exklusion durch die Gesetz- wöhnlich stark am Bürgerstatus und an Teilhaberechten
gebung und vor allem bei der Anwendung der fokussierten Leistungssystemen (AHV/IV, Kopfprämien
Gesetze ist von höchster Aktualität. Mehrere usf.) scheint sich eine neuartige Synthese der bisherigen
Projekte aus dem NFP 51 werden hierzu wertvol- politischen Grossmodelle zumindest in der Sozialpolitik
le Beiträge liefern können. Nicht zufällig bildet entwickelt zu haben.
dieses Thema einen der Schwerpunkte des
Programms. In Abbildung 3 sind die vier Regimetypen und ihre Variablen
zusammengestellt. Mit Hilfe der den Variablen beigegebe-
Dr. Claudia Kaufmann nen Indikatoren kann der Regimetyp eines Wohlfahrts-
Mitglied der Leitungsgruppe des NFP 51 staates ermittelt werden. Für die drei klassischen Regime-
typen wurden die Zuordnungen von Esping-Andersen bzw.
Abbildung 1
Soziallast- und Sozialleistungsquote Schweiz 1948 –2001 (in Prozent des Bruttoinlandsprodukts)
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2001
Soziallastquote Nationale Buchhaltung Soziallastquote Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Sozialleistungsquote Nationale Buchhaltung Sozialleistungsquote Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Soziallast- und Sozialleistungsquote gemäss Nationaler Buchhaltung (1948–1995) und gemäss Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnung VGR (1990–2001)
Quelle: BSV, Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2004, Bern, S. 70
2 NFP 51 Bulletin Nr. 2 | Dezember 2005aus der Sekundärliteratur übernommen. Für den Typus Abbildung 2
«Garantismus» liegen vergleichbare Berechnungen noch Sozialschutzausgaben 2001 im europäischen Vergleich
nicht vor, sie beruhen daher auf Schätzungen und Erfah- (in Prozent des Bruttoinlandsprodukts)
rungswerten.
Irland 14.6 %
In Abbildung 4 wird die Regimetypologie soziologisch-sys- Island 20.1 %
tematisch skizziert, wobei die Schweizer und – zum Spanien 20.1 %
Luxemburg 21.2 %
Vergleich – die deutschen Sozialpolitikfelder entsprechend Portugal 23.9 %
zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass die Regimetypen Italien 25.6 %
einerseits (vertikale Achse) über Sozialpolitikfelder und Norwegen 25.6 %
deren Hauptproblemstellung mit den vier zentralen gesell- Finnland 25.8 %
Griechenland 27.2 %
schaftlichen Subsystemen – Wirtschaft, Politik, Gemein-
Grossbritannien 27.2 %
schaft, Legitimation – in Verbindung gebracht werden EUR-12 27.4 %
(Beispiel: Dekommodifizierung als Unabhängigkeit von EUR-11 27.4 %
Marktkräften wirkt v.a. im Wirtschaftssystem). Anderer- EU-15 27.5 %
Belgien 27.5 %
seits wird gezeigt, dass jeder Regimetyp ein spezifisches
Niederlande 27.6 %
Steuerungsprinzip in den Mittelpunkt stellt (beispielsweise Österreich 28.4 %
der Liberalismus den Markt; horizontale Achse, oben). Schweiz 28.9 %
Dänemark 29.5 %
Deutschland 29.8 %
Hinsichtlich der Regimezuordnungen verschiedener Poli-
Frankreich 30.0 %
tikfelder gilt: Staaten können auf dem einen Sozialpolitik- Schweden 31.3 %
gebiet eher liberal, auf einem anderen dagegen sozialistisch 0% 10 % 20 % 30 %
sein; ein klassisches Beispiel dafür ist Grossbritannien, das
Quelle: BSV, Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2004,
als Stammland des Liberalismus über ein staatliches Ge-
Bern, S. 62
sundheitswesen verfügt.
Der letzte Schweizer Familienbericht von 2004 (der erste
entstand 1978) machte darauf aufmerksam, dass die
Schweizer Familienpolitik trotz der im europäischen
Vergleich hohen Frauenerwerbsquote sowohl hinsichtlich
des Ausgabenniveaus wie ihrer qualitativen Schwerpunkte
noch sehr residual, d.h. minimalistisch ausgerichtet ist, vative Verbändeherrschaft (Korporatismus), aber ebenso
was dem liberalen Welfare-Regimetyp entspricht. Insoweit wenig auch eine liberale Marktideologie in der Sozial-
bedarf jede makrotheoretische Verortung von Sozial- politik durchsetzen.
politiksystemen der Ergänzung durch Detailanalysen.
Diese Grundrechtsdynamik hängt gerade in der Schweiz
Dennoch: Die Regimetypologie kann einen erheblichen mit der direkten Demokratie zusammen, die – anders als in
analytischen Ertrag abwerfen. Sie lenkt den Blick vor allem Kalifornien, der einzigen weltweit vergleichbaren politi-
auf die Dimension der sozialpolitischen Kultur. Die klassi- schen Einheit – auf Bundes-, also nationaler Ebene sozial-
schen Politiklegitimationen liberal/sozialistisch/konserva- politische Entscheidungen prägt (vgl. Obinger/Wagschal
tiv – also Mitte/Links/Rechts – wurden in den letzten Jahr- 2001). Für die politische Gemeinschaft der Schweiz ist
zehnten durch eine globale Agenda sozialer Grundrechte dabei die Entwicklungsdynamik und -logik der Renten-
herausgefordert, die sich nicht umstandslos dieser Trias versicherung AHV von fundamentaler Bedeutung. Indem
unterordnen lässt. Es gibt starke Argumente dafür, dass sie praktisch die gesamte erwachsene Bevölkerung ein-
Demokratien eine evolutionäre Dynamik hin zu sozialen schliesst – was seit 1996 durch die finanztechnisch anders
Grundrechten entfalten, die durch geeignete Politikstruk- organisierte «Kopfpauschale» auch in der Krankenver-
turen (v. a. direkte Demokratie) gestützt werden. Der sicherung geschieht –, werden Teilhaberechte tendenziell
Regimetyp «Garantismus» trägt dieser Dynamik Rech- grundrechtsähnlich garantiert. Es gibt zudem gute Gründe
nung. Der Schweizer Wohlfahrtsstaat kann vor diesem zu der Annahme, dass die garantistische Regime-Konzep-
Hintergrund als «weich garantistisch» (Carigiet/Opielka tion angesichts eines globalen Sozialabbaus und -umbaus
2006) gelten. In der Schweiz konnte sich weder sozialde- als krisenresistenter gelten kann. In diese Richtung wei-
mokratische Staatszentrierung (Etatismus) noch konser- sen neuere Studien der Weltbank (z. B. Queisser/White-
NFP 51 Bulletin Nr. 2 | Dezember 2005 3Abbildung 3
Vier Typen des Wohlfahrtsregimes
Variable Typen des Wohlfahrtsregimes
– Indikatoren liberal sozialdemokratisch konservativ garantistisch
Dekommodifizierung: Schutz gegen Marktkräfte schwach stark mittel stark
und Einkommensausfälle (für «Familien-
– Einkommensersatzquoten ernährer»)
– Anteil individueller Finanzierungsbeiträge (invers)
Residualismus stark schwach stark schwach
– Anteil von Fürsorgeleistungen an gesamten
Sozialausgaben
Privatisierung hoch niedrig–mittel niedrig–mittel mittel
– Anteil privater Ausgaben für Alter bzw. Gesundheit
an jeweiligen Gesamtausgaben
Korporatismus/Etatismus 1 schwach mittel stark schwach
– Anzahl von nach Berufsgruppen differenzierten
Sicherungssystemen
– Anteil der Ausgaben für Beamtenversorgung
Umverteilung schwach stark schwach mittel
– Progressionsgrad des Steuersystems
– Gleichheit der Leistungen
Vollbeschäftigungsgarantie schwach stark mittel mittel
– Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik
– Arbeitslosenquote, gewichtet nach
Erwerbsbeteiligung
Bedeutung von
– Markt zentral marginal marginal mittel
– Staat marginal zentral subsidiär subsidiär
– Familie/Gemeinschaft marginal marginal zentral mittel
– Menschen-/Grundrechte mittel–hoch mittel marginal zentral
Dominante Form der individualistisch lohnarbeits- kommunitaristisch- Bürgerstatus,
sozialstaatlichen Solidarität zentriert etatistisch universalistisch
Dominante Form der Markt Staat Moral Ethik
sozialstaatlichen Steuerung
Empirische Beispiele USA Schweden Deutschland, Italien Schweiz
(«weicher
Garantismus»)
1Korporatismus: hohes Mass an unmittelbarer Aushandlung zwischen Interessenverbänden (v.a. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) und Staat;
Etatismus: hohe Bedeutung staatlicher Intervention, insbesondere des Zentralstaats
Quelle: Opielka 2004b, S. 35 (nach G. Esping-Andersen und J. Kohl), überarbeitet und erweitert
4 NFP 51 Bulletin Nr. 2 | Dezember 2005Abbildung 4
Rekombination der vier Typen des Wohlfahrtsregimes mit gesellschaftlichen Subsystembezügen
am Beispiel Schweiz–Deutschland
Wohlfahrtsregime
Politisches Wohlfahrtsregime liberal sozialistisch konservativ garantistisch
Legitimationsmodell (Markt) (sozial- (Moral) (Ethik)
(Level 4) a demokratisch)
(Staat)
Gemeinschaft Care-Arrangement privat öffentlich privat gemischt
(Level 3) (Familienpolitik b ) (CH) (D)
Politik Ungleichheit hoch gering mittel mittel
(Level 2) (Steuerpolitik b ) (D) (CH)
Wirtschaft Dekommodifizierung gering mittel gering hoch
(Level 1) (Arbeitsmarkt, Rente, (CH d ) (D) (CH c )
Gesundheit b)
a Legitimativ dominierendes Steuerungsprinzip («strukturelle Institution»), die Bezeichnung Level bezieht sich auf die steigenden
Stufen systemischer Komplexität der Subsysteme der Gesellschaft (vgl. Opielka 2004a).
b Dominante sozialpolitische Regulierungsbereiche.
c Hohe Dekommodifizierung der Schweiz nur für Rente und Gesundheit.
d Die Arbeitsmarktpolitik der Schweiz ist eher liberal ausgerichtet.
house 2003), die dem Schweizer Drei-Säulen-System, darin digma verhaftet scheinen. So fordert der Arbeitgeber-
vor allem der AHV, eine weltweite Modellfunktion in Bezug vertreter Hasler in besagtem Artikel, dass die Firmen
auf ökonomische Nachhaltigkeit und Schutz vor Armut durch die Arbeitsintegration nicht überfordert werden
bescheinigen. dürften: «Das muss die vermittelnde Behörde übernehmen
können.» Zugleich scheint ihm dieses (etatistische) Dele-
Quo vadis, Schweiz? gieren von Sozialverantwortung an den Staat nicht ganz
Der Direktor des Schweizer Arbeitgeberverbandes, Peter geheuer: «Es besteht zumindest eine gesellschaftlich-
Hasler, hat in der Neuen Zürcher Zeitung (3.10. 2005, S. 7) moralische Mitverantwortung, sich um eingliederungsbe-
von «nötige(n) Tabubrüche bei Sozialpartnern und Gesell- dürftige Menschen zu kümmern und diese Aufgabe nicht
schaft» gesprochen und «Arbeitsintegration als Königs- einfach dem Staat zu überlassen.» Diese Widersprüchlich-
weg» bezeichnet: «Wer nicht spurt, muss den Anspruch auf keiten können positiv interpretiert werden: Teilhaberechte
Taggelder oder andere Leistungen verlieren.» Markige werden in der Schweiz breit akzeptiert. Unklar ist freilich
Forderungen nach Aktivierung bzw. workfare statt welfare häufig, wie sie zu realisieren sind.
kennzeichnen die Sozialpolitikdiskussion der letzten zehn
Jahre in fast allen westlichen Wohlfahrtsstaaten (von der Die Schweizer Sozialpolitik steht in den nächsten Jahren
Sozialhilfereform unter Clinton 1996 bis zu Agenda 2010 vor der Herausforderung, in der Familien-, Arbeitsmarkt-
und Hartz IV in Deutschland). Inwieweit stellt diese Ent- und Armutspolitik Konzepte zu entwickeln, die Teilhabe
wicklung die skizzierte «garantistische» Ausrichtung des garantieren und damit Exklusion verhindern, wie dies in
Schweizer Sozialstaats in Frage? der Renten- und Gesundheitspolitik in recht vorbildlicher
Weise gelang. Aus wissenschaftlicher Sicht lassen sich vor
Es ist wichtig zu unterscheiden, dass wir von «weichem» diesem Hintergrund durchaus Empfehlungen geben.
Garantismus im Wesentlichen nur im Hinblick auf die Teilhabe erfordert Verfügung über Ressourcen, soziale
Sozialpolitikfelder Alterssicherung und Gesundheit spra- Grundrechte erfordern ein hohes Mass an Standardisie-
chen, während die Familien- und Arbeitsmarktpolitik (ein- rung. Soziale Dienste, von der Kindertagesstätte bis zur
schliesslich Armutspolitik) noch stark dem liberalen Para- Berufsintegration, müssen zwar am individuellen Fall aus-
NFP 51 Bulletin Nr. 2 | Dezember 2005 5gerichtet sein, um effektiv zu sein. Ihre Finanzierung frei- erkennung erhalten, die im Leistungswettbewerb des
lich darf nicht zu sehr von lokalen und kantonalen Arbeitsmarktes nicht mithalten können – oder deren
Zufällen abhängen. Das ist eine der Lehren der Kranken- Leistungen (noch) nicht ausreichend gewürdigt werden,
versicherung. wie bspw. die Erziehungsleistung in der Familie. Modelle
eines Grundeinkommens – verbunden mit professionellen
Eine der grossen Stärken der Schweizer Sozialpolitik ist sozialen Diensten – könnten ein tragfähiger Kompromiss
die Mischung aus Pragmatismus und sozialer Wertorien- zwischen Förderung von Leistungswillen und garantierten
tierung, die auch in Referenden zum Ausdruck kommt. Die Teilhaberechten sein.
liberale Grundorientierung des Arbeitsmarktes steht nicht
in Frage. Vollbeschäftigung kann durch Strukturpolitik 1Verhältnis von Sozialleistungen und Bruttoinlandsprodukt.
In den Übersichten des Bundesamts für Sozialversicherung (BSV)
unterstützt, durch politische Interventionen aber nicht
werden auch die Begriffe «Soziallastquote» (siehe Abbildung 1)
garantiert werden. Es wäre zu bedenken, ob die guten
und «Sozialschutzausgaben» (siehe Abbildung 2) verwendet.
Erfahrungen mit der AHV übertragen werden könnten auf
eine «Grundeinkommensversicherung» nach dem gleichen
Prinzip, die alle Einkommensleistungen des Sozialstaats Literatur
zusammenfasst und allen vermittlungsbereiten Arbeits- Carigiet, Erwin/Opielka, Michael, 2006, «Deutsche Arbeitnehmer –
losen, Personen in formalen Ausbildungen, Eltern mit klei- Schweizer Bürger? Zum deutsch-schweizerischen Vergleich sozialpoliti-
nen Kindern, Erwerbsunfähigen und Langzeitkranken ein scher Dynamiken», in: Carigiet, Erwin/Mäder, Ueli/Opielka,
Michael/Schulz-Nieswandt, Frank (Hrsg.), «Wohlstand durch Gerechtigkeit.
Grundeinkommen – und, wie in der AHV, maximal das
Deutschland und die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich», Zürich:
Doppelte des Grundeinkommens – garantiert. Diejenigen Rotpunkt Verlag (i.V.)
Personen, die arbeitslos, aber nicht vermittlungsbereit
Esping-Andersen, Gøsta, 1990, «The three worlds of welfare capitalism»,
sind, würden 50 Prozent des Grundeinkommens als rück-
Princeton: Princeton University Press
zahlbares Darlehen erhalten (vgl. Opielka 2004b). Ein sol-
ches Modell könnte für alle politischen Lager akzeptabel Obinger, Herbert/Wagschal, Uwe, 2001, «Zwischen Reform und Blockade:
Plebiszite und der Steuer- und Wohlfahrtsstaat», in: Schmidt, Manfred G.
sein und damit auch in einem Referendum mit Annahme
(Hrsg.), «Wohlfahrtsstaatliche Politik. Institutionen, politischer Prozess
rechnen – natürlich erst nach ausführlicher öffentlicher
und Leistungsprofil», Opladen: Leske + Budrich, S. 90-123
Diskussion.
Opielka, Michael, 2004a, «Gemeinschaft in Gesellschaft. Soziologie nach
Hegel und Parsons», Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass sich dieses
ders., 2004b, «Sozialpolitik. Grundlagen und vergleichende Perspektiven»,
Paradigma im weiteren Globalisierungsprozess als nach- Reinbek: Rowohlt (rowohlts enzyklopädie)
haltig erweist. Vollbeschäftigung, also existenzsichernde,
Queisser, Monika/Whitehouse, Edward, 2003, «Individual choice in social
ganztägige und lebenslange Arbeit für alle Männer und
protection: The case of Swiss pensions», OECD working paper
Frauen ist realistischerweise nicht zu erwarten. Die Sozial- DELSA/ELSA/WD/SEM(2003)11, Paris: OECD
politik darf Leistung nicht behindern, sie darf sie aber
andererseits auch nicht auf den Arbeitsmarkt beschrän-
ken, weil sonst die Bürgerinnen und Bürger keine An-
Prof. Dr. rer. soc. Michael Opielka, Dipl.-Päd., Jg. 1956, Studium der Rechtswissenschaften, Erziehungswissenschaften,
Philosophie und Ethnologie an den Universitäten Tübingen, Zürich und Bonn, Promotion in Soziologie an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Nach seiner Tätigkeit u.a. als Vorstand der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie in Bensheim, als
Abteilungsleiter am Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg und als
Rektor der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn seit 2000 Professor
für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena. 2004-06 zudem Visiting Scholar an der University
of California at Berkeley, School of Social Welfare.
Kontakt
Prof. Dr. Michael Opielka
Fachhochschule Jena, Fachbereich Sozialwesen
Carl-Zeiss-Promenade 2, D-07745 Jena
michael.opielka@fh-jena.de
6 NFP 51 Bulletin Nr. 2 | Dezember 2005Sie können auch lesen