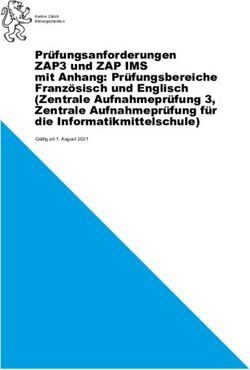Pädagogisches Konzept zum Einsatz eines Schulhundes an der Pestalozzischule Horb a. N - Pestalozzischule Sonderpädagogisches Bildungs- und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Pestalozzischule
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
Geistige Entwicklung
Nordring 2
72160 Horb am Neckar
Pädagogisches Konzept zum
Einsatz eines Schulhundes an der
Pestalozzischule Horb a. N.
vorgelegt von:
Annalena Helfert
04. Mai 2020Inhalt
1. Grundlagen der hundegestützten Pädagogik ..................................................................... 2
1.1 Definitionen .................................................................................................................. 2
1.2 Begründung für einen Schulhund an der Pestalozzischule Horb a. N........................... 3
2. Voraussetzungen des Schulhundeeinsatzes ..................................................................... 5
2.1 Grundvoraussetzungen beim Schulhund ..................................................................... 5
2.2 Die hundeführende Lehrkraft........................................................................................ 6
2.3 Schulische Grundvoraussetzungen .............................................................................. 7
2.3.1 Einverständnis der Schulgemeinschaft .................................................................. 7
2.3.2 Hygieneplan .......................................................................................................... 7
2.3.3 Sicherheit und Umgangsregeln mit dem Hund ....................................................... 8
2.3.4 Versicherung ......................................................................................................... 9
3. Die Praxis der hundegestützten Pädagogik an der Pestalozzischule Horb a. N. ................ 9
3.1 Die Hündin Rosi ........................................................................................................... 9
3.2 Einsatzplanung ...........................................................................................................10
4. Literatur ............................................................................................................................12
11. Grundlagen der hundegestützten Pädagogik
„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund“
(Hildegard von Bingen)
In Deutschland nimmt die Anzahl von Schulhunden in den letzten Jahren stark zu. Allerdings
gibt es auch eine Vielzahl von Begrifflichkeiten, die den Einsatz von Hunden in Therapie,
Schule und Gesundheitswesen beschreiben (vgl. Heyer/ Kloke 2013, 16). Daher sollen im Fol-
genden die Begriffe ‚tiergestützte Pädagogik‘, ‚hundegestützte Pädagogik‘ sowie der Begriff
‚Schulhund‘ definiert (1.1) und die positiven Auswirkungen eines Schulhunds erläutert werden
(1.2).
1.1 Definitionen
Die tiergestützte Pädagogik ist ein Teil des umfassenden Begriffs der ‚tiergestützten Interven-
tionen‘. Die International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) de-
finiert tiergestützte Interventionen als „zielgerichtete und strukturierte Intervention, die bewusst
Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und Sozialer Arbeit einbezieht und integriert, um the-
rapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen“ (IAHAIO 2013, 1). Folglich geht es
bei dem Einsatz von Tieren in der Pädagogik stets um einen systematischen und zielgerichte-
ten Einsatz.
Der Begriff der tiergestützten Pädagogik wird von der internationalen Arbeitsgruppe als eine
„zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention“ konkretisiert, die stets von (sonder-)pä-
dagogisch ausgebildeten Lehrpersonen durchgeführt wird (vgl. IAHAIO 2013, 2). Auch Heyer
und Kloke (vgl. 2013, 16) zufolge, erfolgen Maßnahmen der tiergestützten Pädagogik über-
wiegend im Klassenzimmer, um vorrangig pädagogische Zielsetzungen zu erreichen.
Da im pädagogischen Kontext insbesondere Hunde eingesetzt werden, ist der Begriff ‚hunde-
gestützte Pädagogik‘ entstanden. Unter diesem Begriff versteht man den „systematischen;
A.H. Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre
und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler“ (Heyer/ Kloke
2013, 17). Da es bei diesen Einsätzen folglich um Maßnahmen mit pädagogischen Zielen geht,
sollte von den eingesetzten Hunden nicht als ‚Therapie(begleit-)Hunden‘, sondern von Schul-
hunden gesprochen werden (vgl. ebd., 18). Schulhunde sind speziell ausgebildete Hunde, die
die Lehrkraft regelmäßig in deren Unterricht begleiten und von dieser aktiv in den Unterricht
eingebunden werden. Ziel ist es, pädagogische Prozesse zu unterstützen sowie die sozial-
emotionalen Kompetenzen, die Kommunikationsfähigkeit sowie die psychische und physische
Gesundheit der SchülerInnen zu fördern (vgl. Heyer/ Kloke 2013, 18; schulhundweb.de 2011,
1).
21.2 Begründung für einen Schulhund an der Pestalozzischule Horb a. N.
Leider gibt es bisher kaum wissenschaftlich abgesicherte Studien zu den Effekten von tierge-
stützten Interventionen. Doch sowohl die vorliegenden empirisch abgesicherten Studien als
auch zahlreiche Studien mit geringer Teilnehmeranzahl sowie weitere Beobachtungsstudien
und Berichte lassen den Schluss zu, dass tiergestützte Interventionen positive Effekte auf die
TeilnehmerInnen haben kann (vgl. Vernooij/ Schneider 2013, 114).
Stressreduktion und positive Lernatmosphäre
Zahlreiche Studien legen einen positiven Effekt von Heimtieren auf die Gesundheit von deren
BesitzerInnen nahe. Beispielsweise schützt insbesondere der Besitz eines Hundes vor kardi-
ovaskulären Risiken (vgl. Julius et al. 2014, 62ff). Diese Erkenntnis steht in einem engen Zu-
sammenhang zu der Vielzahl an empirisch abgesicherten Studien, die eine stressreduzierende
Wirkung von Tieren nachweisen. Bereits die Anwesenheit eines Hundes und insbesondere
der Körperkontakt zum Hund (z.B. durch Streicheln) führte zu einer niedrigeren Herzfrequenz
und einem niedrigeren Blutdruck der VersuchteilnehmerInnen. Außerdem ließ sich eine Re-
duktion von Stresshormonen in deren Blut und Speichel feststellen. Dies traf sowohl in stress-
auslösenden Situationen als auch in Alltagssituationen zu (vgl. Julius et al. 2014, 79ff). Durch
den Kontakt zu einem Tier kann zudem das subjektive Erleben von Angst minimiert werden.
Allein die Anwesenheit eines Tieres führt zu einem erhöhten Ruheempfinden (vgl. Julius et al.,
72). Darüber hinaus haben die Interaktion und der Kontakt zu einem Tier eine stimmungsauf-
hellende Wirkung (vgl. Julius et al. 2014, 74).
Ein Hund im Klassenzimmer kann folglich Stress und Angst von SchülerInnen reduzieren und
gleichzeitig mehr Ruhe und positive Emotionen bewirken. Auf diese Weise kann die Lernat-
mosphäre positiv verändert werden. Ein entspanntes und stressfreies Unterrichtsklima kann
wiederum den Lernerfolg und die Lernmotivation von SchülerInnen steigern (vgl. Heyer/ Kloke
2013, 21).
Unterstützung beim Lernen
Die Studienlage weist darauf hin, dass SchülerInnen von einem Schulhund nicht vom Lernen
abgelenkt, sondern vielmehr durch die Anwesenheit eines Hundes beim Lernen unterstützt
werden. Im pädagogischen Setting scheinen Hunde die Konzentration und die Lernprozesse
bei Kindern (z.B. bei Zuordnungsaufgaben oder motorischen Geschicklichkeitsaufgaben) zu
fördern (vgl. Julius et al., 68f). Vernooij und Schneider (vgl. 2014, 140) verdeutlichen, dass es
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigung jedoch nicht (nur) darum
geht, deren kognitiven und schulischen Leistungen zu verbessern. Vielmehr kann beispiels-
weise das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten durch die unvoreingenommene Wertschät-
zung, die ein Tier einem Menschen entgegenbringt, gefördert werden. Ein höheres Selbstver-
trauen kann wiederum zu einer höheren Lernmotivation führen, da sich die SchülerInnen die
3Bewältigung der an sie gestellten Aufgaben zutrauen (vgl. ebd.). Auch auf diesem Weg kann
ein Schulhund das Lernen von SchülerInnen positiv beeinflussen.
Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen
Tiere bieten eine besondere Form des sozialen Lernens, denn sie reagieren unmittelbar und
ehrlich auf die Kontaktaufnahme zu ihnen. Wird ein Hund unsanft berührt, wird er zurückwei-
chen und sich von der Person abwenden. Ein freundlicher und gewaltfreier Umgang mit einem
Hund wird vom Hund mit Schwanzwedeln, Zuneigung und Freude belohnt. Auf diese Weise
erleben SchülerInnen im Umgang mit einem Schulhund unmittelbar Konsequenzen auf ihr
Handeln. Dies kann das Empathiebewusstsein der SchülerInnen stärken und dazu beitragen,
dass sie die im Umgang mit den Tieren erlernten Verhaltensweisen auf soziale Interaktionen
mit Menschen übertragen (vgl. Heyer/ Kloke 2013, 20f). Der Kontakt mit einem Hund bietet
den SchülerInnen zudem die Möglichkeit, ihre Frustrationstoleranz zu steigern und ihre Emo-
tionen zu regulieren: Kinder und Jugendliche müssen lernen, dass ein Tier auch Ruhepausen
benötigt und nicht ständig gestreichelt werden möchte. Dies kann ihrem eigenen Kontaktbe-
dürfnis zum Tier entgegenstehen und so zu Frust führen. Insbesondere SchülerInnen, die bei
Frustration eher mit Aggression oder Ungeduld reagieren, kann sich so ein wichtiges Lernfeld
eröffnen. Denn mit Ausdauer, Geduld und Freundlichkeit wird ein Tier eher den Kontakt su-
chen, als durch ein impulsives und lautes Annähern (vgl. Vernooij/ Schneider 2014, 137). Al-
lerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Studienlage zur Förderung von Em-
pathie und zur Reduktion von aggressivem Verhalten nicht ausreicht, um eindeutig positive
Effekte von tiergestützten Interventionen abzuleiten (vgl. Julius et al. 2014, 69f; 75).
Darüber hinaus kann der Kontakt zu einem Tier das Selbstbewusstsein von SchülerInnen stär-
ken. Der Grund liegt darin, dass sich besonders Kinder im Umgang mit einem Tier als „kom-
petent und mündig handelnde Wesen“ erleben (Heyer/ Kloke 2013, 21). Sie bekommen vom
Tier eine sofortige Rückmeldung auf ihr Handeln und können so lernen, Verantwortung für ihr
eigenes Handeln zu übernehmen. Beim Einsatz eines Schulhundes kann die Lehrkraft durch
die Vergabe von Ämtern (z.B. Befüllen des Wassernapfes) den SchülerInnen darüber hinaus
konkrete Möglichkeiten bieten, für ein Tier Verantwortung zu übernehmen.
Zuletzt haben Mensch-Tier-Interaktionen Julius et al. (vgl. 2014; 68) zufolge das Potenzial,
das soziale Miteinander von Menschen sowie prosoziale Verhaltensweisen gegenüber dem
Tier, aber auch seinen Mitmenschen, zu fördern. Demzufolge ermöglicht der Einsatz eines
Schulhundes den SchülerInnen auf vielfältige Weise, ihre sozial-emotionalen Kompetenzen zu
erweitern.
Förderung von Sprache und Kommunikation
Um mit einem Tier interagieren zu können, sind Worte nicht zwingend notwendig. Die Körper-
sprache und das Verhalten eines Tieres können genau beobachtet werden. Dann können
Menschen non-verbal (z.B. durch Streicheln oder Blickkontakt) Kontakt mit dem Tier
4aufnehmen und aufrechterhalten. Das Tier wiederum gibt durch seine Mimik und Gestik (z.B.
Schwanzwedeln, Ohren anlegen, zurückweichen) wiederum eine non-verbale Rückmeldung
(vgl. Vernooij/ Schneider 2014, 128). Zum einen ermöglicht dies SchülerInnen mit einer
sprachlichen Beeinträchtigung, selbstständig und ohne Hilfsmittel zu kommunizieren. Zum an-
deren werden die non-verbalen Kommunikationsfähigkeiten bei allen SchülerInnen gefördert.
Darüber hinaus können auch die sprachlichen Kompetenzen der SchülerInnen durch den Um-
gang mit einem Hund erweitert werden: Sie können lernen, ihm Kommandos zu geben und
müssen hierbei beispielsweise auf eine möglichst korrekte Aussprache achten. Zudem bietet
der Hund für die SchülerInnen motivierende Gesprächsanlässe (vgl. Vernooij/ Schneider 2014,
143). Demzufolge können durch den Einsatz eines Schulhundes die (non-)verbalen kommu-
nikativen Kompetenzen von SchülerInnen gefördert werden.
Die Pestalozzischule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die Förderung der sozial-emotionalen und kommu-
nikativen Kompetenzen der SchülerInnen ist im Leitbild der Schule verankert. Für die Schüle-
rInnen der Pestalozzischule ermöglicht der Einsatz eines Schulhundes ein großes Lernfeld,
um ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen zu erweitern. Darüber hinaus, kann durch die Anwe-
senheit und den Umgang mit einem Hund wie erläutert eine stressfreie und ruhige Lernat-
mosphäre hergestellt werden, die die SchülerInnen beim Lernen unterstützt.
2. Voraussetzungen des Schulhundeeinsatzes
2.1 Grundvoraussetzungen beim Schulhund
Es existiert nicht „der Schulhund“, weder in Bezug auf eine Rasse, noch bezüglich eines be-
stimmten Aussehens (Fell, Größe, Farbe). Dennoch gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die
ein Schulhund erfüllen sollte:
offen und kontaktfreudig gegenüber Menschen
kein Herdenschutztrieb
ausgeglichenes Wesen
gehorsam
nicht sehr bellfreudig
verträglich mit Kindern
keinerlei aggressive Ausstrahlung
ausgeprägte Beißhemmung
nicht sehr geräuschempfindlich
nicht ängstlich oder unsicher (vgl. schulhundweb.de 2006, 1).
5Im Allgemeinen hängen die Grundvoraussetzungen auf Seiten des Hundes allerdings auch
sehr stark vom Kontext ab, in dem er eingesetzt wird. Der Einsatz des Hundes sollte vom
Hundeführer/ von der Hundeführerin stets so geplant sein, dass der Hund seinen Eigenschaf-
ten und Bedürfnissen gemäß interagieren kann. Der Hundeführer/ die Hundeführerin sollte den
Hund während eines Einsatzes stets beobachten, damit er/ sie Stresssymptome sofort erken-
nen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen kann (vgl. schulhundweb.de 2006, 1).
Darüber hinaus sollte der eingesetzte Hund gesund, schmerzfrei und geimpft sein sowie re-
gelmäßig entwurmt werden. Ein tierärztlicher Nachweis über die Gesundheit des Hundes ist
in regelmäßigen Abständen vorzulegen (vgl. schulhundweb.de 2019, 1).
Hündin Rosi, die an der Pestalozzischule eingesetzt werden soll, erfüllt die genannten Voraus-
setzungen und insbesondere ihr freudiges, menschenorientiertes sowie kinderfreundliches
Wesen zeichnet sie aus. Die Grundausbildung ist abgeschlossen. Der Nachweis der prakti-
schen und theoretischen Prüfung des IBH Hundeführerscheins (Juni 2019) liegt vor (siehe
4.1).
Es gibt in Deutschland keine einheitliche, anerkannte Ausbildung zum Schulhund (vgl. schul-
hundweb.de 2019, 1). Rosi wartet derzeit auf einen Platz für eine einjährige Ausbildung zum
Schulhund beim Arbeitskreis Schulhunde Bayern e.V..
In der Schule ist eine Dokumentation über Ausbildungs- und Gesundheitsstand, die Nach-
weise über Impfung, Haftpflichtversicherung sowie ein Entwurmungsprotokoll hinterlegt.
2.2 Die hundeführende Lehrkraft
Die hundeführende Lehrkraft verfügt über theoretisches und praktisches Wissen sowie Erfah-
rung im Umgang und der Ausbildung von Hunden. Der Hund lebt in der Familie der hundefüh-
renden Lehrkraft und hat eine enge Bindung zu der Hundeführerin. Insbesondere die gute
Bindung zwischen Lehrkraft und Hund ist für das Gelingen der hundegestützten Pädagogik
auschlaggebend. Diese Bindung vermittelt dem Hund Sicherheit und ermöglicht ihm, sich stets
an seiner Bezugsperson zu orientieren (vgl. schulhundweb.de 2007, 1; Vernooij/ Schneider
2014, 103). Die Lehrkraft trägt die Verantwortung für eine artgerechte Versorgung und die
medizinische Gesunderhaltung des Hundes.
Wie bereits erwähnt gibt es in Deutschland keine einheitliche anerkannte Ausbildung zum
Schulhund. Eine im Jahr 2015 vom Fachkreis Schulhunde und vom Arbeitskreis Schulhund-
Team-Ausbildung überarbeitete freiwillige Selbstverpflichtung ist derzeit „das einzige bundes-
weit geltende Gütekriterium, dem sich Hupäschlerinnen Hundegestützte Pädagogik an der
Schule, A.H. anschließen können, um einen qualifizierten Einsatz von Hunden in der Schule
zu verdeutlichen“ (schulhundeweb.de 2019, 1).
6Grundlage einer solchen Ausbildung ist ein Grundgehorsam des Hundes auf dem Niveau des
IBH Hundeführerscheins bzw. der Begleithundeprüfung (vgl. ebd.). Diese liegt bei Rosi und
Frau Helfert vor. Auf dieser Basisqualifikation aufbauend sollte eine spezialisierte Weiterbil-
dung im Hund-Mensch-Team erfolgen. Aufgrund der langen Wartelisten für eine Ausbildung
zum Schulhund, warten Rosi und ihre Hundeführerin derzeit noch auf einen Ausbildungsplatz.
2.3 Schulische Grundvoraussetzungen
Im Folgenden werden die schulischen Grundvoraussetzungen erläutert.
2.3.1 Einverständnis der Schulgemeinschaft
Die Pestalozzischule Horb am Neckar gehört zum Schulamtsbezirk Rastatt. Voraussetzung
für die Genehmigung eines Schulhundes ist unter anderem die Erlaubnis durch die Schullei-
tung und ein mehrheitliches Befürworten des Schulhundeeinsatzes durch die Gesamtlehrer-
konferenz, die Schulkonferenz und die (betreffende) Klassenpflegschaft.
Mit der Schulleitung wurde erstmals im November 2018 über die Möglichkeiten des Einsatzes
eines Schulhundes gesprochen. Sie sprach sich für die Schulhundearbeit aus und gab ihr Ein-
verständnis, das Vorhaben weiterzuverfolgen.
Die Gesamtlehrerkonferenz stimmte am 14. November 2018 mehrheitlich für den Einsatzes
eines Schulhundes, die Schulkonferenz am 05. Dezember 2018. Die Eltern der betroffenen
Klassen wurden informiert und eine schriftliche Einverständnis, einschließlich einer Abfrage
bezüglich Hundehaarallergien und einer starken Angst vor Hunden liegt vor. Der Hausmeister
und die Reinigungskräfte wurden über den Einsatz informiert.
2.3.2 Hygieneplan
Die Schulhündin Rosi wird zur hundegestützten Pädagogik an der Schule eingesetzt, um die
Arbeit der Lehrkraft u. a. in den Bereichen Emotionalität und Sozialverhalten, Lern- und Ar-
beitsverhalten, Sprache und Kommunikation zu unterstützen. Der Hygieneplan hat das Ziel,
eine mögliche Infektionsübertragung vom Hund auf den Menschen und umgekehrt zu mini-
mieren.
Ansprechpartnerinnen in Bezug auf die hygienischen Voraussetzungen beim Einsatz des
Schulhundes sind die Schulleitung sowie die Hundehalterin Annalena Helfert.
Der Hygieneplan basiert auf
§36 Infektionsschutzgesetz
BGV C8 (UVV Gesundheitsdienst)
§41 und §46 Allgemeine Schulordnung
Folgende Unterlagen vom Schulhund sind stets einzusehen:
Tierärztliches Gesundheitsattest
7 Impfausweis
Entwurmungsprotokoll
Versicherungsnachweis
Es gelten folgende Zugangsbeschränkung:
Der Hund erhält keinen Zugang zur Schulküche.
Der Kontakt mit SchülerInnen mit bekannter Hundeallergie wird vermieden.
Der Hund hat keinen Freilauf während der Essenszeiten der Kinder.
Einweghandschule, Kotbeutel sowie Desinfektionsmittel stehen im Klassenraum bereit. Im
Klassenzimmer befindet sich ein Waschbecken und ausreichend Seife, sodass sich die Schü-
lerInnen regelmäßig die Hände waschen können.
Die Anwesenheit des Hundes führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs- und Desin-
fektionszyklus. Es ist aber verstärkt darauf zu achten, dass die Hände regelmäßig vor der
Einnahme von Nahrung gründlich mit Reinigungsmitteln gesäubert werden.
2.3.3 Sicherheit und Umgangsregeln mit dem Hund
Die Schulhündin Rosi wurde u. a. auch danach ausgesucht, dass Verletzungen der SchülerIn-
nen weitgehend auszuschließen sind. Sie ist ruhig, zeigt keinerlei Aggression gegenüber Men-
schen und Artgenossen und zieht sich in Bedrängnis zurück. Im Juni 2019 absolvierte Rosi mit
ihrer Hundeführerin den IBH-Hundeführerschein. Dieser „ist der Nachweis, dass das erfolg-
reich geprüfte Mensch-Hund-Team sich in allen Alltagssituationen umsichtig und verantwor-
tungsvoll bewegt und der Hund jederzeit durch seine Bezugsperson kontrollierbar ist“ (IBH
2020, 1).
Im Bereich des Schulgebäudes wird Rosi mithilfe von Geschirr und Leine gesichert. Auf den
Fluren wird Rosi stets an der Leine geführt. So wird von der Hundeführerin gewährleistet, dass
Kinder, die Angst vor Hunden haben, sich sicher zu fühlen und nur bei eigenem Wunsch Kon-
takt zu Rosi aufzunehmen.
Die Schulhündin wird nicht ohne Aufsicht mit den SchülerInnen alleine gelassen. Sämtliche
Kontakte mit der Hündin laufen über die Lehrkraft geregelt ab, um Überforderung und eine zu
große Stressbelastung zu vermeiden. Während der Besuche der Schulhündin hängt ein ent-
sprechendes Schild an der Klassentür, sodass sich der / die Eintretende auf die Hündin ein-
stellen kann.
Die Besuche der Hündin in der Klasse werden von der Lehrkraft angekündigt. Der erste Be-
such der Schulhündin wird mit den SchülerInnen intensiv vorbereitet. Verhaltens- und Um-
gangsregeln mit dem Hund sowie die Körpersprache des Hundes und Kommunikation mit dem
Hund sind wichtige Inhalte.
8Die SchülerInnen werden immer wieder darin trainiert, adäquat auf die Hündin zuzugehen und
ihre Körpersprache richtig zu deuten.
Es gelten die folgenden Umgangsregeln mit der Schulhündin:
1. Wenn Rosi uns in der Klasse besuchen kommt, räume ich vorher auf. Es darf nichts
auf dem Boden liegen, was Rosi fressen könnte.
2. Rosi hat einen festen Platz (Hundebox) im Klassenzimmer. Wenn sie dort schläft, lasse
ich sie in Ruhe.
3. Ich bin leise und gehe langsam.
4. Ich streichle Rosi von unten. Ich weiß, wo und wie ich Rosi anfassen darf und halte
mich daran.
5. Ich streichle Rosi nur, wenn sie von sich aus zu mir kommt.
6. Ich lasse Rosi weggehen, wenn sie nicht mehr gestreichelt werden möchte.
7. Rosi möchte nur von einem Kind gleichzeitig gestreichelt werden.
8. Ich füttere Rosi nur, wenn ich ein Leckerli von Frau Helfert bekomme.
9. Ich gebe Rosi nur Kommandos, wenn es mir Frau Helfert erlaubt hat.
10. Ich nehme Rosi nichts aus dem Maul.
11. Nach dem Streicheln wasche ich mir die Hände.
Diese Regeln werden mit den SchülerInnen besprochen und mithilfe von Piktogrammen visu-
alisiert.
2.3.4 Versicherung
Rosi ist über die private Haftpflichtversicherung von Familie Helfert versichert. Die Tierhalter-
haftpflichtversicherung schließt auch das Schulgelände mit ein. Die wurde schriftlich von der
Versicherung bestätigt.
3. Die Praxis der hundegestützten Pädagogik an der Pestalozzischule
Horb a. N.
3.1 Die Hündin Rosi
Rosi wurde am 12. März 2018 geboren. Sie stammt aus einer privaten Zucht. Rosi ist gemein-
sam mit ihren Geschwistern und Eltern im Wohnzimmer einer sechsköpfigen Familie aufge-
wachsen. Ihr Vater ist ein reinrassiger Wetterhoun, ihre Mutter eine reinrassige Labrador-Hün-
din. Rosi kam in ihrer 14. Lebenswoche in die Familie von Frau Helfert. Sie wurde aufgrund
ihres ausgeglichenen Wesens ausgewählt. Rosi besuchte von Beginn an die Hundeschule.
Zunächst besuchte sie die Welpengruppe der „Happy Fiffy“ Hundeschule in Schriesheim. Da-
nach besuchte sie die vom Internationalen Berufsverband der Hundetrainer und Hundeunter-
nehmer (IBH) qualifizierte „Hundeschule Tandem“ in Loßburg und nahm dort mit ihrer Hunde-
führerin Einzel- und Gruppenunterricht. Im Juni 2019 absolvierte Rosi mit Frau Helfert den
9IBH-Hundeführerschein. Rosi wartet derzeit auf einen Platz in der Schulhundeausbildung beim
Arbeitskreis Schulhunde Bayern e.V..
Rosi ist eine aufgeweckte, freudige, aggressionsfreie und ausgeglichene Hündin. Sie ist sehr
menschenorientiert, kinderfreundlich und verschmust. Sie kann an allen Körperstellen berührt
werden – gefällt ihr eine Berührung nicht so gut, geht sie weg. Sie liebt ausgedehnte Spazier-
gänge, mag aber auch Apportierspiele und Tricktraining zu Hause.
Rosi ist privat in die Familie von Frau Helfert integriert. Sie lebt dort im Haus und wird artge-
recht versorgt.
3.2 Einsatzplanung
Rosi hatte bereits mehrmals die Gelegenheit das Schulgebäude ohne SchülerInnen und Lehr-
kräfte kennenzulernen. So ist sie mit den Gerüchen und den Begebenheiten vor Ort vertraut
und eine Überforderung wird vermieden.
Im Klassenraum befindet sich eine Hundebox, in der sich Rosi ausruhen kann. Aufgrund der
zuvor besprochenen Regeln wissen die SchülerInnen, dass sie die Hündin dort nicht stören
dürfen. Rosi geht auf Kommando in die Box und kann dort verbleiben bis sie Frau Helfert
abgerufen wird. Zudem befindet sich im Klassenraum ein Wassernapf für Rosi, der vor dem
Einsatz von einem Schüle / einer Schülerin befüllt wird.
Der Einsatz von Rosi ist in der Klasse geplant, in der Frau Helfert unterrichtet. Bevor Rosi zum
ersten Mal die SchülerInnen besucht, werden diese auf den Hundebesuch vorbereitet. Diese
Unterrichtseinheit umfasst theoretisches Wissen über die Kommunikation und Körpersprache
von Hunden sowie die Regeln im Umgang mit Hunden. Zudem werden mit den SchülerInnen
ein Hundespielzeug sowie Leckerli hergestellt. Rosi kündigt ihren Besuch mit einem Brief an
die Klasse an.
Bei den ersten Besuchen steht das Kennenlernen von Rosi und SchülerInnen im Vordergrund.
Die SchülerInnen dürfen Kontakt herstellen, indem sie beispielsweise ein Leckerli geben und
Rosi streicheln. Zudem sollen Kennenlernspiele die Kontaktaufnahme erleichtern. Hund und
SchülerInnen werden hierbei von der Lehrkraft genau beobachtet, um Stresssituationen,
Ängste und Unsicherheiten auf Seiten der SchülerInnen oder der Hündin zu erkennen und
sofort eingreifen zu können.
Nach der Kennenlernphase wird Rosi an zwei bis drei Tagen pro Woche die SchülerInnen
besuchen. Rosi wird dabei aktiv in den Unterricht einbezogen, z.B. indem sie den SchülerInnen
auf Kommando einen Apportierbeutel mit einer Aufgabe bringt. Bei den Einsätzen wird stets
auf ausreichend Ruhephasen für Rosi geachtet. Phasen der aktiven Einbindung der Hündin
wechseln sich folglich mit Arbeitsphasen der SchülerInnen ab, bei der die Hündin sich lediglich
im Klassenraum aufhält.
10Die Arbeit mit Rosi soll kontinuierlich evaluiert und mit den SchülerInnen reflektiert werden. Im
Verlauf des Projektes wird das Schulhundekonzept um die entstandenen praktischen Erfah-
rungen ergänzt. Da das Projekt noch nicht begonnen hat, ist in diesem Kapitel lediglich der
geplante Verlauf dokumentiert. Der Ablauf orientiert sich an den Empfehlungen von Heyer und
Kloke (2013, 37ff).
114. Literatur
Heyer, M./ Kloke, N. (2013): Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Päda-
gogik im Klassenzimmer. Nerdlen/ Daun: Kynos Verlag.
IAHAIO (2014): IAHAIO Weissbuch 2014. Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interven-
tionen und Richtlinien für das Wohlbefindender beteiligten Tiere [online] URL:
https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-2014-german.pdf
(Stand: 27.04.2020).
IBH (2020): Hundeführerschein und Sachkundenachweis [online] URL: https://ibh-hundeschu-
len.de/hundehalter/hundefuehrerschein-nach-ibh-ev-richtlinien (Stand: 28.04.2020).
Julius, H. et al. (2014): Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlage
tiergestützter Interventionen. Göttingen u. a.: Hogrefe.
schulhundweb.de (2007): Team-Lehrer-Hund [online] URL: https://www.schulhund-
web.de/index.php?title=Team_Lehrer-Hund (Stand: 27.04.2020).
schulhundweb.de (2006): Charakter des Schulhunds [online] URL: https://www.schulhund-
web.de/index.php?title=Charakter_des_Schulhundes (Stand: 27.04.2020).
schulhundweb.de (2011): Definition Schulhund [online] URL: https://www.schulhund-
web.de/index.php?title=Definition_Schulhund (Stand: 27.04.2020).
schulhundweb.de (2019): Selbstverpflichtung [online] URL: https://www.schulhundweb.de/in-
dex.php?title=Selbstverpflichtung (Stand: 27.04.2020).
Vernooij, M./ Schneider, S. (2014): Handbuch der Tiergestützen Interventionen. Grundlagen,
Konzepte, Praxisfelder. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
12Sie können auch lesen