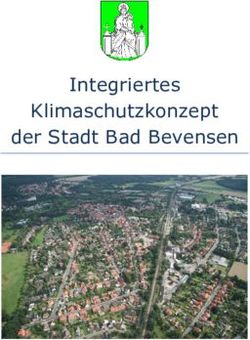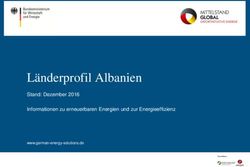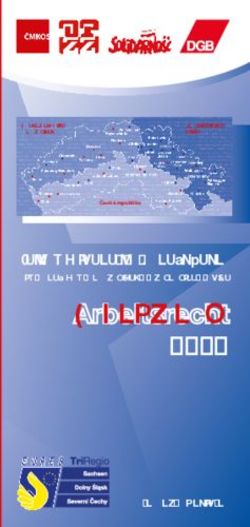Panikmache oder berechtigte Kritik? Befürchtungen und Herausforderungen im Kontext der Energiewende
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ZUKUNFTSFRAGEN
Panikmache oder berechtigte Kritik? Befürchtungen
und Herausforderungen im Kontext der Energiewende
Jürgen-Friedrich Hake, Wolfgang Fischer und Christoph Weckenbrock
Der Prozess der Energiewende wird immer wieder auch von kritischen Anmerkungen begleitet. Gewarnt wird etwa vor groß-
flächigen Stromausfällen oder einer weiteren Steigerung der Strompreise, welche nicht nur sozialunverträglich sei, sondern
zudem auch die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik schwäche. Vor dem Hintergrund vitaler Protestbewegungen gegen
lokale Energiewende-Projekte wird zudem mancherorts in Frage gestellt, ob die energie- und klimapolitischen Ziele auf dem
jetzigen Weg überhaupt zu erreichen sind.
Die Kritik am deutschen Vorhaben einer
grundlegenden Transformation des Ener-
giesystems findet z. B. Platz in Zeitungen
wie dem Wall Street Journal, welches die
Energiewende jüngst als „deutsche Jahr-
hundertwette“ [1] bezeichnete. Ähnlich
große mediale Aufmerksamkeit findet auch
das Beratungsunternehmen McKinsey,
wenn es auf Grundlage seines Energiewen-
de-Indexes [2] vermutet, dass die anvisier-
ten Ziele bei der CO2-Reduktion, der Sen-
kung des Primärenergieverbrauchs oder
dem Ausbau von Offshore-Windanlagen
kaum mehr zu erreichen seien. Mit Blick
auf den Bereich der Elektromobilität merkt
zudem eine vom Bundeswirtschaftsminis-
terium selbst in Auftrag gegebene Studie
an, dass die Zielmarken verfehlt werden
könnten [3].
Sorgen bezüglich der Umsetzung der Ener-
giewende werden verstärkt artikuliert, die
mit ihr verbundenen großen Chancen [4]
hingegen scheinen in der Debatte mittler- Bei Schlüsselprojekten der Energiewende muss es eine Rückbesinnung auf das Primat der Politik
geben Foto: Sergey Nivens | Fotolia.com
weile unterbelichtet. Nachfolgend werden
– exemplarisch – drei der populärsten Be-
fürchtungen in diesem Kontext, nämlich die Nach dem deutschen Energiewirtschaftsge- dieser Wert in den Jahren von 2006 bis 2013
zu etwaigen Strom-Blackouts, zu vermeint- setz sind die Netzbetreiber für die Stabilität zwischen 22 (2006) und 15 Minuten (2013).
lichen „Kostenexplosionen“ und dem viel- der Stromnetze und damit die Aufrechter- 2013 entfielen von den 15 Minuten 2,47 auf
beschworenen „NIMBY“-Phänomen, näher haltung der Versorgungssicherheit zustän- den Niederspannungs- und 12,85 Minuten
beschrieben und analysiert. dig. Bis heute, soweit kann Entwarnung auf den Mittelspannungsbereich [7].
gegeben werden, konnte diese Aufgabe von
Sicherheit der Elektrizitäts- den deutschen Netzbetreibern mit außeror- Zwar berücksichtigt der im Monitoring-
versorgung: Deutschland auf dentlich großem Erfolg umgesetzt werden. Bericht von 2014 angeführte SAIDI „weder
europäischem Spitzenplatz Im Vergleich mit anderen EU-Staaten ist geplante Unterbrechungen noch solche auf-
die Elektrizitätsversorgung hierzulande als grund höherer Gewalt, wie etwa Naturkata-
Eine sichere Elektrizitätsversorgung zu ga- sehr sicher einzuschätzen [6]. strophen“, sondern nur ungeplante Unter-
rantieren gehört zweifelsohne zu den vor- brechungen im Verantwortungsbereich der
rangigen Zielen jeder Energiepolitik. Groß- Der SAIDI (System Average Interruption Netzbetreiber (atmosphärische Einwirkun-
flächige und langanhaltende Stromausfälle Duration Index) gibt Auskunft über die gen, Einwirkungen Dritter, Rückwirkungen
könnten katastrophale Folgen nach sich zie- Anzahl von Minuten, die ein durchschnitt- aus anderen Netzen und andere Störungen),
hen, wie einige hypothetische Szenarien licher Endverbraucher pro Jahr ohne Strom die länger als drei Minuten dauern [8, S. 63].
und Studien bereits gezeigt haben [5]. auskommen muss. In Deutschland variierte Deutschland gehört in Europa aber auch
34 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
dann noch zum Spitzentrio im Bereich Ver- terventionen aus, so stieg deren Anzahl auf weist und nicht alle Unternehmen gleicher-
sorgungssicherheit (hinter Luxemburg und 387 in 2007, 1 024 in 2011 und schließlich maßen betrifft.
Dänemark), wenn geplante Unterbrechun- auf 1 213 in 2012 [11, 12, S. 15] . Dies ent-
gen und Ereignisse wie Naturkatastrophen spricht zwischen drei und vier Eingriffen Im Jahr 1998 lag der durchschnittliche Preis
zusätzlich eingerechnet werden [6, S. 8]. pro Tag. Zusammengenommen mussten die für Elektrizität in einem Dreipersonen-
vier Übertragungsnetzbetreiber 2012 wäh- Haushalt bei 17,11 ct/kWh. Nach der Li-
Mehr noch: Mit Blick auf die hohe Anzahl rend 7 200 Stunden in die Netze eingreifen, beralisierung des Strommarktes Ende der
von Rückwirkungsstörungen und Störungen 2010 waren es noch 1 800 Stunden [13]. 1990er Jahre fiel der Preis auf 14 ct (2000).
durch Einwirkungen Dritter im Mittelspan- Seitdem sind die Stromkosten jedoch durch
nungsbereich kam die Bundesnetzagentur Auch sind die Kosten für Maßnahmen zur preistreibende Komponenten wie Steuern,
noch im August 2014 zu dem Schluss, dass Netzstabilisierung angestiegen. Momentan Abgaben und die EEG-Umlage auf 28,73 ct/
„ein maßgeblicher Einfluss der Energiewen- betragen sie rund 2 €/MWh oder in abso- kWh angestiegen. Allein der Anteil der EEG-
de und der damit einhergehenden steigen- luten Zahlen 165 Mio. €, was im Vergleich Umlage ist von 2,05 ct im Jahr 2010 auf
den dezentralen Erzeugungsleistung auf die zum Jahr 2008 einer Steigerung um mehr 6,24 ct in 2013 geklettert. Damit kann für
Versorgungsqualität […] für das Berichts- als 100 % gleichkommt [14]. In den letzten einen durchschnittlichen deutschen Haus-
jahr nicht erkennbar“ sei [9]. „Blackouts“ Jahren hat sich jedoch eine Art Lernpro- halt ein Preisanstieg von nominal rund 70 %
stellen demnach auch über zwei Jahre nach zess abgespielt, der die Netzbetreiber im und real von rund 35 % seit 1998 festgestellt
der Entscheidung für eine beschleunig- Umgang mit der Problematik geschult hat. werden.
te Energiewende kein reales Problem für Zudem wurde das Netz bereits an einigen
Deutschland dar. neuralgischen Stellen ausgebaut oder nach- Eine Bestimmung des Preisanstiegs für den
gerüstet. Dies kann jedoch nicht darüber industriellen Bereich gestaltet sich schwie-
Erhalt der Netzstabilität wird hinwegtäuschen, dass das Netzmanagement riger, da je nach Abnahmemengen und Ver-
immer anspruchsvoller heute aufwendiger geworden ist. tragsregelungen der Einzelpreis sehr stark
variieren kann. Der Durchschnittspreis für
Das Risiko, dass sich die Qualität der Ver- So verwundert es nicht, dass die Bundes- von der Industrie genutzten Strom (160-
sorgungssicherheit im weiteren Prozess der netzagentur den zügigen Netzausbau wei- 20 000 MWh) stieg von 6,05 ct/kWh im
Umstellung unseres Energiesystems ver- terhin als das „Gebot der Stunde“ bezeichnet Jahr 2000 auf 14,87 ct/kWh in 2013 an [24].
schlechtert, könnte dennoch steigen. Dies und – trotz ausgezeichneter SAIDI-Werte – Je höher die georderten Mengen an Strom
insbesondere dann, wenn nicht alsbald Lö- empfiehlt, sich „nicht in Sicherheit zu wie- ausfallen, desto niedriger ist der Preis für
sungen für Probleme gefunden werden, die gen“ [15]. Ganz abgesehen von Fragen der Industriestrom. Zudem bieten sich größeren
schon seit längerer Zeit absehbar gewesen Grundlastversorgung oder der Einführung Unternehmen gute Möglichkeiten, in Zeiten
sind [10]. Die Entwicklung der Anzahl von von Kapazitätsmechanismen [16, 17, 18, der Stromüberversorgung diesen außeror-
Eingriffen zum Erhalt der Netzstabilität in 19] steht fest, dass ein verzögerter Netzaus- dentlich günstig einzukaufen [25].
den letzten Jahren indiziert, dass sich der bau bei sonst gleichbleibenden Rahmenbe-
Zubau von Erneuerbaren deutlich auf die dingungen (Festhalten am geplanten Atom- In jedem Fall lässt sich aber festhalten, dass
Stromnetze auswirkt und die Betreiberun- ausstieg und weitere Erhöhung des Anteils das Strompreisniveau in Deutschland schon
ternehmen bereits jetzt vor große Heraus- Erneuerbarer) spätestens im Jahr 2022 zu seit längerem deutlich über dem Durch-
forderungen stellt. erheblichen Engpässen führen könnte [20]. schnitt der EU-Staaten liegt, sowohl für die
Warnungen vor kurz bevorstehenden Black- Haushalte wie auch für die Industrie [25, S.
Der schnell ansteigende Anteil von fluktuie- outs als Folge der Energiewende scheinen in 26ff, 26]. Allerdings war die deutsche Indus-
renden Energieträgern wie Windkraft- und Anbetracht der vorliegenden Informationen trie bislang immer dazu in der Lage, das in
Photovoltaikanlagen, die mitunter langen jedoch übertrieben zu sein. Deutschland hohe Strompreisniveau durch
Wegstrecken zwischen den Regionen der Innovationen und Produktivitätssteigerun-
Stromerzeugung und des Stromverbrauchs Hohe Strompreise: Kosten für gen zu kompensieren. Trotzdem wird in der
(Last) und ein verzögerter Ausbau der Netz- Industrie und Verbraucher öffentlichen Debatte viel „Energie“ darauf
infrastruktur können als Gründe für den ziehen Konflikte nach sich verwandt, zu klären, wie diese Kosten der
Anstieg benannt werden. Marktbezogene Energiewende sinnvoll zwischen den ver-
Mittel zur Stabilitätssicherung wie das Re- Die Debatte um die Kosten der Energiewen- schiedenen Stakeholdern zu verteilen sind.
dispatching oder das Countertrading, die ur- de fokussiert sich meist auf die Entwicklung Die Konfliktlinien sind dabei mannigfaltig
sprünglich nur als Notmaßnahmen gedacht der Strompreise und die Auswirkungen des und verlaufen zwischen:
waren, werden nun häufiger eingesetzt. EEG [21, 22, 23]. Die Strompreise für die
deutschen Endverbraucher sind seit 2000 Q privaten Akteuren (Besitzer von Wind-
Daten des Übertragungsnetzbetreibers kontinuierlich gestiegen. Gleiches gilt im energie- oder Photovoltaikanlagen vs. End-
Tennet geben Aufschluss über das rasante Grundsatz für die Industrie, auch wenn der verbraucher);
Wachstum der Netzeingriffe: Kam Tennet Anstieg nicht die gleichen Zuwachsraten Q privaten Akteuren und Unternehmen
im Jahr 2003 insgesamt noch mit zwei In- wie bei den privaten Endverbrauchern auf- (Besondere Ausgleichsregelung des EEG);
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 35ZUKUNFTSFRAGEN
Q Unternehmen (entlastete und nicht ent- Befürchtungen werden daher laut, dass in seit einiger Zeit Lösungen für das Problem
lastete Unternehmen); diesem Falle – ähnlich wie beim Phänomen diskutiert. Die Erhöhung der Sozialtransfers,
Q den Regionen bzw. Bundesländern (ho- des „Carbon Leakage“ – Unternehmensver- eine Intensivierung von Energieberatungen
her/niedriger EE-Anteil) sowie zwischen lagerungen und Standortwechsel erfolgen für private Haushalte, die Einführung von
Q dem Staat und den Endverbrauchern könnten [28]. Dies könnte demnach gravie- sozialen Stromtarifen oder Subventionen
(Öko- bzw. Stromteuer). rende Folgen für die gesamte industrielle für den Kauf effizienterer Haushaltsgeräte
Produktionskette entfalten. Auch wenn sich durch sozial Schwächere gehören zum Kata-
Die Debatte um die Kosten der Energiewen- einige stromintensive Unternehmen in den log an diesbezüglichen Vorschlägen.
de berührt damit wirtschaftliche, politische letzten Jahren bei inländischen Investitio-
und nicht zuletzt auch soziale Fragen, was nen zurückgehalten haben [29], zeigen die Bisher erscheint jedoch keine einzige dieser
eine sehr intensive Einmischung diverser Erfahrungen mit der bisherigen bzw. nun Ideen im Ansatz mehrheitsfähig zu sein.
Interessengruppen nach sich zieht. Die abgeänderten Ausgleichsreglung jedoch ei- Zudem wäre danach zu fragen, ob die letzt-
Intensität, mit der die Diskussion um eine nes: der „Industriestandort Deutschland“, genannten beiden Vorschläge überhaupt mit
Reform des EEG und eine Neuausrichtung um eines der am meisten bemühten Schlag- den ordnungspolitischen Prinzipien der so-
der Energiepolitik von allen Seiten geführt wort dieser Debatte aufzugreifen, hat bisher zialen Marktwirtschaft in Einklang zu brin-
wird, ist auch ein Ausdruck für die hohen keinen nachhaltigen Schaden genommen. gen sind. Eine Umfrage zur Energiewende
gesellschaftlichen Belastungen, die oft mit [32] ergab Anfang dieses Jahres, dass rund
dem Transformationsprozess assoziiert „Neue soziale Frage“ durch 90 % der Deutschen sehr genau die Entwick-
werden. die Energiewende? lung der Strompreise beobachten. 40 % der
Befragten befürchteten gar, dass sie ihre
EEG-Ausnahmen sichern Michael Vassiliadis, Chef der Chemiege- Stromrechnungen bei weiter steigenden
Wettbewerbsfähigkeit der werkschaft IG BCE, hält das gegenwärtige Strompreisen bald nicht mehr begleichen
energieintensiven Industrie Finanzierungsmodell der Energiewende für könnten.
„teuer und ungerecht. […] Die Rendite aus
Momentan konzentriert sich die Strompreis- Wind- und Sonnenstrom finanzieren vor Allerdings erwartet rund die Hälfte der
Debatte vor allen Dingen auf die Aspekte der allem die Einkommensschwachen, die sich Deutschen, dass Energiearmut für sie per-
Wettbewerbsfähigkeit und der Sozialver- keine Photovoltaik und kein Investment in sönlich nicht zu einem Problem werden
träglichkeit. Die Ausnahme- und Rabattre- einen Windpark leisten können. Alles in wird. Eine Spaltung der Bevölkerung in eine
gelungen für energieintensive, international allem ist die Energiewende auch eine rie- „energiearme“, die Energiewende ablehnen-
konkurrierende Unternehmen sind dabei zu sige Umverteilung von unten nach oben“ de Schicht sowie eine „energiereiche“, wo-
einem Hauptstreitpunkt geworden, während [30]. Hierzu leistet auch die Besondere Aus- möglich von den EEG-Subventionen sogar
die Belastungen für mittelständische Betrie- gleichsregelung einen bedeutenden Beitrag, profitierende Gruppe ist vor diesem Hinter-
be weniger im Fokus stehen [27]. Die Be- macht sie für den Endverbraucher doch grund eine Möglichkeit, die bei der weiteren
sondere Ausgleichsregelung nach § 16 EEG 1,3 ct/kWh an der EEG-Umlage aus. Energiepolitik bedacht werden sollte.
(neu: §§ 63ff. EEG) erlaubt es diesen Unter-
nehmen, nach einem positiv beschiedenen Bedingt die Energiewende tatsächlich die Gesellschaftlicher
Antrag die EEG-Umlage nicht in vollem Um- Entstehung einer „neuen sozialen Frage“, Widerstand als Stolperstein
fang zu entrichten. 2013 wurde 1 700 Un- die am Ende über den gesamtgesellschaftli- der Energiewende?
ternehmen ein Rabatt auf die EEG-Umlage chen Erfolg des Projekts entscheiden könn-
gewährt, was ungefähr 4 % aller deutschen te? Die Diskussion, wie sozialverträglich die Die Grundidee der Energiewende erfreut
Unternehmen entsprach. Energiewende noch ist, fokussiert sich auf sich in Deutschland einer anhaltenden und
die niedrigsten Einkommensgruppen, da breiten Unterstützung durch die Bevölke-
Mit Blick auf den gesamten Bruttostromver- diese überdurchschnittlich stark belastet rung. Eine 2013 veröffentlichte Studie [33]
brauch des industriellen Sektors (243 TWh) werden [22]. zeigt, dass sowohl der Atomausstieg als
bedeutete dies, dass nur 47 % davon mit der auch der weitere Ausbau der erneuerbaren
kompletten EEG-Umlage belegt wurden. Es Die Kontroverse um „Energiearmut“ erreich- Energien als Schlüsselkomponenten des
erscheint unwahrscheinlich, dass sich an te insbesondere 2012 einen Höhepunkt und Transformationsprozesses verstanden und
diesen Zahlen durch die Novellierung des wird seitdem auch von der Politik verstärkt mit überwältigender Mehrheit unterstützt
EEG vom Sommer dieses Jahres grundle- geführt [31]. Genaue Statistiken zum Aus- werden.
gend etwas ändern wird. D. h. im Umkehr- maß der „Energiearmut“ liegen jedoch bis
schluss, dass eine gänzliche Abschaffung heute nicht vor. Wirtschafts- und Sozialwis- Werden Energiewende-Projekte jedoch kon-
der Ausgleichsregelung oder ein grundle- senschaftler sind sich dennoch darin einig, kreter und die möglichen Auswirkungen
gender Prinzipienwechsel bei ihrer Umset- dass das Problem existiert und virulent ist. dieser vor Ort fassbar, müssen nicht wenige
zung zwangsläufig zu wesentlich höheren Vorhaben mit starkem lokalen Widerstand
Stromkosten für die Industrie und damit zu Auch auf Grundlage dieser eher vagen, jedoch rechnen. Die Eingriffe in Landschaftsbilder,
einem Wettbewerbsnachteil führen würde. plausibel erscheinenden Annahme werden Ökosysteme oder Urlaubs- und Wohngebie-
36 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
te, die Windparks, Strommasten oder Pump- örtlichen Bedingungen abhängig und bisher Anmerkungen
speicherkraftwerke verursachen, werden wenig erfolgreich [37].
kritisiert, der Naturschutz nicht selten in [1] Karnitschnig, M.: Die Energiewende – eine deut-
Gegensatz zur Energiewende gestellt. Da- Sicher ist: Ein vielgestaltiger Protest macht sche Jahrhundertwette. In Wall Street Journal online,
bei organisieren sich lokale Protestgrup- auch differenzierte Kommunikations- und 27.8.2014.
pen mittlerweile auch auf nationaler und Vermittlungsstrategien notwendig. Diese [2] McKinsey & Company: Pressemitteilung, 2.9.2014.
europäischer Ebene und versuchen so, den können auf materielle Entschädigungen [3] Schlesinger, M. et al.: Kurzfassung zum Endbericht.
eigenen Einfluss zu mehren und erfolgreich setzen, können neue Beteiligungsverfahren Entwicklung der Energiemärkte – Energiereferenzpro-
Strategien zur Verhinderung bestimmter erproben oder mit großem finanziellen Auf- gnose. Projekt Nr. 57/12 des Bundesministeriums für
Projekte auszutauschen. wand für ein Vorhaben werben. Es ist jedoch Wirtschaft und Technologie. Basel/Köln/Osnabrück 2014.
verfehlt zu glauben, dass innovative Betei- [4] Kemfert, C.: Standpunkt: Die Energiewende birgt
Die Diskrepanz zwischen der fast einhelli- ligungskonzepte immer sicherstellen, dass enorme Chancen. www.bpb.de, Stand: 27.2.2013.
gen Unterstützung der Energiewende auf Projekte auf lokaler Ebene auch Akzeptanz [5] Petermann, T. et. al.: Was bei einem Blackout ge-
der abstrakten Ebene und die weite Verbrei- finden. Bei Schlüsselprojekten der Energie- schieht. Berlin 2011.
tung von Bürgerwiderständen in konkreten wende muss es daher eine Rückbesinnung [6] CEER: CEER Benchmarking Report 5.1. on the Con-
Situationen vor Ort bspw. gegen Projekte des auf das Primat der Politik geben, die zwar tinuity of the Electricity Supply. Council of European
Netzausbaus wird gemeinhin als „not in my stets auch als Mittler und Interessenwalter Energy Regulators: Brussels 2014.
backyard“- oder NIMBY-Phänomen bezeich- der Bürger agieren sollte, in bestimmten [7] Zahlen nach: www.bundesnetzagentur.de, Stand:
net. Diese Interpretation der Motive von Fällen aber, im Sinne einer klaren Güterab- 1.9.2013.
Protestbewegungen ist jedoch nur die halbe wägung, trotz lokalen Protests ein Projekt [8] BMWI: Zweiter Monitoring-Bericht „Energie der Zu-
Wahrheit. Immer mehr sozialwissenschaft- unterstützen und durchsetzen muss. kunft“. Berlin 2014.
liche Studien halten das NIMBY-Konzept für [9] Bundesnetzagentur: Zuverlässigkeit der Stromver-
nicht haltbar und haben nachgewiesen, dass Öffentlichkeit ist für viele sorgung auf konstant hohem Niveau. Pressemitteilung,
auch andere Gründe außer der persönlichen Risiken bereits sensibilisiert 22.8.2014.
Betroffenheit zur Ablehnung eines Projekts [10] Flues, F. et al.: Die Versorgungssicherheit seit
führen können [34, 35, 36]. Persönliche, Energiesicherheit, Kostenentwicklung, ge- 2009: Ein Stimmungsbild. Energiewirtschaftliche Ta-
psychologische und externe Faktoren be- sellschaftlicher Widerstand – drei Prob- gesfragen, 63 Jg. (2013) Heft 4, S. 22-24.
einflussen die Akzeptanz von bestimmten lemfelder der heutigen Energiepolitik, die [11] Barth, T.: „The German Energiewende“: Shining
Technologien, viele Bürger misstrauen grö- Deutschland intensiv beschäftigen. Die skiz- or Warning Example for Europe? (Vortrag). In 5th Con-
ßeren Investoren oder fühlen sich nur un- zierten Debatten zeigen, dass die Öffentlich- ference ELECPOR. 2013.
genügend informiert über die Planung und keit für viele Risiken bereits sensibilisiert [12] Falthauser, M. und Geiß, A.: Zahlen und Fakten zur
Umsetzung eines Projekts. ist und für alle drei Bereiche Lösungen ge- Stromversorgung in Deutschland. München 2012.
funden werden können, sollte die Politik die [13] Mengewein, J.: German Power Supply Is Becoming
Informelle Bürgerbeteili- richtigen Weichenstellungen vornehmen. Less Secure, Grid Regulator Says. www.bloomberg.com
gung ist kein Königsweg Der Werkzeugkasten hierzu ist prall gefüllt, 10.9.2013.
an Reformvorschlägen mangelt es nicht. In [14] McKinsey & Company: Energiewendeindex. Stand:
Eine frühe, transparente und ergebnisoffene Zukunft werden aber noch zu anderen Teil- 2.9.2014.
Bürgerbeteiligung hat sich als vermeintli- bereichen der Energiewende heftige Diskus- [15] Bundesnetzagentur: Pressemitteilung, 28.6.2013.
cher Königsweg zur Akzeptanzgenerierung sionen geführt werden. [16] Agora Energiewende: Kapazitätsmarkt oder stra-
in den Köpfen der Politik und der Medien tegische Reserve: Was ist der nächste Schritt? Eine
festgesetzt. Gleichwohl zeigen verschiedene Ist die Energiewende nicht immer noch zu Übersicht über die in der Diskussion befindlichen Mo-
Studien, dass auch bei einem vorbildlich ge- stromzentriert? Müssten Aspekte wie der delle zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in
führten, informellen Bürgerbeteiligungsver- Individual- und Güterverkehr oder die ener- Deutschland. Berlin 2013.
fahren nicht notwendigerweise mit einem getische Sanierung des Gebäudebestandes [17] Matthes, F. C.: Fokussierte Kapazitätsmärkte. Ein
Erfolg des Projekts gerechnet werden kann. nicht noch stärker in den Mittelpunkt rü- neues Marktdesign für den Übergang zu einem neuen
cken? Ist eine Ausdehnung des Emissions- Energiesystem. Berlin 2012.
Über die Hälfte aller Befragten in der bereits handels auf den Verkehrssektor und andere [18] Energy Brainpool: Vergleichende Untersuchung
erwähnten Umfrage von 2013 gaben an, Wirtschaftsbereiche sinnvoll und umsetz- aktueller Vorschläge für das Strommarktdesign mit Ka-
dass sie auch bei einer persönlichen Beteili- bar? Je konkreter die Maßnahmen in diesen pazitätsmechanismen. Berlin 2013.
gung am Planungsprozess ein Projekt, wel- Feldern werden, desto stärker werden die [19] Böckers, V. et al.: Braucht Deutschland einen Ka-
ches sie kritisch sehen, weiterhin ablehnen Auswirkungen der Energiewende im unmit- pazitätsmarkt für Kraftwerke? Eine Analyse des deut-
würden. Auch Versuche, die Bürger durch telbaren Umfeld, in den Lebenswelten der schen Marktes für Stromerzeugung. Düsseldorf 2012.
Gewinnbeteiligungen und hohe Renditen Menschen spürbar werden. Kontroversen [20] Pesch, T., Allelein, H. J. und Hake, J.-F.: Impacts
(Stichwort: „Bürgerleitung“) an Projekten über das „Ende des Individualverkehrs“ und of the transformation of the German energy system on
zu beteiligen und so lokale Widerstandkräf- die „Entmündigung der Immobilienbesit- the transmission grid. The European Physical Journal
te zu schwächen, sind von sehr speziellen zer“ werden dann wohl folgen. Special Topics, 2014. S. 1-15.
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 37ZUKUNFTSFRAGEN
[21] Frondel, M. et al.: Economic impacts from the pro-
motion of renewable energy technologies: The German Wie lässt sich der deutsche Export-
experience. Energy Policy, 2010. 38 (8): S. 4048-4056.
[22] Bardt, H., Niehues, J. und Techert, H.: Die Förde- überschuss für Strom in 2013 erklä-
rung erneuerbarer Energien in Deutschland: Wirkun-
gen und Herausforderungen des EEG. Köln 2012. ren?
[23] Kemfert, C.: Kampf um Strom: Mythen, Macht, Le-
genden. Hamburg 2013. Christian Growitsch, Stephan Nagl, Jakob Peter und Christian Tode
[24] BDEW-Strompreisanalyse, 27.5.2013, Berlin.
[25] BDEW: Industriestrompreise. Berlin 2014. Prinzipiell ist der Stromaustausch zwischen Ländern auf Preisunterschiede
[26] BMWi: Energiedaten: Ausgewählte Grafiken. Ber- an den jeweiligen Strombörsen zurückzuführen. Bei einer beliebigen Strom-
lin 2013. nachfrage werden die Strompreise an den einzelnen Börsen vor allem von den
[27] Die Welt, Sonderausgabe: Mittelstand | Rohstoffe Brennstoffpreisen, der jeweiligen Verfügbarkeit von Kraftwerken sowie der
und Energie, 16.9.2014. Einspeisung von erneuerbaren Energien beeinflusst. Die relativen Stromprei-
[28] Kafsack, H.: Generalangriff auf das EEG. Energie- se wiederum wirken auf den Stromaustausch. Dass sich trotz der Abschaltung
wirtschaftliche Tagesfragen, 63. Jg. (2013) Heft 11, S. 7. von rund 8 GW Kraftwerksleistung im Zuge des Kernenergieausstiegs im Früh-
[29] Bardt, H.: Erhöhung der EEG-Kosten als Investiti- jahr 2011 hohe Stromexporte einstellten, könnte überraschen. Der Stromexport
onshemmnis für stromintensive Unternehmen. Institut kann aber auf ein weiterhin bestehendes Überangebot an Kraftwerkskapazi-
der Deutschen Wirtschaft, IW policy paper 3/2014. täten, einen im europäischen Vergleich effizienten Kraftwerkspark sowie den
[30] Vassiliadis, M.: „Den Ökostrom zahlen die sozial Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zurückgeführt werden.
Schwachen“ (Interview). In Die Zeit, 1.9.2014.
[31] Brost, M.: Öko oder sozial? In Die Zeit, 17.6.2012.
[32] Schumann, D., Fischer, W. und Hake, J.-F.: Ener-
giewende, Energiesicherheit, Energieffizienz: Wahr-
nehmung und Einstellungen in der Bevölkerung. Ener-
giewirtschaftliche Tagesfragen, 64. Jg. (2014) Heft 9,
S. 103-108.
[33] Schumann, D., Fischer, W. und Hake, J.-F.: Ener-
giewende und Stromnetzausbau aus Sicht der Bevölke-
rung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 2013. 63 (7):
S. 68-72.
[34] Wüstenhagen, R., Wolsink, M. und Bürer, M. J.:
Social acceptance of renewable energy innovation: An
introduction to the concept. Energy Policy, 2007. 35 (5):
S. 2683-2691.
[35] Devine-Wright, P.: Rethinking NIMBYism: the role
of place attachment and place identity in explaining
place protective action. Journal of Community and Ap-
plied Social Psychology, 2009. 19 (6): S. 426-441.
[36] Kronenberg, V. und Weckenbrock, C.: Energiewen-
de konkret. Bonn 2014.
[37] Walter, G. und Buschnig, D.: Lokale Akzeptanz und
Partizipationsbereitschaft bei erneuerbare Energien-
Kraftwerksprojekten. Energiewirtschaftliche Tagesfra- Die bislang national ausgerichtete „Energiewende“ und die Förderung erneuerbarer Energien müs-
sen europäisch gedacht und ausgestaltet werden Foto: promesaartstudio | Fotolia.com
gen, 2014. 64 (9): S. 99-102.
Entwicklung des Stromnetto- (25,1 TWh), Österreich (14,0 TWh) und
exports in Deutschland die Schweiz (11,5 TWh). Importiert wurde
Prof. J.-F. Hake, MA W. Fischer u. MA C. hauptsächlich aus Frankreich (11,6 TWh),
Weckenbrock, Institut für Energie- und Kli- Deutschland war im letzten Jahrzehnt mit aus der Tschechischen Republik (9,7 TWh),
maforschung/Systemforschung und Techno- durchschnittlich 17,2 TWh durchweg Netto- Österreich (7,7 TWh), Schweiz (3,8 TWh)
logische Entwicklung (IEK-STE), Forschungs- stromexporteur und erzielte in 2013 einen und Dänemark (3,2 TWh) (Abb. 1) [1].
zentrum Jülich Exportüberschuss in Höhe von 33,8 TWh
j.-f.hake@fz-juelich.de mit einem Wert von 1,94 Mrd. €. Die wich- In 2013 war Deutschland auch in allen Mo-
wo.fischer@fz-juelich.de tigsten Abnehmer für Strom aus Deutsch- naten Nettostromexporteur, wobei besonders
c.weckenbrock@fz-juelich.de land waren im Jahr 2013 die Niederlande viel Strom in den Herbst- und Wintermonaten
38 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
Abb. 1 Entwicklung der Nettostromexporte Deutschlands Abb. 2 Monatliche Strom-Im- und -Exporte 2013
exportiert wurde (Abb. 2). Die durchschnittli- überdurchschnittlich viel Strom ins Netz ke in der Stromangebotskurve nach rechts.
chen Nettoexporte unterscheiden sich dabei eingespeist haben (Abb. 4). Dieser Zusam- Nicht nur in einem isolierten nationalen
deutlich in den einzelnen Monaten: Während menhang ist aus ökonomischer Sicht we- Elektrizitätssystem würde dies unausweich-
Deutschland in den Monaten Mai bis August nig überraschend. Die Kostenstruktur von lich zu einer Senkung des Großhandelsprei-
einen fast ausgeglichenen Stromaustausch Solar- und Windkraftanlagen ist vor allem ses führen (Abb. 5).
mit den europäischen Nachbarn hatte, wur- von hohen initialen Investitionskosten ge-
den in den Monaten März, Oktober und prägt. Im späteren Betrieb der Anlagen fal- Der zugrunde liegende Effekt lässt sich am
Dezember jeweils mindestens 4 TWh mehr len für die Erzeugung einer Kilowattstunde besten anhand eines Beispiels verdeutli-
Strom exportiert als importiert. Strom kaum weitere Kosten an. Damit kön- chen. Angenommen, in einem ebenfalls
nen diese Kraftwerke (dargebotsabhängig) isolierten benachbarten Land bestünde
Auffällig ist der (durchschnittlich) relativ für nahezu 0 €/MWh in den Strommarkt zwar ein identischer konventioneller Kraft-
hohe Nettostromexport in den Mittagsstun- bieten und befinden sich am linken Rand werkspark, aber eine deutliche geringere
den zwischen 13 und 16 Uhr (Abb. 3): Wäh- der Stromangebotskurve (Merit-Order). Kapazität an Solar- und Windkraftanlagen,
rend um die Mittagszeit mehr als 5 GWh/h würde sich in Zeiten hoher Wind- und/
exportiert wurden, lagen die Nettoexporte Witterungsabhängig kommt es so zu einer oder Solareinspeisung dort ein höherer
bei rund 2 GWh in den frühen Morgenstun- Verschiebung der konventionellen Kraftwer- Großhandelspreis einstellen. Sobald jedoch
den und am frühen Abend. Dementspre-
chend wurde zumeist bei hoher Nachfrage
Strom exportiert.
Eine Zuweisung der Exporte auf einzelne
Energieträger ist nicht möglich, da Strom
eine leitungsgebundene Energieform ist. Es
lässt sich lediglich der Strommix der jeweili-
gen Stunden den Nettostromexporten gegen-
überstellen. Dieser liefert eine Indikation,
welche Technologien überdurchschnittlich
zu den Stromexporten beigetragen haben.
Da derzeit keine zuverlässigen Daten über
den stündlichen Kraftwerkseinsatz der
konventionellen Anlagen in 2013 öffentlich
verfügbar sind [1], können nur Teilanalysen
für die Einspeisung von Wind- und Solaran-
lagen durchgeführt werden.
In 2013 wurde tendenziell mehr Strom net- Abb. 3 Nettostromexport und Last nach der Tageszeit
to exportiert, wenn Wind- und Solaranlagen
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 39ZUKUNFTSFRAGEN
Abb. 4 Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen und Nettostromexporte Abb. 5 Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen und Strompreis
zwischen beiden Märkten eine Verbindung auch aufgrund Vernachlässigung gewisser Grundsätzlich sinkt in jedem Jahr die Kon-
geschaffen würde, ergäbe sich eine Arbit- Externalitäten kostengünstige konventio- sumentenwohlfahrt des nicht-privilegierten
ragemöglichkeit für die Marktteilnehmer. nelle Kraftwerke (bspw. Nuklear-, Braun- Endverbrauchs um den Betrag der Diffe-
Infolgedessen würde der vorher niedrige kohle oder neue Steinkohlekraftwerke) in renzkosten für die Förderung erneuerbarer
Strompreis im Land mit hoher Erzeugung Deutschland ihre Elektrizität im Ausland Energien. Der Wirkungszusammenhang
aus erneuerbaren Energien steigen und der vermarkten, was mit höheren Exporten ist dabei wie folgt und gilt unabhängig von
Strompreis im Land mit geringer Erzeu- einherging. Stromexporten in benachbarte Länder. Durch
gung aus erneuerbaren Energien sinken. den Export von Elektrizität sinken im Aus-
Bei ausreichender Übertragungskapazität Diese Überlegungen zeigen deutlich, dass land die Preise, während sie in Deutschland
zwischen den Märkten wäre die Gleichheit niedrige Elektrizitätserzeugungskosten in ansteigen. Dies führt unmittelbar zu einer
der Preise die Folge. Deutschland zu Exporten führen. Dies wie- steigenden Produzentenrente für inländi-
derum bedingt, dass die Großhandelspreise sche Erzeuger konventionellen Stroms. Für
Ursachen, Auswirkungen im Inland steigen und im Ausland sinken. Produzenten von Strom aus erneuerbaren
und Effekte Neben einem offensichtlichen Außenhan- Energien resultiert aus dem Stromexport
delsüberschuss (1,94 Mrd. € in 2013) hat dagegen keine Rentenänderung, er erhält
Der zunehmende Export ist auf eine Kom- dies zwei bedeutende Auswirkungen: eine fixe Einspeisevergütung [2]. Der Über-
bination einer hohen Erzeugung aus er- tragungsnetzbetreiber, der den erneuerbaren
neuerbaren Energien und im europäischen Q Zum einen ist der Grenznutzen weite- Strom aufnimmt und den Produzenten mit
Vergleich vergleichsweise kostengünstiger rer Erzeugung aus erneuerbaren Energien dem festen Vergütungssatz kompensiert,
konventioneller Stromerzeugung zurück- auch bezüglich des Stromaußenhandels veräußert die Strommengen zum nationalen
zuführen. Der im Beispiel herangezogene langfristig abnehmend. Das heißt, je mehr Strompreis. Da er die Differenzkosten aus
Fall ist neben der Einspeisung von erneuer- Strom aus Deutschland exportiert wird, gezahlten Vergütungssätzen und Erlösen am
baren Energien auch vom Kraftwerkspark desto mehr sinkt der Preis in den benach- Strommarkt durch die EEG-Umlage von den
in den verbundenen Ländern abhängig. barten Nationen und damit auch der Ertrag nicht-privilegierten Endverbrauchern ausge-
Es wird unmittelbar ersichtlich, dass sich aus jeder zusätzlich exportierten Stromer- glichen bekommt, ist auch der Netzbetreiber
ein Export nur einstellt, wenn zusätzliche zeugungsmenge. vom Stromexport nicht beeinflusst.
Stromerzeugung in Deutschland günstiger Q Zum anderen ergeben sich Verteilungs-
ist als im Ausland – unabhängig, ob es effekte, die zu diskutieren sind. Ökonomisch Auf Konsumentenseite ergeben sich unter-
sich dabei um erneuerbare oder konven- spricht man in diesem Zusammenhang von schiedliche Effekte. Für alle Endverbrau-
tionelle Kraftwerke handelt. Da in jüngs- zusätzlicher Erzeugung aus erneuerbaren cher sinkt die Konsumentenrente für den
ter Zeit in Deutschland vorwiegend neue Energien unter dem EEG, höheren Expor- konventionellen Anteil am Strommix ana-
Kapazitäten an grenzkostengünstigen er- ten und damit resultierenden Großhan- log zum Anstieg der Produzentenrente von
neuerbaren Energien geschaffen wurde, delspreissenkungen im Ausland von einer Erzeugern konventionell erzeugten Stroms
haben die Stunden zugenommen, in denen Externalität der nationalen Förderung von durch steigende nationale Strompreise.
mit im Vergleich zum Ausland geringen erneuerbaren Energien. Aus dieser Externa-
Grenzkosten Strom produziert wird. Infol- lität ergeben sich Effekte auf Produzenten- Für Konsumenten im nicht-privilegierten
gedessen konnten sowohl erneuerbare als und Konsumentenseite. Endverbrauch ändern die Exporte jenseits
40 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
der ohnehin erlittenen Konsumentenren- voll und im Sinne des europäischen Binnen-
tenverluste aus den konventionellen Ex- markts für Energie.
porten und den Differenzkosten nichts.
Durch die export-induziert steigenden Anmerkungen
Preise sinken die Differenzkosten entspre-
chend; die Exporte sind für den Teil der [1] Zwar stellt die EEX-Transparency Platform ex-post
Erneuerbaren am Strommix somit für die Erzeugungsdaten zur Verfügung, allerdings basiert FLEXIBLE
die EEG-Umfrage zahlenden Konsumenten dies auf freiwilliger Meldung der Marktteilnehmer und
rentenneutral. daher besteht weder eine hundertprozentige Vollstän- UND EFFIZIENTE
Für den privilegierten Endverbrauch ergibt
digkeit noch Zuverlässigkeit der Daten.
[2] Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
ENERGIESYSTEME
sich ein Rentenverlust aus dem Export des 2012.
Merit-Order-Effekts. 27. – 29. JANUAR 2015
Quellen LEIPZIGER MESSEGELÄNDE
Die genannten Verteilungswirkungen zwi-
schen Produzenten und Konsumenten im AGEB: Stromerzeugung nach Energieträgern. Stand
In- und Ausland werden in der politischen 11.6.2014. www.enertec-leipzig.de
Diskussion nicht adressiert. Das energie- AGEB: Energieverbrauch in Deutschland - Daten für das
politische Ziel zum Ausbau erneuerbarer 1. bis 4. Quartal 2013.
Energien bezieht die gesamte inländische BMWi: Schriftliche Frage an die Bundesregierung im
Erzeugung aus erneuerbaren Energien auf Monat Juni 2014, Frage 85. 6.2.2013.
den inländischen Bruttostromverbrauch. EEX: Strom Spotmarkt - EPEX SPOT, 2014.
Exporte des Stroms von Erneuerbaren zäh- ENTSO-E: Cross-Border Commercial Schedules. Trans-
len damit für die Zielerreichung in gleichem parency platform, 2014.
Maße wie inländisch verbrauchte Mengen. ENTSO-E: Load and consumption data. Transparency
platform, 2014.
Bei Erreichung der Ziele für den Ausbau der HMESSE
Weiterführende Informationen D IE % N ERGIEFAC
erneuerbaren Energien bis 2020 werden die s
IG
Exporte bei hoher Einspeisung aus Wind- IN ,EIPZ GIEN
T E 4ECHNOLO
und Solaranlagen zunehmen. Die derzeiti- Prognos, EWI, GWS: Entwicklung der Energiemärkte -
sN E U E S TUNGEN
E $ IENSTLEIS
gen Ziele der Bundesregierung beinhalten Energiereferenzprognose. Studie im Auftrag des Bun-
s INNOV A T IV UNGEN
einen weiteren Ausbau der Wind- und Pho- desministerium für Wirtschaft und Technologie. Basel/
2 A H M E NBEDING
LLE
tovoltaikanlagen. Unter anderem sollen Pho- s AKTUE EM
CHKARËTIG
Köln/Osnabrück 2014.
tovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von EWI: Trendstudie Strom 2022 – Belastungstest für die s MIT HO
GRAMM
52 GW weiter gefördert werden. Dies wird Energiewende. Studie im Auftrag des Bundesverbands &ACHPRO
dazu führen, dass Stromexporte bei hoher der Deutschen Industrie e. V., Köln 2014.
Einspeisung von Wind- und Solaranlagen EWI: Flexibility options in European electricity mar-
weiter zunehmen. Dies verdeutlichen Simu- kets in high RES-E scenarios. Studie im Auftrag der
lationsrechnungen des EWI. Internationalen Energieagentur (IEA), Köln 2012.
Nationale Energiewende PD Dr. Chr. Growitsch (HWWI), Dr. St. Nagl
europäisch denken! (KPMG), MSc ETH Masch.-Ing. J. Peter und
Dipl.-Ing. Chr. Tode, Energiewirtschaftliches
Es gilt, die bislang national ausgerichte- Institut an der Universität zu Köln (EWI)
te „Energiewende“ europäisch zu denken jakob.peter@ewi.uni-koeln.de
und entsprechend die Förderung erneuer-
barer Energien europäisch auszugestalten.
Zum einen können aufgrund heterogener
Standortbedingungen für Wind- und Solar- INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR ENERGIEERZEUGUNG,
anlagen die Kosten durch eine europäisch ENERGIEVERTEILUNG UND -SPEICHERUNG
ausgestaltete Förderung insgesamt redu-
ziert werden. Zum anderen besteht dann IM VERBUND MIT:
die Möglichkeit, die Kosten für den Ausbau
der Anlagen auf alle Stromverbraucher in INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR UMWELTTECHNIK
Europa zu verteilen. Denn ein effizienter UND -DIENSTLEISTUNGEN
Stromaustausch innerhalb Europas ist sinn-
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 41ZUKUNFTSFRAGEN
Beitrag von Wind- und Photovoltaik-Anlagen zu einer
gesicherten Stromversorgung
Yvonne Dyllong und Uwe Maaßen
Der Umbau der deutschen Stromversorgung ist ein auf annähernd vier Jahrzehnte angelegtes Vorhaben. Dabei sind viele
Zwischenschritte zu bewältigen. Über die Zeit gesehen werden neue Systemkonfigurationen entstehen. Von Bedeutung ist die
Fragestellung, wie die fluktuierende Einspeisung, insbesondere aus Wind- und Photovoltaikanlagen, in das deutsche bzw.
europäische Stromsystem integriert wird. Von besonderem Interesse dabei ist, inwieweit Windkraft und Photovoltaik zur
Versorgungssicherheit beitragen. Das wird im Folgenden anhand realer Daten des Jahres 2013 untersucht.
Bei der Transformation des Stromsystems Frage, wie die Einspeisung von Wind- und wie die Einspeisung dieser Erzeugungstech-
geht es in einem ersten Abschnitt darum, PV-Strom tatsächlich erfolgte, welche Cha- nologien über das Jahr 2013 tatsächlich er-
den 2011 beschlossenen Ausstieg aus der rakteristik sie hatte und welcher Beitrag zur folgte. Dabei wird für jede Stunde, z. B. am
Kernenergie bis Ende 2022 zu bewältigen Versorgungssicherheit geleistet wurde. 1. Januar von 0:00 Uhr bis 1:00 Uhr oder
(Abb. 1). Der entfallende Versorgungsbei- am 26. Juni von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr er-
trag der Kernkraft soll zum einen durch Zur Beurteilung der Einspeisung mittelt, wie hoch die Einspeisung von Wind
den Ausbau der Offshore-Windkapazitäten von Wind-und PV-Strom und PV in der jeweiligen Stunde zusammen
in der Nord- und Ostsee und zum anderen ausfiel. Die ermittelte Einspeisung wird an-
durch den Ausbau von Wind- und PV-Anla- Die vom Fraunhofer ISE veröffentlichten hand einer geordneten Dauerlinie abgebil-
gen – verteilt über ganz Deutschland – er- Darstellungen zur Stromproduktion zeigen det (Abb. 3, 4).
bracht werden. eine wachsende Dynamik im Stromsystem
(Abb. 2). Diese Darstellungen, die im Inter- Diese Auswertung der Stromeinspeisung
Auf dem Gebiet der Stromerzeugung aus net für alle Wochen sowie Monate des Jah- ermöglicht es, die stromwirtschaftliche Be-
Wind an Land und aus PV-Anlagen wurden res verfügbar sind [1], lassen jedoch keine deutung der Wind- und PV-Einspeisung zu
in den vergangenen zehn Jahren umfang- Aussage darüber zu, welche Qualität diese erörtern.
reiche Erfahrungen gesammelt, die sich auf Stromeinspeisung aus Wind- und PV-Anla-
die Kosten, aber insbesondere auf das Be- gen hat. Status quo 2013: Beitrag
triebsverhalten und die Systemintegration von Wind- und PV-Erzeugung
beziehen. Anhand der von der Strombörse in Leipzig zur Strombedarfsdeckung
veröffentlichten viertelstündlichen Mittel-
Dieser Artikel befasst sich auf Grundlage werte für die Stromerzeugung aus Wind- Die installierte Leistung von Windenergie-
von realen Daten des Jahres 2013 mit der und PV-Anlagen lässt sich gut darstellen, anlagen betrug Ende 2013 34,4 GW, die von
PV-Anlagen 34,7 GW. Zusammen sind das
69,1 GW. Die Erzeugung von Wind betrug
53,4 TWh, entsprechend 8,5 % der Brutto-
stromerzeugung; die Erzeugung der PV-
Anlagen betrug 30,0 TWh, entsprechend
4,8 %. In Summe wurden aus Wind und PV
83,4 TWh erzeugt [2]. Das entspricht 13,3 %
der Bruttostromerzeugung in Deutschland
(Abb. 5).
Die Dauerlinie PV verdeutlicht, dass Pho-
tovoltaikanlagen mit einer Kapazität von
34,7 GW nur in 2 219 von 8 760 Stunden im
Jahr mehr als 5 GW einspeisten. Windener-
gieanlagen lieferten in 3 428 Stunden über
5 GW (Abb. 4).
Die geordnete Dauerlinie aus zeitgleicher [3]
Erzeugung von Wind und PV ist in Abb. 3
Abb. 1 Stromwirtschaftliche Ziele der Bundesregierung (blau – durchgehend) und in Abb. 4 (rot –
gestrichelt) dargestellt. Die höchste Strom-
42 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
einspeisung von Wind und PV zusammen
betrug etwa 35 GW und war im Jahr 2013
für etwa drei Stunden verfügbar. Dieser
max. Einspeisewert entspricht etwa 50 %
der installierten Leistung der Wind- und PV-
Anlagen.
Die geringste Leistung betrug 0,1 GW. Die-
se Kapazität stand das ganze Jahr über zur
Verfügung und wurde von Windenergiean-
lagen erzeugt. Die gesicherte Leistung der
insgesamt 69,1 installierten GW an Wind-
und PV-Kapazitäten betrug also 0,15 %.
Dass Solarenergie nicht ständig verfügbar
ist, liegt auf der Hand. Der geringe Wert
für die Windenergieeinspeisung zeigt je-
doch, dass nicht gemäß dem Ausdruck „ir- Abb. 2 Stromproduktion: Woche 11, 10.-16.3. 2014
gendwo weht der Wind immer“ von einer
sicheren Mindestleistung der Stromerzeu-
gung aus Windenergieanlagen ausgegan-
gen werden kann. Im Verlauf des Jahres
2013 war folgende Einspeisung von Wind-
und Solarstrom zeitgleich zu verzeichnen
(Abb. 4):
Q mehr als 20 GW in 755 von 8 760 h;
Q mehr als 10 GW in 3 076 von 8 760 h;
Q mehr als 5 GW in 5 332 von 8 760 h.
Obwohl 2013 insgesamt 83,4 TWh aus
Wind- und PV-Anlagen eingespeist wurden,
zeigt die geordnete Dauerlinie Wind- und
PV-Einspeisung, dass aufgrund der un-
günstigen meteorologischen Verhältnisse
in Deutschland die stromwirtschaftliche Re-
levanz der Wind- und PV-Einspeisung ein-
geschränkt ist. Der beachtliche Umfang der
erzeugten Stromarbeit (kWh) verstellt den Abb. 3 Stromwirtschaftliche Relevanz der Wind- und PV-Einspeisung: Geordnete Dauerlinie Wind und
PV 2013
Blick auf das andere wesentliche Kriterium,
nämlich die Verfügbarkeit von Leistung. Die
Auswertung zeigt, dass an 5 684 Stunden
eine addierte PV- und Windeinspeisung von
weniger als 10 GW verfügbar war.
Daraus leitet sich ab, dass bei der Integra-
tion von Wind und PV ein komplementäres
System erforderlich ist. Beim heutigen Stand
der Technik kommen hierfür Steinkohlen-,
Braunkohlen- und Gaskraftwerke in Fra-
ge, die in Kombination mit Pumpspeichern
oder Wasserkraftwerken die Stromversor-
gung sicherstellen. Dieses komplementäre
Stromerzeugungssystem muss den Umfang
der erwarteten Höchstlast umfassen, die in
Deutschland in einer Größenordnung von Abb. 4 Stromwirtschaftliche Relevanz der Windeinspeisung sowie der PV-Einspeisung: Geordnete Dauer-
linien Wind und PV 2013
85 GW liegt.
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 43ZUKUNFTSFRAGEN
den kann, bei dem die nachgefragte Last in
einer Bandbreite von 40 bis 85 GW liegt.
Deswegen stellt sich die Frage, ob und auf
welcher Höhe man die Spitzen möglicher-
weise kappt. Würde man beispielsweise bei
40 GW eine Kappung vorsehen, dann würde
einerseits nur ein geringer Anteil der Strom-
erzeugung (5-6 TWh, entsprechend < 5 %)
nicht vom System aufgenommen, anderer-
seits würde die Systemintegration erheblich
vereinfacht.
Hinsichtlich der längerfristig verfügbaren
Einspeisemengen würde sich bei einer Ver-
dopplung der Kapazitäten der heute gese-
hene 10 GW-Wert – der in mehr als 3 076
Stunden auftritt – auf 20 GW verdoppeln.
Abb. 5 Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern von 2002-2013 Trotz dieser Verdopplung wären über einen
Zeitraum von 5 684 Stunden immer noch
weniger als 20 GW verfügbar.
Potenzieller Beitrag zur Strom- Wind- und 2,5 GW PV-Anlagen vorgesehen.
bedarfsdeckung bei fiktiver Folgt man diesem Ausbaupfad, wäre eine Ver- Gleichzeitig würde sich die minimale Ein-
Verdopplung der Kapazitäten dopplung der Kapazitäten von heute 69,1 GW speisung, die im Jahr 2013 bei 0,1 GW lag,
auf 138 GW in etwa 15 Jahren erreicht. Man auf 0,2 GW verdoppeln. Das bedeutet kon-
Der weitere Ausbau der Wind- und PV-Ka- befände sich dann im Jahr 2030. kret, dass selbst bei einer Verdopplung der
pazitäten ist ein Schwerpunkt der aktuel- PV- und Windkapazitäten kein Beitrag zur
len Energiepolitik. Von den Ländern und in Die Stromerzeugung aus diesen Anlagen Versorgungssicherheit zu erwarten ist. Die
den Regionen wird insbesondere gefordert, würde sich unter der Annahme einer Ka- Notwendigkeit, ein komplementäres System
Windkraft an Land auszubauen. Auch die pazitätsverdopplung im technischen Status für diese Kapazitäten vorzuhalten, ist weiter
PV-Kapazitäten sollen weiter wachsen. Um quo von heute 83,4 TWh etwa auf 167 TWh zwingend gegeben.
die stromwirtschaftliche Relevanz dieser erhöhen. Das liegt in der Größenordnung
Strategie zu beurteilen, wird eine theoreti- der Stromerzeugung aus Kernkraftwerken Power to Gas als Alternative?
sche Betrachtung durchgeführt. Was würde im Zeitraum 2002 bis 2006 (Abb. 5).
geschehen, wenn im technischen Status quo Immer wieder wird darüber gesprochen,
die Wind- und PV-Kapazitäten doppelt so Dabei wären bei einer Gesamtkapazität dass man die Spitzen doch unter der Über-
hoch wären wie 2013. in einer Größenordnung von 138 GW Ein- schrift „Power to Gas“ speichern könne. Bei
speisespitzen von über 70 GW zu erwarten „Power to Gas“ allerdings handelt es sich
Nach den in der EEG-Novelle vorgegebenen (Abb. 3). Es ist schwer abzuschätzen, wie um einen Prozess, der viele Stufen umfasst
Planungen ist ein Zubau von jährlich 2,5 GW dies von einem System aufgenommen wer- (Abb. 6). Anzusprechen sind die Strom-
erzeugung und -übertragung, die Wasser-
stofferzeugung, die Methanisierung, Kom-
pression, Transport und Speicherung des
synthetischen CH4 im Erdgasnetz sowie die
Rückverstromung in Gasturbinen oder GuD-
Kraftwerken. Das alles ist einerseits sehr
kapitalintensiv, andererseits mit hohen Wir-
kungsgradverlusten verbunden. Die Wir-
kungsgrade dieser Prozesskette werden in
einer Spannbreite von 16 bis 36 % geschätzt.
Unterstellt man für den Wirkungsgrad ei-
nen Mittelwert von 25 %, würde aus 4 kWh
Überschussstrom bei der Rückverstromung
1 kWh entstehen.
Abb. 6 Langzeitspeicherung von EE-Strom über Elektrolyse, synthetisches Methan und Rückverstromung Die Investitionskosten je kW Rückverstro-
mungskapazität liegen in einer Größen-
44 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN
ordnung von 2 000 bis 3 000 €. Ein maß- tagen üblicherweise in einer Größenordnung Grenzen hinauszudenken, andererseits ist
geblicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit zwischen 55 und 75 GW liegt (im Extrem die Vorhaltung eines regelbaren und witte-
dieser Verfahren ist, über welche Zeit man zwischen 40 und 85 GW). rungsunabhängigen Kraftwerksparks un-
diese Anlagen betreibt (Abb. 3). Die Grafik abdingbar, der immer dann zur Verfügung
macht deutlich, dass die Dauerganglinie Ebenso wurde in diesem Artikel der fikti- steht, wenn die Sonne nicht scheint und der
relativ flach beginnt und hinten stark an- ve Fall betrachtet, bei der die Kapazitäten Wind nicht weht.
steigt. Ein vernünftiges Betriebsregime im Status quo verdoppelt werden. Ein Bei-
für Power to Gas-Prozesse müsste mehre- trag zur Versorgungssicherheit ist auch Quellen
re tausend Stunden umfassen, ansonsten dann nicht zu erwarten, denn der Wert von
steigen die ohnehin sehr hohen Kosten in 0,1 GW als geringste Einspeiseleistung wür- [1] www.energy-charts.de
unsinnige Größenordnungen. Die Strom- de sich auf 0,2 GW verdoppeln. Andererseits [2] Vgl. „Stromerzeugung nach Energieträgern 1990 –
erzeugungskosten bei Power to Gas werden würden die erwarteten Spitzen in einer Grö- 2013“ www.ag-energiebilanzen.de
auf eine Größenordnung von 100-200 ct/ ßenordnung von 70 GW liegen, in vielen [3] Dabei handelt es sich nicht um eine Addition der ge-
kWh geschätzt. Das ist ein Vielfaches der Stunden liegt das über der nachgefragten ordneten Dauerlinien Wind und PV, da damit nicht die
Erzeugungskosten auf Basis von Kohle Last. Selbst bei einer Verdopplung würde simultane Einspeisung dieser Energieträger abgebildet
und Erdgas (zwischen 5 und 10 ct/kWh), die addierte Einspeisung von Wind und PV würde, sondern um die Addition der zur gleichen Zeit
die allerdings jederzeit verfügbar sind und in annähernd 5 684 Stunden weniger als auftretenden Erzeugung aus Wind- und PV-Anlagen,
für die keine Kosten zur Systemintegration 20 GW betragen. die anschließend geordnet (Dauerganglinie) wird.
anfallen.
Daraus ist zu schlussfolgern: Der Ausbau Dipl.-Kffr. Y. Dyllong, Energiereferentin,
Diese wenigen Anstriche machen deutlich, von PV- und Windanlagen ist kein Königs- DEBRIV e. V., Dipl. Volksw. U. Maaßen, Ge-
dass Power to Gas kaum geeignet ist, die weg. Im Rahmen eines breiten Technologie- schäftsführer Statistik der Kohlenwirtschaft
großen Spitzen, die sich aus einer fiktiven mixes muss nach Lösungen gesucht werden. e. V., Köln
Verdopplung der Wind- und PV-Kapazitäten Dazu gehört einerseits über die deutschen debriv@braunkohle.de
ergeben, aufzufangen. Erforderlich bleibt
also ein komplementäres System mit regel-
baren und sicher verfügbaren Kraftwerken.
Ergebnisse und
Schlussfolgerungen
Windenergie und Photovoltaik sind Tech-
nologien, von denen viel erwartet wird. Die
eingangs genannten beachtlichen Werte zur
Kapazität und Stromerzeugung sagen aller-
dings wenig über den Beitrag zur Versor-
gungssicherheit aus. Anhand einer geordne-
ten Dauerlinie, der Summe der zeitgleichen
Einspeisung von Wind- und PV-Anlagen,
FLEXIBLE UND EFFIZIENTE
kann man die stromwirtschaftliche Bedeu-
tung und den Beitrag zur Versorgungs-
ENERGIESYSTEME
MESSE
ERGIEFACH
sicherheit dieser Erzeugungsverfahren ab- s DIE %N
G
IN ,EIPZI LOGIEN
schätzen (Abb. 3). 27.– 29. JANUAR 2015 s NEUEST
E 4ECHNO
IEN STLEISTUN
GEN
TIVE $ INGUNGE
N
LEIPZIGER MESSEGELÄNDE s INNOVA ENB ED
LLE 2AHM
Unsere Untersuchung kommt zum Ergebnis, s AKTUE GEM
CHKARËTI
s MIT HO
dass Wind und PV keinen Beitrag zur Versor- GRAMM
&ACHPRO
gungssicherheit leisten, weil die geringste www.enertec-leipzig.de
Einspeisung bei nur 0,1 GW, d. h. bei 0,15 %
der installierten Leistung von Wind und PV
liegt. Eine zeitgleiche Einspeisung von mehr
als 10 GW Wind und PV wurde nur in 3 076
Stunden erreicht. Bei 8 760 Jahresstunden
IM VERBUND MIT:
sind also 5 684 Stunden zu verzeichnen, in
denen die eingespeiste Leistung weniger als INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR ENERGIEERZEUGUNG,
INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR UMWELTTECHNIK
10 GW betrug. Dieser Wert ist ins Verhältnis UND -DIENSTLEISTUNGEN ENERGIEVERTEILUNG UND -SPEICHERUNG
zu setzen zur Stromnachfrage, die an Werk-
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11 45ZUKUNFTSFRAGEN
INTERVIEW
„Dieses regionale Klein-Klein ist der völlig falsche Weg“
Die technischen Konturen der Transformation der deutschen Energiewirtschaft zeichnen sich mittlerweile mehr oder weni-
ger deutlich ab. Wie sieht es auf der Seite der wirtschaftlichen Konzepte dafür aus, sind wir dabei auf einem einigermaßen
einleuchtenden Weg? Die Frage gilt für die Integration der Erneuerbaren sowie für das Strommarktdesign insgesamt, also
auch für die Versorgungssicherheit. Der Ökonom Justus Haucap von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf stellt im „et“-
Interview heraus, dass wir uns bei der Energiewende im Klein-Klein verheddern. Bei den Erneuerbaren hätten wir besser
einen anderen Förderungspfad eingeschlagen sollen. Und: Zur Sicherung der Stromversorgungssicherheit reicht der Energy-
Only-Markt aus, wir sollten die Gefahr von Kapazitätsmechanismen nicht unterschätzen.
„et“: Deutschland in seiner Strompolitik sehr na- Haucap: Wir müssen uns hier von der Planwirt- „et“: Die Bundesregierung strebt mit der EEG-No-
tional, ja sogar regional. Wie beurteilen Sie diese schaft wieder stärker verabschieden. Welche velle 2014 an, den EE-Ausbau besser planbar und
Segmentierung. Wäre nicht – vor allem mit Blick Mischung aus Netzoptimierung, Netzausbau, Fle- kosteneffizienter zu gestalten. Problem erkannt,
auf den europäischen Binnenmarkt für Strom – Eu- xibilisierung von Angebot und Nachfrage sowie Gefahr gebannt?
ropa der geeignetere Lösungsraum? Speichern optimal ist, kann man angesichts der
Unsicherheit über technische und ökonomische Haucap: Ein guter Witz – davon sind wir meilen-
Haucap: Dieses regionale Klein-Klein ist der völ- Entwicklungen überhaupt nicht vorhersagen. weit entfernt. Die Reform zeigt, dass der Bundesre-
lig falsche Weg. Viele Regionen und sogar Kom- Jeder, der sagt, er wisse genau, wie das Ener- gierung die Kraft zu einer echten Reform – trotz gro-
munen geben sich eigene Energiewende-Ziele, giesystem der Zukunft aussehen müsse, ist ein ßer Koalition – fehlt. Statt weniger Planwirtschaft
ohne dass über den Sinn nachgedacht wird. Das Scharlatan. Immer wieder werden wir von tech- kommt noch mehr. Zusätzlich zu den noch differen-
Klimaproblem ist ein globales Problem, hier müs- nologischen, ökonomischen und auch politischen zierteren Einspeisetarifen kommen jetzt auch noch
sen wir – im Minimum – europäisch denken und Entwicklungen überrascht. mengenmäßige Restriktionen durch die Deckel.
die spezifischen Vorteile verschiedener Standorte Wir machen die Fehler der Landwirtschaftspolitik
nutzen. So sollte Solarenergie – wenn überhaupt – „et“: Welches Rezept würden Sie angesichts des- der 1970er und 1980er Jahre noch einmal nach. Es
im Süden Europas ausgebaut werden, besser noch sen verschreiben? soll zwar eine Pilotausschreibung für Photovoltaik-
in Afrika, und Wind im Norden. Auch die nationa- Freiflächenanlagen geben, und ab 2017 soll die För-
len Kapazitätsmechanismen zersplittern den Bin- Haucap: Das Beste ist, sich auf Preismechanis- derhöhe grundsätzlich auch für die anderen erneu-
nenmarkt. Das nationalistische Klein-Klein in der men zu verlassen, die aktuelle Knappheiten erbaren Energien über Ausschreibungen ermittelt
Energiepolitik ist angesichts der Tatsache, dass und Erwartungen über zukünftige Knappheiten werden. Aber aus einer einzigen Ausschreibung
die meisten Probleme europäischer oder globaler reflektieren. Damit sich die Entwicklung von kann man rein gar nichts lernen, weil man ja kei-
Natur sind, einfach absurd. Speichern, intelligenten Netzen und Verbrauch- nen Vergleichsmaßstab hat. Und für weitere Aus-
steuerung lohnt, müssen wir auch (erhebliche) schreibungen ab 2017 brauchen wir eine weitere
Integration der Erneuerbaren Strompreisschwankungen zulassen und dürfen EEG-Reform: Wer glaubt, dass es 2017 vor der Bun-
in den Markt diese nicht durch Kapazitätsmechanismen glät- destagswahl noch eine weitere EEG-Reform gibt, der
ten. Zugleich brauchen wir Elemente in den glaubt vermutlich auch an den Weihnachtsmann.
„et“: Flexibilisierung konventioneller Kraftwerke, Netzentgelten, die Knappheiten reflektieren, wie
Netzoptimierung und Netzausbau, Speicher sowie z. B. eine regional differenzierte G-Komponente Vom Einspeise- zum
Verbrauchssteuerung sind die Optionen für eine nach britischem Vorbild oder ein Market-Split- Quotenmodell?
technische Integration der Erneuerbaren in den ting. Und zumindest auch für neue Photovoltaik-
Strommarkt. In welche Richtung sollten die ökono- Anlagen sollte die Direktvermarktung verpflich- „et“: Anfang letzten Jahres haben Sie gemeinsam
mischen Konzepte gehen? tend sein. mit dem Juristen Jürgen Kühling in einem Gutach-
„Das regionale Klein-Klein ist der völlig falsche Weg. Viele Regionen und sogar
Kommunen geben sich eigene Energiewende-Ziele, ohne dass über den Sinn nach-
gedacht wird. Das Klimaproblem ist ein globales Problem, hier müssen wir – im
Minimum – europäisch denken und die spezifischen Vorteile verschiedener
Standorte nutzen. So sollte Solarenergie – wenn überhaupt – im Süden Europas
Foto: Haucap, Universität Düsseldorf
ausgebaut werden, besser noch in Afrika, und Wind im Norden. Auch die nationa-
len Kapazitätsmechanismen zersplittern den Binnenmarkt. Das nationalistische
Klein-Klein in der Energiepolitik ist angesichts der Tatsache, dass die meisten
Probleme europäischer oder globaler Natur sind, einfach absurd.“
Prof. Dr. Justus Haucap, Direktor des Düsseldorf Institute für Competition Eco-
nomics (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
46 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 11Sie können auch lesen