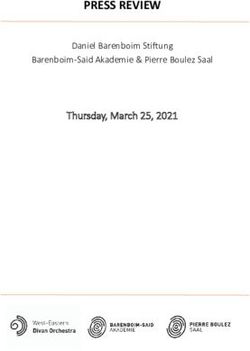PRESS REVIEW Monday, June 29, 2020 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal - Index of
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Monday, June 29, 2020PRESS REVIEW Monday, June 29, 2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 27.06.2020, DB
Singverbot 4
Deutschlandfunk (Radio/Online), 25.06.2020, BSA
Jacob Eder und Kristina Meyer im Gespräch über „Holocaust-Angst“ 5
Berliner Morgenpost (Print), 26.06.2020
Kulturhilfefonds fördert Projekte mit 5,3 Mio. Euro 6
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 29.06.2020
Der Zukunft zugewandt. Die Berliner Staatskapelle wird 450 Jahre alt 8
Der Tagesspiegel (Print), 29.06.2020
Andrea Zietzschmann über Streaming, Kurzarbeit und die kommende Spielzeit 10
Berliner Morgenpost (Print), 26.06.2020
Der Klangzauberer vom Gendarmenmarkt. Christoph Eschenbach 14
Deutschlandfunk Kultur (Radio/Online), 26.06.2020
Sinfonie in der Kammer. DSO Berlin spielt live mit Antonello Manacorda 22
Der Tagesspiegel (Print), 29.06.2020
Ein Ausblick auf den Kultursommer im Stream 25
Deutsche Welle (Print), 28.06.2020
Die "neue Normalität" im Konzertsaal - ein Selbstversuch 27
Der Tagesspiegel (Print), 28.06.2020
Berliner Ensemble testet effiziente Raumdesinfektion 31
Der Tagesspiegel (Print), 28.06.2020
Kulturnachrichten 32
Süddeutsche Zeitung (Print), 29.06.2020
Bund erwägt Rückkauf des Hamburger Bahnhofs 33Berliner Morgenpost (Print), 28.06.2020
Jedes Buch ein Erfolg. Gespräch zum 70. Jubiläum von Suhrkamp mit Verleger
Jonathan Landgrebe 34
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 27.06.2020
Auf Bewährung. Kirill Serebrennikow schuldig gesprochen 38
Die Welt (Print), 27.06.2020
Evas Werk und Annas Beitrag. Neue Einspielung von Anna Prohaska und Julius Drake 40
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 29.06.2020
Schauerstücke einer schwarzen Romantik. Bariton Stéphane Degout brilliert mit
deutschen Balladen 42
Der Tagesspiegel (Print), 28.06.2020
Hörnerklang. Kompositionen von Beethovens Zeitgenossen 44
Süddeutsche Zeitung (Print), 29.06.2020
Alle Menschen werden Brüder. Aktivisten beschwören Beethovens „nordafrikanische
Wurzeln“ 46
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 27.06.2020
Mein Herz so weiß. Ist es rassistisch, bei der Beurteilung von Musik nach Hautfarben
zu unterscheiden? 47
Süddeutsche Zeitung (Print), 29.06.2020
Auf den Schultern von Giganten. Ein kleiner Kanon afroamerikanischer Literatur 51
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Print), 28.06.2020
Angst vor der Annexion. Zu den Plänen der israelischen Regierung 54
Süddeutsche Zeitung (Print), 29.06.2020
Das Leben der Anderen. Die möglichen Folgen der Annexion im Westjordanland 57Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
F.A.Z. - Feuilleton Samstag, 27.06.2020
Singverbot
Von Jan Brachmann
In der neuen Corona-Verordnung des Landes Berlin, die am heutigen Siebenschlä-
fertag in Kraft tritt, steht ein Satz, der es in sich hat: „In geschlossenen Räumen darf
nicht gemeinsam gesungen werden.“ So formuliert, bedeutet das: Chorproben,
Ensembleproben an Opernhäusern, schon Duette wären nicht mehr möglich, sogar
beim Einzelunterricht im Gesang müsste der Lehrer den Mund halten. Die Reaktion
der singenden Bürger Berlins fiel so geharnischt aus, dass der Kultursenator Klaus
Lederer sich per Twitter über „viele unsachliche Mails“ beschwerte. Der Deutsche
Chorverband warf dem Politiker in einem offenen Brief die „Auslöschung von
Kulturgut“ vor und machte ihn für das „Sterben des Nachwuchses“ verantwortlich.
Lederer bat in seinem Antwortbrief zu Recht um verbale Abrüstung, bekräftigte aber
auch die Grundsätzlichkeit des Singverbots: „Ich weiß, dass andere Bundesländer
anders entschieden haben, und ich bin von diesen Entscheidungen, insbesondere in
Ländern, die Berlin gern der Laschheit schelten, überrascht. Ich halte sie für gefähr-
lich.“ Berlins Opernintendanten waren von der neuen Verordnung ebenso überrascht
wie die Leitung der Rundfunkorchester und -chöre GmbH (ROC). Für die ROC ist
die neue Verordnung in ihrer jetzigen Form nicht hinnehmbar. Doch anders als
Münchens Opernintendant Nikolaus Bachler, der das Bayerische Kunstministerium
wegen ähnlich strenger Arbeitsbeschränkungen als „Gesundheitsministerium“
beschimpfte, das Kunst verhindere, setzt man in Berlin auf Diplomatie. Anselm
Rose, Geschäftsführer der ROC, ist bereits am Verhandeln: „Wir müssen zu einer
differenzierteren Lösung kommen. Berufs-Chöre und Laien-Chöre können nicht
gleichbehandelt werden, weil es jeweils andere Richtlinien und andere Möglichkeiten
im Arbeitsschutz gibt.“ Allerdings scheint im Senat die rechte Hand nicht zu wissen,
was die linke tut. Denn der aktuelle „Musterhygieneplan Corona für die Berliner
Schulen“ erlaubt wieder Chorproben, „sofern der Probenraum groß genug ist, dass
zwischen allen Sängerinnen und Sängern ein Mindestabstand von zwei Metern
eingehalten werden kann“. Es gibt ja medizinische Studien der Berliner Charité und
der Universität Freiburg, die das Singen bei diesen Abständen, welche die Richtlini-
en der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft unterschreiten, empfehlen. Klaus Lederer
beruft sich hingegen vor allem auf die Neubewertung von Aerosolen als wichtigem
Virusträger, wie sie Christian Drosten kurz vor Pfingsten vorgenommen hat.
Momentan sucht sich offenbar jeder Politiker, sogar innerhalb des Berliner Senats,
seine empirische Beschlussgrundlage selbst aus. Daniel Barenboim sagte dieser
Zeitung, halb verärgert, halb amüsiert über diese Zustände: „Wenn Sie herausfinden,
auf welcher Basis Entscheidungen zu kulturellen Veranstaltungen und Corona
getroffen werden, rufen Sie mich an!“
1 von 1 29.06.2020, 11:51Deutschlandfunk (Radio/Online), 25.062020 „Holocaust – Angst“ Jacob Eder und Kristina Meyer im Gespräch
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465001/12
F.A.Z. - Musik Montag, 29.06.2020
Der Zukunft zugewandt
Das einstige Orchester der Markgrafen von Brandenburg und der Könige
von Preußen wird 450 Jahre alt: Eine Box von fünfzehn CDs feiert die
großartige Staatskapelle Berlin.
Auf 450 Jahre Geschichte kann die Staatskapelle Berlin 2020 zurückblicken. In
dieser Stadt mit ihren zerstörten oder vielfältig transformierten Traditionen wirkt
das ein wenig surreal, jedenfalls weniger greifbar als die Geschichte des mehrfach
abgebrannten, zerstörten oder langjährig rekonstruierten Opernhauses Unter den
Linden, das 1742 erstmals bespielt wurde. Es nahm die damalige Hofkapelle des
preußischen Königs Friedrich II. auf und dient bis heute als Stammsitz des Orches-
ters. Aus der 1540 gegründeten Hofkantorei mit elf von den Trompetern dominierten
Musikern ist mittlerweile das mit 136 Planstellen größte Berliner Orchester gewor-
den. Was allerdings, gemessen an Spitzenorchestern mit ähnlichen Aufgaben wie in
Wien oder in Leipzig, nur auf den ersten Blick besonders üppig wirkt.
Die Staatskapelle ist zwar in erster Linie ein Opernorchester, spielt aber auch ihre
eigenen symphonischen Konzerte, und dies nicht nur nebenbei und nicht nur in der
hochklassig ausgestatteten Berliner Orchesterlandschaft. Tourneen und Aufnahmen
lassen sie heute als ein Orchester von Weltrang erscheinen, fast untrennbar verbun-
den mit der Persönlichkeit von Daniel Barenboim. Seit 1991 bestimmt er als Künstle-
rischer Leiter die Geschicke von Opernhaus und Orchester, und er hat beide derart
erfolgreich entwickelt, dass sein Vertrag mit dem Berliner Senat im letzten Jahr noch
einmal bis 2027 verlängert wurde. Das Orchester, das seiner Arbeit nicht nur die
produktive künstlerische Herausforderung verdankt, sondern auch stetig wachsende
Bezüge, hatte dem heute 77 Jahre Alten schon im Jahr 2000 den Ehrentitel eines
„Chefdirigenten auf Lebenszeit“ zugesprochen.
Typisch für Barenboims Positionierung der Staatskapelle ist, wie er gleichzeitig das
große, repräsentative Repertoire besetzt und mit derselben Energie aus neueren
Partituren Funken schlägt. Beethoven, Wagner, Bruckner, Mahler werden unermüd-
lich und in massiven Zyklen aufgeführt, Berg und Schönberg, Boulez oder Elliott
Carter wirken dazwischen aber nicht weniger bedeutend. Nachdem der kompakte
Zyklus aller Beethoven-Symphonien in der diesjährigen Osterzeit ausfallen musste,
zeigt das offizielle Festkonzert zum 450. Geburtstag, das im September stattfinden
soll, ein ganz anderes Gesicht: Mendelssohn, Strauss und Beethoven, aber auch
Boulez und eine Uraufführung von Jörg Widmann wird Barenboim dort dirigieren –
eine kompakte Zusammenfassung des Orchesterprofils aus Geschichte und Gegen-
wart.
Dagegen setzt die CD-Box, mit der die Deutsche Grammophon jetzt die Staatskapelle
feiert, ganz überwiegend auf die gängigen Komponistennamen. Die Edition umfasst
fünfzehn CDs, die jeweils einzelnen Dirigenten gewidmet sind, und die Aufnahmen
umspannen ein knappes Jahrhundert, von 1916 bis 2012, wobei die letzte CD die
Aufzeichnung eines Konzerts zu Barenboims siebzigstem Geburtstag enthält, bei
dem Zubin Mehta dirigiert und der Jubilar als Solist Beethovens drittes und Tschai-
1 von 2 29.06.2020, 11:37Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465001/12
kowskys erstes Klavierkonzert spielt, in einer überraschend gelungenen Synthese aus
Mehtas straffer Geradlinigkeit und Barenboims Freude an ausschweifender Sponta-
neität. Mozart, Beethoven, Brahms und Wagner sind unter den Aufnahmen mehr-
fach vertreten, Bruckner und Mahler dürfen natürlich nicht fehlen. So gibt es als
Erstveröffentlichung den Mitschnitt einer Aufführung von Mahlers sechster
Symphonie, die Pierre Boulez 2009 in der Berliner Philharmonie dirigierte, hyper-
präsent im Detail und trotzdem in einem Spannungsbogen aufs Ganze gezielt.
Suggestiv, ja geradezu auratisch ist auch der ebenfalls zum ersten Mal veröffentlichte
Konzertmitschnitt von Michael Gielens Interpretation des Schönberg’schen „Pelleas
und Melisande“, die den Hörer über die ganze, oft allzu lange Dreiviertelstunde zu
fesseln vermag. Uneinheitlicher im Gesamteindruck wirkt dagegen Barenboims
Aufnahme von Bruckners fünfter Symphonie mit einem ziemlich schnell durchgezo-
genen Adagio, aber geradezu berauschenden Kontrapunkt-Episoden im Finale. Hier
handelt es sich um eine Produktion aus Barenboims 2013 auch auf DVD erschiene-
nem Bruckner-Teilzyklus. Die Staatskapelle spielte damals in Riesenbesetzung mit
verdoppelten Bläsern. Darüber sagt das voluminöse Beiheft zur CD-Box leider gar
nichts, wie auch die besonderen Bedingungen der anderen Konzerte nicht zur Spra-
che kommen, was gerade bei den älteren Aufnahmen schade ist, die viel mehr von
den Umständen der Aufführung oder der Aufnahme geprägt waren.
Anhand der mehrfach vertretenen Komponisten lässt sich quer durch die CDs eine
kleine Geschichte der musikalischen Interpretation wie auch der Tonaufnahme
nachvollziehen. So steht Richard Strauss’ trocken-neusachliche, man könnte fast
sagen langweilige Aufnahme von Mozarts später g-Moll-Symphonie neben dem
musikantisch temperamentvollen Aufspielen der Staatskapelle in der C-Dur-Sinfonie
KV 338 unter Leo Blech. Es sind Aufnahmen, die 1927 und 1930 entstanden und in
die man sich dank der digitalen Aufarbeitung gut einhören kann. Wie ein Intensitäts-
schock wirkt dann aber jene legendäre Aufnahme der Ouvertüre zur „Zauberflöte“,
mit der Herbert von Karajan 1938 seine lebenslange Arbeit im Tonstudio begann –
hier ist eine Genauigkeit, ein Ernst, eine Durcharbeitung der Farben und der Artiku-
lation zu spüren, die ganz neu scheinen. Interessant ist auch Karajans experimentelle
Stereoaufnahme des letzten Satzes aus Bruckners achter Symphonie, entstanden
1944 in tagelanger Klausur im Haus des Rundfunks.
Begeistern können auch heute noch Otto Klemperers kraftvolle Aufnahmen um 1930
mit so gegensätzlichen Werken wie Weills „Dreigroschenmusik“ oder Brahms’ erster
Symphonie. Erich Kleibers Konzertmitschnitt von Beethovens Fünfter dokumentiert
dagegen auch mächtige Spannungen zwischen ambitioniertem Wollen des Dirigen-
ten und Können der Ausführenden. Die Aufnahme entstand 1955 im Admiralspalast,
kurz vor der Wiedereröffnung der lange kriegszerstörten Staatsoper. Da war Kleiber
bereits aus politischen Gründen zurückgetreten und Franz Konwitschny flugs ins
Amt gehievt worden, dessen „Meistersinger“-Aufführung zur Eröffnung hier eben-
falls dokumentiert wird. Sie bildet einen von drei Opernmitschnitten, von denen
Wilhelm Furtwänglers „Tristan“-Aufführung, 1947 ebenfalls im akustisch ungünsti-
gen Admiralspalast, trotz aufnahmetechnischer Unzulänglichkeiten der bedeutends-
te ist. Martin Wilkening
2 von 2 29.06.2020, 11:37Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469635/20 2 von 4 29.06.2020, 13:37
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469635/20 3 von 4 29.06.2020, 13:37
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469635/20 4 von 4 29.06.2020, 13:37
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 1 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 2 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 3 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 4 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 5 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 6 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 7 von 8 29.06.2020, 14:47
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 8 von 8 29.06.2020, 14:47
KONZERT | Beitrag vom 26.06.2020 DSO Berlin spielt live mit Antonello Manacorda Sinfonie in der Kammer Moderation: Volker Michael Beitrag hören Antonello Manacorda (Nikolaj Lund) Sein letztes Konzert in der verkürzten Corona-Saison spielt das Deutsche Symphonie- Orchester Berlin an diesem Abend als Rundfunkkonzert im Sendesaal im Berliner Haus des Rundfunks. Antonello Manacorda dirigiert Werke von Richard Strauss, Arnold Schönberg und Wolfgang Amadeus Mozart. Es gilt immer in diesen Zeiten, aus der Not eine Tugend zu machen. Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin spielt jetzt nicht im großen Saal der Philharmonie und nach wie vor ganz ohne Publikum. Das hier gibt es nur bei uns im Radio und im Internet – was die Programme angeht, ist es eine große Chance: Das konnten alle Beteiligten schon bei unserem ersten Orchesterkonzert am 17. Juni feststellen: Orchestermusikerinnen und -musiker und Dirigenten können hie und da Stücke programmieren, die sonst nicht so leicht reinzunehmen sind.
Große Chance für Besonderes Das ist an diesem Abend vor allem die Kammersinfonie op. 9 von Arnold Schönberg. 15 Instrumente sieht der Wiener Meister darin vor: Das ist kein richtiges Orchester, vor allem was die Streichergruppe angeht. Das ist ein Sonderfall der Literatur – aber es ist Musik wie geschaffen für Corona-Bedingungen. Und die Distanz, die die Ausführenden zueinander wahren müssen, die tut dem Werk sehr gut. Es wird transparent und klingt logisch, zugleich spürt man, dass es Schönberg in diesem harmonischen und melodischen Korsett nicht mehr lang würde aushalten können. So ist das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ohne Corona-Bedingungen besetzt. Heute wird es zeitgemäß kleiner Besetzung spielen. (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin / Frank Eidel) Antonello Manacorda ist überhaupt erst das zweite Mal beim DSO Berlin. Er lebt in Berlin und ist ja seit vielen Jahren künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam. Dort hat er einen hochgelobten Zyklus mit allen Sinfonien Franz Schuberts und von Felix Mendelssohn Bartholdy gemacht. Diese Einspielungen hat Deutschlandfunk Kultur als Partner mitproduziert. Er ist auch weltweit als gefragter Operndirigent unterwegs. Aber das geht ja derzeit noch gar nicht, selbst wenn die Grenzen schon wieder offen sind – Oper und Chorgesang werden momentan noch besonders kritisch gesehen. Zum Programm spricht er mit Volker Michael:
Die „Metamorphosen“ von Richard Strauss, sie stehen heute Abend am Anfang. Ein seltsames Trauerstück – Strauss hat sie 1945 geschrieben und „Studie für 23 Solostreicher“ genannt. Musik eines alten Mannes? Er war alt, sehr alt, aber noch nicht am Ende seiner Kreativität. Angesichts dessen, was passiert war, wirkt diese Musik schon ein wenig bedenklich. Trotz Shoah und Völkermord und Millionen Kriegstoten beweint Strauss allein den Untergang Dresdens und der klassisch-deutschen Kultur. In diesem ausschweifenden Werk meditiert er über Motive aus dem langsamen Satz von Beethovens „Eroica“. Dieses Werk wirkt immer wieder rätselhaft – aber Metamorphosen bringen in der Natur ja oft rätselhafte Wesen hervor. Unverkrampft und offen, aber nicht weniger tiefgründig wirkt dagegen Wolfgang Amadeus Mozarts große g-Moll-Sinfonie KV 550, eines seiner bekanntesten Werke. Die gibt es an diesem Abend am Schluss unserer Live-Übertragung. Live aus dem Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin Richard Strauss „Metamorphosen“ für 23 Solo-Streicher Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 Arnold Schönberg Kammersinfonie für 15 Solo-Instrumente Nr. 1 E-Dur op. 9
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469635/19 1 von 2 29.06.2020, 13:36
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469635/19 2 von 2 29.06.2020, 13:36
Die ″neue Normalität″ im Konzertsaal - ein Selbstversuch | Kultur | DW... https://www.dw.com/de/die-neue-normalität-im-konzertsaal-ein-selbstv...
THEMEN / KULTUR
K O NZ E RT LEB E N
Die "neue Normalität" im Konzertsaal - ein
Selbstversuch
Langsam läuft der Konzertbetrieb in Deutschland wieder an. Wie es sich anfühlt, in Zeiten gelockerter Corona-
Beschränkungen wieder eine Philharmonie zu besuchen, hat Anastassia Boutsko ausprobiert.
Erstes Konzert mit Publikum in der Kölner Philharmonie
Köln, ein Freitagnachmittag Ende Juni. Die Einkaufsstraßen sind voll, in den Cafés ist kaum ein freier Tisch zu finden. Auch
vor der Kölner Philharmonie, einer der größten in Deutschland, ist wieder Leben: Das WDR-Sinfonieorchester lädt zum
ersten Publikumskonzert ein – beziehungsweise gleich zu zwei, denn der renommierte Klangkörper unter der Leitung von
Christian Măcelaru gestaltet an diesem Abend zwei etwa einstündige Konzerte mit unterschiedlichen Programmen, um 18
und um 21 Uhr. Zum einen, um unnötige Begegnungen in der Pause zu vermeiden, zum anderen, damit möglichst viele
Musikliebhaber nach einer über dreimonatigen Musik-Abstinenz wieder ein Konzert live erleben können.
Zur Enttäuschung vieler Musikliebhaber sind die Karten noch nicht im freien Verkauf zu erwerben. Die genau 440 Sitzplätze,
die man nach Corona-Regeln im Saal der Kölner Philharmonie mit ihren insgesamt über 2000 Sitzplätzen besetzen darf, sind
in einem Losverfahren unter dem Abonnement-Publikum verteilt worden. Die Nachfrage muss sehr hoch gewesen sein, denn
viele gingen leer aus. Nur ungefähr jeder Dritte hatte Glück.
1 von 4 29.06.2020, 15:01Die ″neue Normalität″ im Konzertsaal - ein Selbstversuch | Kultur | DW... https://www.dw.com/de/die-neue-normalität-im-konzertsaal-ein-selbstv...
Mit Abstand: Schlange stehen vor der Philharmonie
Spätestens eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn reiht man sich dann als die oder der Auserwählte in eine höchst
disziplinierte und rekordverdächtig lange Schlange ein, die sich über mindestens 150 Meter erstreckt. Die Stimmung in der
Schlange ist feierlich, geredet wird kaum. Bei einigen Damen passen die Masken, das neue Accessoire der Saison, farblich
zum Outfit und weisen eine gewisse Eleganz auf. Die Herren bevorzugen auch beim Mundschutz schlichtes Schwarz.
Karten nur für Auserwählte
Wie bei der Bestellung schriftlich verordnet, halten alle ihre vorab ausgedruckten Tickets sowie ein in Blockschrift
ausgefülltes "Formular zur Besucherregistrierung" mit sämtlichen Personal- und Kontaktdaten in der Hand, ein Fehlen von
Corona-Symptomen wird per Unterschrift versichert. Ein paar Glückssucher halten den Auserwählten ihre Kartenwunsch-
Plakate entgegen – umsonst.
Beim Betreten des Foyers sprühen die "Blauen Mädchen", die
Mitarbeiterinnen der Philharmonie, großzügig Desinfektionsmittel auf
die entgegengestreckten Hände. Ihre Kollegen übernehmen und
weisen dem Publikum die Plätze an. Diese sind nicht nummeriert, die
Halle wird nach und nach, ab der ersten Reihe, von unten nach oben
befüllt. Wer zu einem Haushalt gehört, darf zusammensitzen.
Zwischen den Grüppchen gähnen Lücken von drei bis vier leeren
Plätzen, jede zweite Reihe ist ebenso frei.
Sicherheit im Konzertsaal: So werden Besucher empfangen "Boarding completed"
"Boarding completed" ruft ein Witzbold in Blau seinen Kollegen kurz vor 18 Uhr zu. Die Musiker kommen auf die Bühne, 25
von insgesamt über 100 Mitgliedern des WDR-Orchesters. Streicher, Pauke, Bläser, alle halten Distanz. Als letzter betritt der
Dirigent Christian Măcelaru die Bühne – mit Maske, die er dann aber vor dem Dirigieren abnimmt.
Und dann erklingt der erste Ton…
Dieses in den vergangenen Corona-Monaten zwar nicht vergessene, aber dennoch überwältigende Gefühl, Musik live zu
erleben! Ein Musik-Erlebnis in der Realität ist durch keinen noch so gut gemachten Stream und keine noch so toll
produzierte Aufnahme zu ersetzen. Trotz kleiner Besetzung ist der Klang satt und opulent.
2 von 4 29.06.2020, 15:01Die ″neue Normalität″ im Konzertsaal - ein Selbstversuch | Kultur | DW... https://www.dw.com/de/die-neue-normalität-im-konzertsaal-ein-selbstv...
Wieder musizieren: Dirigent Christian Macelaru
Das Programm ist etwas Besonderes: Aus dem riesigen Fundus europäischer klassischer Musik wurden Werke für kleine
Orchesterbesetzung ausgewählt, die sonst nur selten erklingen – wie etwa "Trittico Botticelliano" des italienischen
Komponisten Ottorino Respighi. "Normalerweise programmiert man diese Werke nicht, weil man eben ein großes Orchester
hat", erklärt Dirigent Măcelaru. Dabei handelt es sich um wahre Schätze. "Damit kann man auch jahrelang Programme
gestalten", so der Musiker. Zu hoffen ist das aber natürlich nicht – zumindest dann nicht, wenn die Pandemie der Grund
dafür sein sollte.
Musik als Hoffnung
Nach knapp einer Stunde Musikgenuss bedankt sich das Publikum mit einem stürmischen Applaus und verlässt diszipliniert
den Saal. Um 21 Uhr gibt es das nächste einstündige Konzert – diesmal mit dem Pianisten Igor Levit, der schon beim
Betreten der Bühne Applaus kassiert.
Pianist Igor Levit
Igor Levit ist ein Held des Lockdowns – seine Hauskonzerte auf Twitter haben tausenden Menschen über die schwierigen
Wochen geholfen. Diesmal spielt Levit Mozarts A-Dur-Konzert. Der Klang ist weich und fließend, die Musik durchströmt den
Saal. Danach spielt das Orchester noch Schuberts 5. Sinfonie. Der Abend ist viel zu schnell vorbei. Mundschutz auf und ab
3 von 4 29.06.2020, 15:01Die ″neue Normalität″ im Konzertsaal - ein Selbstversuch | Kultur | DW... https://www.dw.com/de/die-neue-normalität-im-konzertsaal-ein-selbstv...
zum Ausgang, Abstand halten.
Nur selten spürte man so stark, was Musik eigentlich ist: Trost und Hoffnung.
DI E REDA KT I ON E MP F I EHLT
75 Jahre Kriegsende: Deutsche Welle sendet virtuelle Klassik-Konzerte aus Russland und Deutschland
Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges virtuell statt. Zum Gedenken errichtet die
DW eine musikalische Brücke zwischen Russland und Deutschland. (08.05.2020)
Operngala Bonn digital: DW zeigt Sondersendung mit Interviews, Hauskonzerten und Best of der Gala 2016
Die diesjährige Gala der Deutschen AIDS-Stiftung findet in diesem Jahr mit aktuellen Interviews, exklusiven Wohnzimmerkonzerten und
den Höhepunkten der Gala aus dem Jahr 2016 virtuell statt. (08.05.2020)
4 von 4 29.06.2020, 15:01Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469633/21 1 von 1 29.06.2020, 13:48
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469617/19 1 von 1 29.06.2020, 13:56
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/791085/12 1 von 1 29.06.2020, 12:48
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 1 von 4 29.06.2020, 14:50
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 2 von 4 29.06.2020, 14:50
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 3 von 4 29.06.2020, 14:50
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/616/ 4 von 4 29.06.2020, 14:50
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
F.A.Z. - Feuilleton Samstag, 27.06.2020
Auf Bewährung
Kirill Serebrennikow schuldig gesprochen
Einen „Schauprozess über die zeitgenössische Kunst und Kultur“ nennt die Verlege-
rin Irina Prochorowa das Gerichtsverfahren gegen den Regisseur Kirill Serebrenni-
kow und drei seiner ehemaligen Mitstreiter vom Theaterprojekt „Platforma“, die
vom Moskauer Meschtschanski-Gericht schuldig gesprochen wurden. Nur der Leite-
rin des Moskauer Jugendtheaters, Sofia Apfelbaum, die mit „Platforma“ als Ange-
stellte des Kulturministeriums kooperiert hatte, seien, wie die Richterin Olesja
Mendelejewa erklärte, die „kriminellen Vorgänge“ nicht bewusst gewesen. Sie habe
fahrlässig gehandelt. Serebrennikow bekam drei Jahre Haft auf Bewährung, er muss
10000 Euro Strafe zahlen, darf aber sein Gogol-Center weiter leiten.
Die Anklage hatte auch Apfelbaums Schuld als „erwiesen“ bezeichnet und vier Jahre
Haft sowie eine Geldstrafe von 2800 Euro für sie verlangt. Im Übrigen wiederholte
Mendelejewa in ihrer Urteilsbegründung über weite Teile die Anklageschrift.
Demnach soll Kirill Serebrennikow in der Zeit 2011 bis 2014 als künstlerischer Leiter
von „Platforma“ eine Verbrechergruppe gegründet haben, um Fördermittel des
Kulturministeriums zu veruntreuen, sich und seine Mittäter persönlich zu bereichern
und das Ministerium hinters Licht zu führen.
Zum Gerichtsgebäude waren am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen
mehrere hundert Moskauer Bürger gekommen, um die Angeklagten moralisch zu
unterstützen und ihre Empörung über die russische Unrechtsjustiz kundzutun. Der
Rapper Oxomiron hatte seine Fans über Twitter aufgerufen, ihre Ablehnung orches-
trierter Prozesse wie jenes gegen Serebrennikow auszudrücken, durch die kreative
und freiheitsliebende Leute eingeschüchtert werden sollten.
Zum Gericht kamen – alle mit Gesichtsmasken – die Schriftsteller Lew Rubinstein,
Dmitri Bykow, Alexander Archangelski, der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, die
Rocksänger Roma Swer und Mark Tischman, außerdem Bewunderer von Serebren-
nikow und seinem Gogol-Center, Angehörige künstlerischer Berufe und der
Bildungsschicht. Viele bezeichneten das Verfahren als fabriziert und als eine Bedro-
hung für die gesamte russische Zivilgesellschaft. In einem gerechten Verfahren
wären die Angeklagten freigesprochen worden, hörte man immer wieder. In regel-
mäßigen Intervallen wurde den Angeklagten applaudiert. Später traten auch junge
Leute auf, offenbar bestellte Provokateure, die identische T-Shirts mit der Aufschrift
„obnal=ukral“ (zu Deutsch: In Bargeld umwandeln heißt stehlen) trugen und die
Leute fragten, warum sie von der Unschuld der Angeklagten so überzeugt seien. Als
bekannt wird, dass die Haftstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden, jubelt die
Menge.
Die Anklage legt Serebrennikow und seinen Mitstreitern zur Last, dass sie Überwei-
sungen des Kulturministeriums illegal in Bargeld umgewandelt hätten, etwa um
Künstler zu bezahlen. Das ist freilich auch wegen der von Kulturschaffenden oft
1 von 2 29.06.2020, 11:50Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
beklagten russischen Gesetzeslage in der Theaterszene üblich. Anstelle eines Verfah-
rens wegen Fehlern in der Buchführung machte die Staatsanwaltschaft daraus aber
einen Kriminalfall mit einem angeblichen Diebstahl von umgerechnet 1,6 Millionen
Euro. Bezeichnend ist auch, dass vom Gericht insgesamt drei Gutachten in Auftrag
gegeben wurden, von denen die ersten beiden die Beschuldigten entlasteten – was
offenbar nicht ins Konzept passte. Erst das dritte, das zu niedrige Kostenschätzungen
ansetzte und manche Produktionen von „Platforma“ gar nicht berücksichtigte, wurde
als Beweismittel akzeptiert.
Die russische Kulturministerin Olga Ljubimowa bekräftigte, dass ihre Behörde und
der Staat durch „Platforma“ schwer geschädigt worden seien. Es war die erste Wort-
meldung von Ljubimowa, die vor Tagen eine Petition von nahezu viertausend Kultur-
schaffenden, die Klage zurückzuziehen, ignoriert hatte. Gleichsam als Trost
versprach die Ministerin, ihre Behörde werde gesetzgeberische Akte vorbereiten, die
„tragische Ereignisse, wenn Kreative mit Geld in Berührung kommen“, künftig
vermeiden sollten. Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, sagte, bei der
Aufwendung von Finanzmitteln für die Kultur müsse Korruption effektiver verhin-
dert werden. Im Übrigen nähmen die Machthaber keinerlei Spannungen in der
Gesellschaft infolge des Prozesses wahr, so Peskow.
Der Ex-Produzent von Serebrennikow, Alexej Malobrodski, der wegen dieser Zusam-
menarbeit schon für fast ein Jahr in Untersuchungshaft zubringen musste, kam,
offenbar für den Fall, dass er wieder eingesperrt würde, mit einer Reisetasche ins
Gericht. Er akzeptiere nur einen Freispruch, sagte Malobrodski, der zwei Jahre auf
Bewährung bekam. KERSTIN HOLM
2 von 2 29.06.2020, 11:50Sängerin Anna Prohaska: Evas Werk und Annas Beitrag - WELT https://www.welt.de/kultur/article210279967/Saengerin-Anna-Prohask...
(https://www.youtube.com
/watch?v=y7htAlPqwBI)
(/print/die_welt/literatur/article146060593/Das-Buch-der-
Lieder.html)
(/kultur/klassik/plus206552141/So-nah-ist-
uns-die-Belle-Epoque-Star-Geiger-Daniel-Hope-im-Gespraech.html)
1 von 3 29.06.2020, 13:30Sängerin Anna Prohaska: Evas Werk und Annas Beitrag - WELT https://www.welt.de/kultur/article210279967/Saengerin-Anna-Prohask...
(https://www.youtube.com/watch?v=BUpKf_AEYLk)
(https://www.deutschegrammophon.com/en/artists/anna-prohaska/videos/franz-schubert-des-fischers-
liebesglueck-aus-dem-album-sirene-254188) (https://www.br.de
/mediathek/video/anna-prohaska-behind-the-lines-making-of-av:5a3c55d68f247a0018b770fc)
(https://www.facebook.com/annaprohaska/posts/3208118379198733?comment_id=3208920255785212&
reply_comment_id=3212399545437283)
(https://www.pinterest.de/pin/480970435196098734/)
–
(http://www.juliusdrake.com/)
–
2 von 3 29.06.2020, 13:30Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465001/12
F.A.Z. - Musik Montag, 29.06.2020
Schauerstücke einer schwarzen
Romantik
Der Bariton Stéphane Degout brilliert mit deutschen Balladen
Das Wort vom „norddeutschen Schubert“ über Carl Loewe ist sicher (zu) hoch gegrif-
fen. Wie fesselnd aber die Begegnung mit dessen Balladen, recht eigentlich Musik-
dramen en miniature, sein kann, beweist Stéphane Degout mit dem ersten der drei
Lieder aus dem Opus 1 des vermeintlich Unzeitgemäßen: „Edward“. Es ist ein grausi-
ges Psychogramm, in dem Edward im Dialog mit der Mutter blutige Taten einge-
steht: erst seinen Geier und sein Ross, dann seinen Vater getötet zu haben, bevor er
den Fluch der Hölle wider die Mutter richtet: „Ihr rietet’s mir.“
Mit fein ausdifferenzierten Klanggestalten – für die panisch-angstvollen Fragen der
Mutter, die hohl-verzweifelten „Oh“Seufzer des Täters und den wutrasenden Fluch –
gelingt dem französischen Bariton eine packende mise en scène des dramatischen
Geschehens. Auch für die Ausbrüche – etwa dem auf das G führenden Forte-Schrei
in der Phrase „Ich hab’ geschlagen meinen Vater tot“ – stehen seiner Stimme gren-
zenlose Energiereserven zur Verfügung. Von dem „schauderhaften schottischen
Lied“, das Herder ins Deutsche übersetzte, ließ sich Johannes Brahms zu den
Klavierballaden op. 10 ebenso anregen wie zur ersten von vier Balladen für zwei
Stimmen (op. 75) – dem Mezzo-Part entspricht Felicity Palmer auf dieser Einspie-
lung mit dem schrillen Ton einer Scheuche.
Für seine Sammlung „Balladen und Lieder“ hat Degout weitere Schauerstücke der
schwarzen Romantik ausgewählt: darunter Schuberts erotische Tragödie über die
Ermordung einer Königin durch ihren Zwerg aus verschmähter Liebe; Robert Schu-
manns Vertonung von Heinrich Heines „Belsazar“, die mit gotteslästerlichem Lärm
beginnt und in einem beklemmenden Rezitativ-Decrescendo – „von seinen Knechten
umgebracht“ – endet; endlich Hugo Wolfs „Der Feuerreiter“, eine stimmdramatische
tour de force und auch eine extreme pianistische Herausforderung, von Simon
Lepper glänzend bestanden. Die Phantasmagorie von dem Reitersmann, der sein
rippendürres Pferd in die Glut einer brennenden Mühle treibt und nach langer Zeit
als Gerippe gefunden wird, kann leicht zur komischen Schauermär entstellt werden.
Degout verzichtet auf alle Bänkelsänger-Übertreibungen, alle Ausdrucks-Pleonas-
men mit den Mitteln der Wortmalerei und vertraut auf das vokale Erzählen: die
deutschen Texte nicht nur sauber artikulierend, sondern auch eloquent sprechend.
Franz Liszts Ballade „Die drei Zigeuner“ – eine Art von Rezitativ mit Zwischenspie-
len und kurzen Ariosi eines geigenspielenden Musikanten, eines Rauchers und eines
Zymbalspielers – hat den Charme einer wiederum auch pianistisch brillanten Erzäh-
lung. Für Liszts „Tre sonetti di Petrarca“ – eigentlich Fremdkörper in diesem
Programm – bringt Degout nicht die ideale Stimme mit: nicht den lückenlos strö-
menden und gesteigerten Amoroso-Ton (wie er in der Aufnahme von Margaret Price
zu bewundern ist). Eigentlich möchte man die Lieder von der Stimme hören, für die
sie geschrieben worden sind: für den legendären Tenor
1 von 2 29.06.2020, 11:40Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465001/12
Giambattista Rubini (ein Tourneepartner des Komponisten um 1840). Wie glühend
und feurig und zärtlich sie klingen können, ist hier nur erahnen – und bei Luciano
Pavarotti (in der Aufnahme von 1988) zu erleben. Jürgen Kesting
2 von 2 29.06.2020, 11:40Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469633/23 1 von 2 29.06.2020, 13:52
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469633/23 2 von 2 29.06.2020, 13:52
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/791085/10
Playboy
1 von 1 29.06.2020, 12:47Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
F.A.Z. - Feuilleton Samstag, 27.06.2020
Mein Herz so weiß
Ist es rassistisch, bei der Beurteilung von Musik nach Hautfarben zu
unterscheiden? Im Pop ist das bis heute der Normalfall.
Die Ersten, die ihm, und das sogar stehend, applaudierten, noch bevor er auch nur
eine Note gespielt hatte, waren Weiße – weiße Hippies. Damit hatte B.B. King nicht
gerechnet; der Bluesgitarrist brach in Tränen aus. Carlos Santana schildert jenen
Februarabend des Jahres 1967 im Fillmore West von San Francisco in seinen
Lebenserinnerungen: „Dann ging B. auf die Bühne, und Bill Graham trat ans Mikro-
fon und stellte ihn vor: ,Ladies and Gentlemen – der Vorstandvorsitzende, Mr. B.B.
King!‘ Es war, als wäre dieser Höhepunkt geplant worden. Alles kam zum Stillstand,
und jeder erhob sich und applaudierte – lange. B. hatte noch keinen Ton gespielt und
bekam bereits Standing Ovations.
Dann begann er zu weinen. Er konnte sich nicht zurückhalten. Das Licht fiel so auf
ihn, dass ich die großen Tränen aus seinen Augen kullern sah. Sie glitzerten auf
seiner schwarzen Haut. Er hob die Hand, um sich die Augen zu wischen, und ich sah,
dass er einen großen Ring am Finger trug, auf dem sein Name mit Diamanten
geschrieben stand. Daran erinnere ich mich am besten: Diamanten und Tränen, die
gemeinsam funkelten.“
Heftiger als in allen anderen Kunstformen war die Rock- und Popgeschichte von
ihren Anfängen an der Schauplatz und im Grunde auch das Produkt der Auseinan-
dersetzungen von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe; und sie ist voll von
Szenen, in denen sich die Begegnung dieser Menschen in symbolhafter Verdichtung
vollzog, nicht immer mit einem Ausgang wie dem von Carlos Santana geschilderten.
Chuck Berry wollten Rassisten einmal daran hindern, bei seinem eigenen Konzert
aufzutreten. Die Rolling Stones, noch gar nicht ganz trocken hinter den Ohren, trafen
im Chicagoer Tonstudio ihr Idol Muddy Waters, der, weil er mit seiner Musik nicht
genug verdiente, gerade die Wände tapezierte. Aretha Franklin reiste nach zwei
Aufnahmen aus den Fame Studios von Muscle Shoals, Alabama, wieder ab, nachdem
es dort zu hässlichen Wortwechseln zwischen ihrem damaligen Ehemann und
weißen Studiomusikern gekommen war.
Dorthin hatte die New Yorker Plattenfirma Atlantic Records auch ihren damaligen
Star Wilson Pickett fliegen lassen, der, je weiter es nach Süden ging, immer mehr
Bauwollpflücker sah und darüber so empört war, dass er das Flugzeug sofort umkeh-
ren lassen wollte. Pickett blieb gegenüber dem weißen Lager zeitlebens angriffslustig
eingestellt („There’s all kinds of ways to trick whitey“) und gab sich bei seinen
Konzerten Mühe je nach dem Anteil schwarzer Zuhörer; bei weißen, so behauptete
er, lohne sich das nicht, die verstünden nichts von Soulmusik.
Es fällt auf und spricht für die Professionalität der Künstler aus der großen Zeit der
Black Music zwischen den fünfziger und den siebziger Jahren, dass es unter ihnen
nur wenige mit einer militanten Einstellung gab. Von den großen Alten, ob Chuck
1 von 4 29.06.2020, 11:51Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
Berry oder B.B. King, Little Richard oder Sam Cooke, sind keine Feindseligkeiten
überliefert. Ray Charles behauptete sogar, er habe „keine Sekunde gezögert“, als sich
ihm 1960 mit dem Wechsel von Atlantic zu ABC Paramount die Chance bot, aus dem
überschaubaren Rahmen, den ihm das schwarze Publikum bot, auszubrechen. Denn
im Getto waren sie oder fühlten sie sich mehr oder weniger alle, auch im Stil- und
Geschmacksgetto. Die R&B- und die Popcharts waren damals so getrennt wie im
Süden die Sitzplätze in den Bussen und in den Restaurants, und jeder, der mehr als
einen Erfolg bei Minderheiten anstrebte, wollte die Kluft überwinden und mit seinen
Liedern am liebsten in beiden Hitparaden vertreten sein, denn erst dies bedeutete so
etwas wie universelle Akzeptanz.
Gleichwohl gab es Musiker mit einem besonders ausgeprägten „Rassen“-Bewusstsein
und wenig Kompromissbereitschaft, allen voran der Jazz-Trompeter Miles Davis, der
um 1970 auch im Rocklager zu Einfluss kam, aber kategorisch sagte: „Rock ist ein
Begriff des weißen Mannes, und ich bin kein weißer Mann.“ Aus dem Soul ist, außer
Wilson Pickett, natürlich James Brown („Say it loud, I’m black and I’m proud“) zu
nennen, der sich abfällig über anpassungsfähige „Renommierneger“ wie Sammy
Davis Jr., Sidney Poitier oder Bill Cosby geäußert hat. Als die Ghettos brannten,
mahnte er die Schwarzen zur Vorsicht.
Browns Einfluss war so immens, dass ein Polizeioffizier sagte: „Eine einzige Handbe-
wegung von James Brown ist so viel wie hundert Polizisten wert.“ Die Jazz- und
Soulsängerin Nina Simone hat die Musik mit ihren Lebenserfahrungen auf beson-
ders bedrückende Weise kurzgeschlossen: „Mein ganzes Leben lang wollte ich
herausschreien, was es heißt, eingekerkert zu sein. Denn ich kenne die tödliche Stille
des gesellschaftlichen Gefängnisses, in dem man als Farbiger lebt.“ Das ist etwas
anderes, Härteres als „In The Ghetto“, das der politisch indifferente Elvis Presley zu
einem Melodram machte, das so verführerisch war wie der Film „Imitation of Life“
von Douglas Sirk.
Früh und gezielt ergriff Bob Dylan für schwarze Unterprivilegierte Partei: Seine
Songs „The Death of Emmett Till“ (für einen aus reinem Rassismus ermordeten
Halbwüchsigen), „The Lonesome Death of Hattie Carroll“ (für eine vom Plantagen-
besitzer erschlagene Haushälterin) und „Hurricane“ (für den unschuldig einsitzen-
den Boxer Ruben Carter) gehören zu seinen wirkungsmächtigsten Anklagen. Was
diese und andere Statements aus der klassischen Rock- und Soul-Ära vom heutigen
Protest unterscheidet, ist die historische Tiefenschärfe, die im postkolonialistischen
Zeitalter herrscht. Das systematische Unrecht, die Sklaverei, kam kaum zur Sprache.
So weit die Vermengung und die Ausdifferenzierung der musikalischen Stile auch
fortgeschritten sind – die Dichotomie schwarz/weiß besteht fort. Wenige Deuter der
amerikanischen Gesellschaft haben so früh erkannt, welche Rolle sie nicht nur für
die Kultur, sondern überhaupt für die Art zu leben spielte, wie Norman Mailer. Sein
Essay „The White Negro“ (1957/59) führt die Dringlichkeit der Rassenfrage anschau-
lich vor und belässt sie dabei, obwohl sie hier zu einem Religionsersatz wird, in
schlüssiger Unentschiedenheit. Wird, so fragt er schließlich, und man sieht schon
Sidney Poitier in „Rat mal, wer zum Essen kommt“ vor sich, die weiße Mehrheit die
schwarze Minderheit als gleichwertig akzeptieren und restlos in die Gesellschaft
aufnehmen? Und zwischen wem wird dermaleinst der Kampf um die Vorherrschaft
entschieden werden: „Zwischen den Schwarzen und den Weißen, zwischen den
Frauen und den Männern, zwischen den Schönen und den Hässlichen, zwischen den
Plünderern und den Geschäftsführern oder zwischen den Rebellen und denen an den
2 von 4 29.06.2020, 11:51Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
Stellschrauben?“
Wir wissen es immer noch nicht. Norman Mailer aber spürte, dass es für jeden, der
nach tieferer Erfüllung, nach tieferer Erkenntnis im Leben suchte, nicht gleichgültig
sein konnte, ob er sich der schwarzen oder der weißen Kultur zuwandte. Die Hipster,
die weißen Grenzgänger in seinem Buch, finden, wie ein Großteil der späteren Beat
Generation, mehr Intensität und Echtheit im damaligen Jazz, der für die auf ihre
Privilegien bedachte Mehrheit genauso „Negermusik“ war wie danach der Rock ’n’
Roll.
Wenn in der amerikanischen Unterhaltungsmusik, im alten Rhythm & Blues, damals
noch segregationistisch „Race Music“ genannt, im Rock ’n’ Roll, im Soul und natür-
lich im Jazz die Hautfarbe eine größere Rolle spielte als beispielsweise im Film, dann
auch deswegen, weil mit ihr zumindest implizit Aussagen oder Annahmen über
Fähigkeiten verbunden waren, die man für angeboren hielt. Das berührte das Wesen
der Kunst selbst. Man muss es heute besonders vorsichtig formulieren, aber die
allermeisten Hörer dürften immer noch eine Vorstellung davon haben, wie sich
„schwarzer“ und wie sich „weißer“ Gesang anhört, während wohl kaum jemand auf
die Idee käme, etwas Entsprechendes für die Schauspielerei geltend zu machen. Ist
es rassistisch, bei der Beurteilung künstlerischer Ausführung noch nach Hautfarben
zu unterscheiden? Nach heutigen Maßstäben zweifellos.
Die Zuschreibungen haben ihre Unschuld verloren und sind als Distinktionsmerk-
male trotzdem noch nicht ganz abgeschafft. So inbrünstig und frenetisch, so sinnlich
und lässig wie die Schwarzen sangen und tanzten die Weißen am Ende eben doch
nicht – bis Elvis Presley im Juli 1954 im Sun Studio von Memphis, Tennessee, sein
erstes Lied aufnahm und die Leute abends beim Radiosender anriefen, das könne
nicht sein, dass dieser junge Mann die und die Schule besucht habe, denn dort seien
nur Weiße zugelassen, und der hier sei ja wohl eindeutig ein Schwarzer. Die Empirie
hat immer wieder gezeigt, dass Weiße sich sehr wohl „schwarze“ Stile anzueignen
vermochten. Dennoch ist beispielsweise der Soul ein genuin schwarzes Genre, zu
dem Weiße wenig beigetragen haben.
Das weite, heute tonangebende Feld des zeitgenössischen R&B und des Hip-Hop, auf
dem es Schwarze zu einem Wohlstand gebracht haben, der früher unmöglich war,
wäre noch ein eigenes Thema. Der Motown-Konzern hat in den Sechzigern mit einer
auf die Spitze getriebenen Kommerzialität wertvolle Vorarbeit geleistet und die Inte-
gration schwarzer Künstler stärker vorangetrieben als manche politische Anstren-
gung. Dass es, nach dem Tod von Michael Jackson und von Prince, noch oder wieder
schwarze Musiker gibt, die Massenidole wurden, wird man nicht als Rückschritt
verbuchen. Beyoncé, Kanye West und andere Interpreten kommen desto eher zu
globalem Ruhm, je kämpferischer, „rassenbewusster“ sie sich geben.
Die alte Dichotomie scheint immer noch wirksam. Aber worum geht es jenseits
davon? Um Musik und Gesang als Feier menschlichen Seins, das (hoffentlich) als
etwas Universelles begriffen wird. Atlantic-Vizepräsident Jerry Wexler, der unend-
lich viel für schwarze Musik getan hat, feierte Aretha Franklin 1967 euphorisch als
„wonderful human being“. Als Amerika in der vergangenen Woche mit denkbar
gemischten Gefühlen den Jahrestag des Endes der Sklaverei beging, brachte die
Sängerin Beyoncé dazu ein neues Lied heraus, „Black Parade“, das am Anfang gospe-
liger ist als alles, was sie zuvor gesungen hat und auch von Mahalia Jackson stam-
3 von 4 29.06.2020, 11:51Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464993/9
men könnte. Dazu schrieb sie: „Ich hoffe, wir können weiterhin unsere Freude
miteinander teilen und uns gegenseitig feiern, auch inmitten all der aktuellen Strapa-
zen. Bitte hört nie damit auf, euch an eure Schönheit, eure Stärke und eure Kraft zu
erinnern. Happy Juneteenth Weekend!“
I’m going back to the south: So beginnt das Lied, und man überfrachtet es nicht,
wenn man dies als programmatische Besinnung auf ethnische Wurzeln begreift. Der
amerikanische Süden, aus dem all diese großartige Musik hervorging, hat, wie Peter
Guralnick in seinem Buch „Sweet Soul Music“ zeigt, mit der oftmals ganz pragmati-
schen, hochproduktiven Kooperation von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe
wenigstens künstlerisch etwas hinbekommen, was politisch immer noch so schwer
ist: Gleichberechtigung.EDO REENTS
4 von 4 29.06.2020, 11:51Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/791035/15
New Yorker
1 von 3 29.06.2020, 13:02Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/791035/15
Atlantic
2 von 3 29.06.2020, 13:02Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/791035/15 3 von 3 29.06.2020, 13:02
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464997/7
F.A.S. - Politik Sonntag, 28.06.2020
Angst vor der Annexion
In den Dörfern des Jordantals leben und arbeiten die Palästinenser gut
mit den Israelis zusammen. Ist es damit bald vorbei? Von Jochen
Stahnke
Ibrahim Taamri hat die vergangenen vierzig Jahre in einer Symbiose gelebt. Mit dem
Jordantal, einem Glutofen fruchtbaren Landes vierhundert Meter unter dem
Meeresspiegel, wo seine Familie Schafe und Ziegen hielt. Und mit der jüdischen
Siedlung neben seinem Dorf, die ihm Lohn und Arbeit gab. Aus der Gegend um
Bethlehem kam die Familie einst als Beduinen hierher, und jetzt hat sie ein kleines
Haus und einen grauen Mazda in der Garage.
Taamri musste lange dafür sparen. Hundert Schekel kriegt er am Tag, fünfundzwan-
zig Euro. Zu wenig, findet er. Aber er verstehe sich gut mit den Siedlern, die Arbeits-
losigkeit im Dorf gehe gen null. „Ich habe keine Probleme mit unseren Nachbarn.“ Er
steht an der Dorfstraße, einer windschiefen Sandpiste. Immer wieder fahren Dorfbe-
wohner auf Caddies mit israelischen Kennzeichen vorbei. Sie arbeiten auf den Dattel-
plantagen der Israelis. Das Vertrauen ist hier so groß, dass die Israelis ihnen erlau-
ben, mit den Fahrzeugen auch nach Hause zu fahren.
Das Dorf heißt Fasajil und gehört zu den Gebieten, die sich Israel laut dem amerika-
nischen Nahost-Plan einverleiben dürfte. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
kündigt die Annexion schon seit vergangenem Jahr immer wieder an. Was wirklich
passieren wird, weiß aber auch in Fasajil niemand.
„Keinem Palästinenser gefällt die Annexion“, sagt Taamri. Der 61 Jahre alte Großva-
ter hält seinen Enkel auf dem Arm in der Mittagshitze. Auf den israelischen Planta-
gen arbeiten sie täglich von sechs Uhr früh bis dreizehn Uhr, danach ist es zu heiß.
Taamri liest die Nachrichten auf dem Mobiltelefon. Er hat es mitbekommen, als
Netanjahu über die Annexionspläne sagte, Palästinenser würden in ihren „Enklaven“
verbleiben und „palästinensische Subjekte bleiben“.
Das Jordantal umfasst rund ein Viertel des Westjordanlandes, das Israel seit dem
Krieg von 1967 besetzt hält und das im Friedensabkommen von Oslo als Grundlage
für einen künftigen palästinensischen Staat festgelegt wurde. Die palästinensische
Führung sieht im Jordantal ihren Brotkorb und ihr letztes Landreservoir für die
Besiedelung der kommenden Jahrzehnte. Für Israel war das Gebiet immer eine stra-
tegische Reserve, um einer möglichen Bedrohung aus Jordanien zu begegnen, die
sich seit dem Friedensvertrag mit Amman allerdings verringert hat.
Das Gebiet ist dünn besiedelt. Mehrere zehntausend Palästinenser leben hier und
rund zwölftausend israelische Siedler. Außerhalb der Stadt Jericho untersteht das
meiste Gebiet im Jordantal direkter israelischer Militärverwaltung. Sie hat weite
Landstriche zu Sperrgebiet erklärt und stellt Palästinensern so gut wie keine Bauge-
nehmigungen aus.
1 von 3 29.06.2020, 12:26Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464997/7
„Es wäre besser, es bleibt alles, wie es ist“, sagt Taamri, „aber am liebsten hätten wir
einen eigenen Staat.“ Und wenn jetzt doch annektiert wird? „Dann werden wir
Wasser, Stromgebühren und Steuern an die Israelis zahlen.“ Bislang übernimmt die
palästinensische Autonomiebehörde diese Kosten, um die Einwohner dort zu halten,
im besetzten Gebiet. Vergangenes Jahr hielt Ministerpräsident Muhammad Shtajjeh
sogar eine Kabinettsitzung in Fasajil ab, so wichtig ist ihm das. „Er sagte uns, es
reiche, wenn wir in Fasajil wohnen bleiben“, sagt Taamri, „er erledige den Rest.“
Ob sich die Dorfbewohner darauf verlassen können, ist allerdings nicht gewiss. Das
Stromnetz ist alt und bricht ständig zusammen, während die israelische Siedlung
nebenan an ein modernes israelisches Netz angeschlossen ist. Solange die palästi-
nensische Autonomiebehörde Schulden bei den Israelis hat, wird Fasajil nicht ans
moderne Netz angeschlossen. So wird es in israelischen Zeitungen berichtet.
Taamri hat eine andere Version der Geschichte. Als Netanjahu die Annexion ankün-
digte, gingen die Bewohner demonstrieren, zum ersten Mal überhaupt: Sie blockier-
ten die Landstraße 90, den wichtigsten Verkehrsweg im Jordantal von Nord nach
Süd. Kurz darauf bekam der Dorfrat eine Rechnung der israelischen Elektrizitätswer-
ke für ein Jahr Strom in Höhe von 440000 Schekel, mehr als hunderttausend Euro.
„Das war eine Reaktion der Armee auf unsere Demonstration, als wir zweihundert
Leute auf der Straße hatten“, glaubt Taamri.
Andere sehen darin eine Vorstufe der Annexion. Israel verwalte die palästinensische
Bevölkerung in Orten wie Fasajil fortan direkt. Und es verschärfe dadurch die
Verdrängung von Palästinensern in den sogenannten C-Gebieten, also jenen Gebie-
ten des Westjordanlands, die in den Oslo-Verträgen bis 1999 übergangsweise von
Israel verwaltet und dann an die Palästinenser übergeben werden sollten. Das
Gegenteil trat ein: Israel hat die Zahl der Siedler im C-Gebiet mehr als verdreifacht
und den Druck auf die dort lebende palästinensische Bevölkerung erhöht. Stromge-
bühren können sich jedenfalls die wenigsten der rund tausend Einwohner von Fasa-
jil leisten.
„Wenn Israel annektiert, dann werden sie von uns Steuern erheben, und wir müssen
das Dorf verlassen“, sagt der Krämer Ijad Taamri, ein entfernter Verwandter des
alten Taamri. Ijad kennt die finanziellen Verhältnisse seines Dorfes, denn alle kaufen
bei ihm ein. Viele lassen anschreiben. Es werden immer mehr, er führt darüber ein
vollgeschriebenes Notizbuch. Die Löhne seien gleich geblieben, sagt er, aber die
Preise steigen. Trotzdem lässt er auf die Siedler nebenan nichts kommen. „Die Bezie-
hungen zu unseren Nachbarn sind gut, sie kommen sogar zu unseren Hochzeiten
nach Fasajil.“ Allerdings habe sich gezeigt, dass gewaltfreier Protest keine Freiheit
bringe. „Alles, was ich tun kann, ist hier wohnen bleiben.“
Ein paar Kilometer weiter die Landstraße 90 herunter wohnt ein Mann, der noch viel
mehr zu verlieren hat. Muhammad Kaswani macht mit seiner Dattelfarm und ange-
schlossener Verpackungsfabrik jedes Jahr drei Millionen Dollar Umsatz. Sein Haupt-
abnehmer ist die Türkei, in die er seine Datteln über den israelischen Hafen Aschdot
exportiert. Viele seiner Arbeiter kommen aus Fasajil. Auch er lebt in einer ungleichen
Symbiose mit den Siedlern. Siebzig Prozent seines Düngers kauft er von den Israelis,
und Kaswani behauptet, einige israelische Dattelproduzenten in der Gegend verpass-
ten ihren Produkten sogar ein palästinensisches Label, um ihre Datteln auch in
muslimische Staaten nach Asien verkaufen zu können. Kaswanis Gebäude befinden
2 von 3 29.06.2020, 12:26Sie können auch lesen