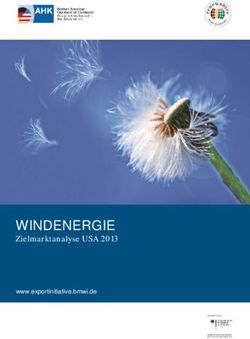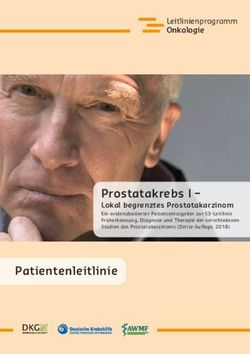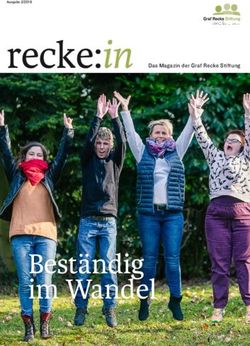Reproduktionsmedizin in den USA - Ein touristischer Zweig?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Reproduktionsmedizin in den USA –
Ein touristischer Zweig?
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts (MA)
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Mag. Sandra BUCHBAUER
am Institut für Moraltheologie an der
Katholisch-Theologischen Fakultät
Begutachterin Univ.-Prof. Dr. Martina
Schmidhuber
Graz, 2020Eidesstattliche Erklärung
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe
verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder
inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher
in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung
entspricht der eingereichten elektronischen Version.
________________________ ________________________
Ort, Datum Sandra Buchbauer
IIZusammenfassung
Zusammenfassung
Die Reproduktionsmedizin boomt! Dieser Bereich der Medizin hat sich in den letzten
Jahrzehnten rasant weiterentwickelt und wird immer populärer. Es werden nicht mehr nur die
Techniken verwendet, die im eigenen Land angeboten werden, sondern die Wunscheltern
reisen zur möglichen Lösung der Fruchtbarkeitsprobleme auch ins Ausland. Diese Art von
Gesundheitstourismus nennt man Reproduktionstourismus und ist Thema der vorliegenden
Masterarbeit.
In der Arbeit werden der Reproduktionstourismus in den USA sowie wichtige Techniken der
Reproduktionsmedizin im Zusammenhang damit näher beleuchtet. Den Beginn bildet ein
kurzer historischer Abriss der Reproduktionsmedizin und Gründe für deren Inanspruchnahme
werden genannt. Danach beschäftigt sich die Arbeit mit wichtigen Verfahren der
Reproduktionsmedizin, deren Abläufen, rechtlichen Aspekten, vor allem in Bezug auf die USA
und Österreich, und ethischen Perspektiven der Reproduktionsmedizin und des
Reproduktionstourismus. Hierbei wird auf die folgenden Verfahren näher eingegangen:
Insemination, In-vitro-Fertilisation, Eizellen- und Samenspende, Kryokonservierung,
Präimplantationsdiagnostik und Leihmutterschaft. Des Weiteren geht es um die Ukraine und
Indien, die ebenfalls durch den Reproduktionstourismus verdienen oder verdient haben.
Abschließend werden die Forschungsfragen mit Hilfe der in der Arbeit gewonnenen
Erkenntnisse beantwortet.
IIIAbstract
Abstract
Reproductive medicine is booming! This field of medicine has developed rapidly in the last
decades and is becoming more and more popular. Not only are the techniques used that are
offered in their own country, but the desired parents also travel abroad for the possible
solution of fertility problems. This kind of health tourism is called reproductive tourism and is
the subject of the present master thesis.
In the thesis reproductive tourism in the USA as well as important techniques of reproductive
medicine in connection with it are examined in more detail. It begins with a brief historical
overview of reproductive medicine and the reasons for its use. Afterwards the work deals with
important reproductive medicine procedures, its processes, legal aspects, especially with
regard to the USA and Austria, and ethical perspectives of reproductive medicine and
reproductive tourism. The following procedures are discussed in more detail: insemination, in
vitro fertilization, egg and sperm donation, cryopreservation, pre-implantation diagnostics
and surrogacy. Furthermore, we will deal with Ukraine and India, which also earn or have
earned money through reproductive tourism. Finally, the research questions are answered
with the help of the knowledge gained in this thesis.
IVInhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung ................................................................................................... II
Zusammenfassung ........................................................................................................... III
Abstract ........................................................................................................................... IV
1. Einleitung...................................................................................................................... 7
1.1 Problemstellung und Zielsetzung ..................................................................................... 7
1.2 Arbeitsgrundlagen und Methodik .................................................................................... 8
2. Die Reproduktionsmedizin .......................................................................................... 10
2.1 Historischer Abriss .......................................................................................................... 10
2.2 Gründe für die Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin ...................................... 13
2.2.1 Unfruchtbarkeit ....................................................................................................... 13
2.2.2 Das Alter .................................................................................................................. 16
2.3 Veränderte Lebensformen ............................................................................................. 17
3. Der Reproduktionstourismus in den USA ..................................................................... 18
3.1 Insemination ................................................................................................................... 18
3.1.1 Ablauf ...................................................................................................................... 19
3.1.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 22
3.1.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 24
3.2 In-vitro-Fertilisation........................................................................................................ 24
3.2.1 Ablauf ...................................................................................................................... 25
3.2.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 27
3.2.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 31
3.3 Eizellen- und Samenspende ........................................................................................... 33
3.3.1 Ablauf ...................................................................................................................... 34
3.3.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 36
3.3.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 40
VInhaltsverzeichnis
3.4 Kryokonservierung ......................................................................................................... 43
3.4.1 Ablauf ...................................................................................................................... 44
3.4.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 46
3.4.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 48
3.5 Präimplantationsdiagnostik ........................................................................................... 51
3.5.1 Ablauf ...................................................................................................................... 52
3.5.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 53
3.5.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 55
3.5.3.1 Retterbabys ...................................................................................................... 57
3.5.3.2 Designerbabys .................................................................................................. 59
3.6 Leihmutterschaft ............................................................................................................ 60
3.6.1 Ablauf ...................................................................................................................... 61
3.6.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA .................................................... 64
3.6.3 Ethische Betrachtung .............................................................................................. 67
3.6.3.1 Leihmutterschaft als Geschäft ......................................................................... 69
3.6.3.2 Leihmutterschaft in den USA ........................................................................... 71
3.7 Reproduktionstourismus ................................................................................................ 73
4. Der Reproduktionstourismus außerhalb der USA ......................................................... 75
4.1 Ukraine ........................................................................................................................... 75
4.2 Indien .............................................................................................................................. 80
5. Zusammenschau und Schlussfolgerungen .................................................................... 83
6. Verzeichnis der Arbeitsgrundlagen .............................................................................. 88
6.1 Literatur .......................................................................................................................... 88
6.2 Onlinequellen ................................................................................................................. 90
7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ........................................................................... 94
7.1 Abbildungsverzeichnis .................................................................................................... 94
7.2 Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ 94
VI1. Einleitung
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Reproduktionsmedizin boomt! Dieser Bereich der Medizin hat sich in den letzten
Jahrzehnten rasant weiterentwickelt und wird immer populärer. Es geht nicht mehr nur darum
Paaren zu helfen, die auf natürlichem Weg trotz Bemühungen keine Kinder bekommen
können. Es geht viel weiter und oft stellt sich dann die Frage, ob ein Kind um jeden Preis
gerechtfertigt ist oder auch ob es zu rechtfertigen ist zur möglichen Lösung der
Fruchtbarkeitsprobleme ins Ausland zu reisen. Diese Art von Gesundheitstourismus kommt
weltweit immer häufiger vor, denn vor allem Menschen aus Ländern, in denen die
Reproduktionsmedizin gesetzlich streng geregelt ist, nehmen dies in Anspruch. Diese
Masterarbeit zeigt nicht nur Methoden der Reproduktionsmedizin auf, sondern auch was man
unter Reproduktionstourismus versteht und was die USA im Zusammenhang damit besonders
macht.
In erster Linie sollen im Verlauf der Masterarbeit die angeführten Forschungsfragen
beantwortet werden. Aufgrund der vorangehenden Überlegungen und nicht zuletzt aus
persönlichem Interesse haben sich folgende vier Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit
ergeben:
Welche Verfahren der Reproduktionsmedizin sind für den
Reproduktionstourismus in den USA von Bedeutung?
Was macht den Reproduktionstourismus in den USA so besonders?
Welche anderen Möglichkeiten außerhalb der USA haben Paare, um ihren
Kinderwunsch zu erfüllen?
Welche ethischen Fragestellungen treten im Zusammenhang mit dem
Reproduktionstourismus auf?
71. Einleitung
Das Thema der vorliegenden Masterarbeit lautet „Reproduktionsmedizin in den USA – Ein
touristischer Zweig?“. Die Arbeit ist in fünf größere Kapitel gegliedert: Das erste Kapitel
beinhaltet die Einleitung mit Ausführungen über die Problemstellung und Zielsetzung sowie
Informationen über die Methodik und die Arbeitsgrundlagen, die für diese Arbeit von
Bedeutung waren.
Das zweite Kapitel wird mit einem kurzen historischen Abriss der Reproduktionsmedizin
eingeleitet. Weiters wird auf die Gründe für eine Inanspruchnahme der Techniken der
Reproduktionsmedizin und die veränderten Lebensformen eingegangen.
Das dritte Kapitel zeigt wichtige Verfahren der Reproduktionsmedizin auf und beschäftigt sich
mit den Abläufen der verschiedenen Techniken sowie mit rechtlichen Aspekten, besonderes
Augenmerk dabei wurde auf die USA und Österreich gelegt. Des Weiteren werden ethische
Sichtweisen der Reproduktionsmedizin und des Reproduktionstourismus betrachtet. Auch
hier wird vor allem auf die USA eingegangen, da das Land besonders liberal in der
Reproduktionsmedizin ist und hier dadurch erst ein Reproduktionstourismus entstehen
konnte. In diesem Kapitel wird auf folgende Verfahren eingegangen: Insemination, In-vitro-
Fertilisation, Eizellen- und Samenspende, Kryokonservierung, Präimplantationsdiagnostik und
Leihmutterschaft.
Im vierten Kapitel werden die Ukraine und Indien genauer betrachtet, da dies Länder sind, die
ebenfalls durch den Reproduktionstourismus verdienen oder verdient haben. Im letzten
Kapitel werden die zuvor erwähnten Forschungsfragen anhand der gewonnenen Erkenntnisse
beantwortet.
1.2 Arbeitsgrundlagen und Methodik
Die Masterarbeit basiert zum einen auf einer umfangreichen Literaturrecherche und zum
anderen auf der Sichtung relevanter Internetquellen. Die Internetquellen sind besonders für
aktuelle Bezüge von Bedeutung, da sich im Bereich der Reproduktionsmedizin rasch etwas
ändern kann und diese Arbeit weitgehend aktuelle Daten liefern soll. Des Weiteren wurden
Presse-Artikel, vor allem in digitaler Form, zur Erarbeitung der Themen herangezogen.
81. Einleitung
Für das zweite Kapitel sind folgende Publikationen bedeutend: „Historischer Abriss zur
Reproduktionsmedizin“ von Michael LUDWIG und Klaus DIEDRICH (2018), „Sterilität und
Infertilität“ von Askan SCHULTZE-MOSGAU (2007), die Ausführungen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) über Infertilität sowie „Kinderwunsch ohne Grenzen?
Globalisierte Fortpflanzungsmedizin und neue Formen der Elternschaft“ von Elisabeth BECK-
GERNSHEIM (2013).
Für das dritte Kapitel, das den Reproduktionstourismus in den USA näher betrachtet, dient
das Werk „Reproduktionsmedizin“ von Klaus DIEDRICH et. al. (2018) als grundlegendes Werk,
aus dem einige Artikel für die Arbeit wichtig sind. Des Weiteren ist für die gesetzliche
Grundlage in Österreich das Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) bedeutend und ebenfalls
wichtig sind Presseartikel zu den aktuellen Gegebenheiten.
Für Kapitel vier sind die Publikation „Kinder machen - Neue Reproduktionstechnologien und
die Ordnung der Familie - Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung“ von Andreas
BERNARD (2014) sowie aktuelle Berichte zu Veränderungen der Leihmutterschaft in der
Ukraine und Indien von Bedeutung.
92. Die Reproduktionsmedizin
2. Die Reproduktionsmedizin
Die Reproduktionsmedizin oder auch Fortpflanzungsmedizin ist ein Teil der Humanmedizin,
der sich auf die Diagnose und Behandlung von Unfruchtbarkeit und ungewollte Kinderlosigkeit
konzentriert (vgl. Tinneberg/Michelmann/Naether 2007). Sie ist ein interdisziplinäres
Fachgebiet, das nicht nur Teildisziplinen der Medizin beschäftigt wie die Andrologie, die
Urologie und die Gynäkologie, sondern auch die Genetik, die Rechtsmedizin, das Medizinrecht
und die Bioethik (vgl. Tinneberg/Michelmann/Naether 2007).
Dieses Kapitel dient als Einstieg in das Thema und zeigt zu Beginn die historischen
Meilensteine der Reproduktionsmedizin auf. Des Weiteren werden Gründe für die
Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin erläutert, wobei die Unfruchtbarkeit und die
Bedeutung des Alters bei der Fortpflanzung erläutert werden. Den Abschluss des Kapitels
bilden die Lebensformen, die sich im Laufe der Jahre sehr verändert haben und wodurch sich
auch das Klientel der Reproduktionsmedizin verändert hat.
2.1 Historischer Abriss
Die Fortpflanzung ist schon immer ein wichtiges Thema gewesen, deswegen finden sich auch
schon in der Bibel Hinweise auf die Reproduktionsmedizin. Im Alten Testament kann man die
Geschichte von Abraham und Sarah lesen: Sarah konnte nicht schwanger werden, weswegen
sie die Magd Hagar ihrem Mann zur Seite gab, wodurch Ismail entstand (vgl. SpringerMedizin
2020). Jedoch wurde Sarah dann auch schwanger und sie bekam Isaak (vgl. SpringerMedizin
2020). Auch Isaak und seine Frau Rebecca hatten Schwierigkeiten Kinder zu bekommen und
erst nachdem er um Nachwuchs gebeten hatte, machte Gott dies möglich, woraufhin die
Zwillinge Esau und Jakob geboren wurden (vgl. SpringerMedizin 2020). Jakob hatte zwei
Frauen und da er eine mehr liebte als die andere, hatte auch er Schwierigkeiten Nachwuchs
zu zeugen (vgl. SpringerMedizin 2020). Erst als eine der Frauen mehrere Kinder bekam, gab
Gott der anderen Beziehung die Fertilität zurück (vgl. SpringerMedizin 2020).
102. Die Reproduktionsmedizin
Man kann also erkennen, dass der unerfüllte Kinderwunsch kein modernes Phänomen ist,
sondern auch schon vor Jahrhunderten ein Problem darstellte. Die Kinderlosigkeit wurde
damals aber als Strafe Gottes gesehen und nicht als medizinisches Problem. Die Frauen gaben
ihrem Partner damals häufig eine andere Frau an die Seite, um dann selbst Mutter werden zu
können, was man heute mit einer Kombination aus Eizellenspende und Leihmutterschaft
vergleichen kann (vgl. SpringerMedizin 2020).
Bereits 1770 soll John Hunter eine Patientin wegen einer Hypospadie des Ehemannes, einer
Fehlbildung des Urogenitalsystems, erfolgreich intravaginal inseminiert haben (vgl.
Ludwig/Diedrich 2018). 1928 behandelte der Franzose Girault zehn Frauen mit langer Zervix
und engem Ostium durch eine homologe intrauterine Insemination, wodurch acht von ihnen
schwanger geworden sein sollen (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Im Jahr 1884 wurde die erste
donogene Insemination erfolgreich durchgeführt (vgl. Ludwig/Diedrich 2018).
Die Methoden der Reproduktionsmedizin entstanden aber nicht über Nacht. So war es von
Bedeutung, dass die Physiologie verstanden wird: zu Beginn die Physiologie der
endokrinologischen Zusammenhänge, dann die Physiologie der Gametenbildung, der
Fertilisation und frühembryonalen Entwicklung (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Es ging darum die
Funktionen der bekannten Organe und Zellen zu verstehen.
Ein wichtiger Meilenstein der Reproduktionsmedizin ist die In-vitro-Fertilisation (IVF). Erstmals
von der In-vitro-Fertilisation hörte man 1932, als das Buch „Brave New World“ von Aldous
Huxley erschien, in welchem er die IVF beschrieb (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Es ging ihm
dabei um die sogenannte Exogenese, die eine komplette extrakorporale Entwicklung eines
Menschen vorsah und nicht wie heute den Embryotransfer (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Im
New England Journal of Medicine erschien 1937 ein Editorial, in dem es um die erfolgreiche
Übertragung von Gameten und deren Fusion bei Kaninchen ging, aber es ging noch nicht um
In-vitro-Fertilisation:
112. Die Reproduktionsmedizin
„Conception in a watchglass! The „Brave New World“ of Aldous Huxley may be
nearer realization. Pincus and Enzmann have started one step earlier with the
rabbit, isolating an ovum, fertilizing it in a watchglass and reimplanting it in a doe
other than the one which furnished the oocyte and have thus successfully
inaugurated pregnancy in the unmated animal. If such an accomplishment with
rabbits were to be duplicated in the human being, we should in the words of
„flaming youth“ be „going places“.“ (Editorial 1937)
Als ein weiterer Meilenstein in der Behandlung von unfruchtbaren Paaren gilt das Jahr 1978,
als das erste Kind nach einer In-vitro-Fertilisation geboren wurde (vgl. Kummer 2017). Dafür
verantwortlich war der britische Physiologe Robert Edwards, der bereits in den 1950er-Jahren
an dieser Methode zu arbeiten begann, aber erst 1969 gemeinsam mit dem Gynäkologen
Patrick Steptoe gelang ihm die erste Befruchtung einer menschlichen Eizelle im Reagenzglas
(vgl. Kummer 2017). In den Jahren darauf wurden erstmals Embryonen in ihre Mütter
transferiert, was aber erfolglos blieb (vgl. Kummer 2017).
1977 wurde dann die erste Frau durch künstliche Befruchtung erfolgreich schwanger und das
erste Retortenbaby Louise Brown kam am 25. Juli 1978 per Kaiserschnitt zur Welt (vgl.
Kummer 2017). Dies war eine Sensation, da zum ersten Mal ein Kind außerhalb des
Mutterleibes gezeugt worden war. Dies stieß nicht überall auf Begeisterung, denn der
britische Ärzteverband nannte es zum Beispiel gewissenlose Forschung und die Diskussion
darüber, ob es ein Fortschritt war oder verboten gehörte, wurde entfacht (vgl. Beck-
Gernsheim 2013). Robert Edwards, Pionier der In-vitro-Fertilisation, erhielt im Dezember 2010
den Nobelpreis für Medizin, denn ohne seine Arbeit wären die Entwicklungen in der
Reproduktionsmedizin möglicherweise ganz anders verlaufen (vgl. Beck-Gernsheim 2013).
Auch die Präimplantationsdiagnostik (PID), die Diagnostiken an befruchteten Eizellen und
Embryonen, die vor der Implantation des Embryos in die Gebärmutter durchgeführt wird,
wurde von Robert Edwards geprägt, der diese Technik bereits voraussagte (vgl.
Montag/Toth/Strowitzki 2019). Im Jahr 1990 wurde das erste Baby geboren, bei dem durch
die Präimplantationsdiagnostik das Geschlecht festgestellt wurde (vgl.
Montag/Toth/Strowitzki 2019).
122. Die Reproduktionsmedizin
Nach der Etablierung der IVF als Therapie gab es schnell auch weitere Ansätze (vgl.
Ludwig/Diedrich 2018). In den 1980er-Jahren wurden die Eizellen- und Embryonenspende in
die Praxis umgesetzt und es wurden auch Verfahren zur Optimierung der Fertilisation bei
eingeschränkter männlicher Fertilität entwickelt, wobei die Intrazytoplasmatische
Spermieninjektion (ICSI) von großer Bedeutung ist, die zufällig von Gianpierro Palermo in
Belgien entdeckt wurde (vgl. Ludwig/Diedrich 2018).
Des Weiteren wurde in den 1980er-Jahren die Technik zur Kryokonservierung von Eizellen und
Embryonen entwickelt (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Die erste Schwangerschaft nach Transfer
eines kryokonservierten menschlichen Embryos verlief nicht erfolgreich, jedoch wurden kurz
darauf erfolgreiche Geburten durch die Methode durchgeführt (vgl. Ludwig/Diedrich 2018).
Auch in den folgenden Jahren wurde viel geforscht und man fokussierte sich dabei auf die
Optimierung von Standards und auf die Entwicklung neuer Techniken (vgl. Ludwig/Diedrich
2018). Dazu zählt auch „assisted hatching“, wobei dem Embryo das Verlassen der Eihülle und
die Einnistung in die Gebärmutter erleichtert werden soll, sowie die Anwendung des
Polarisationsmikroskops zur Beurteilung der Eihülle, der sogenannten „zona pellucida“, (vgl.
Ludwig/Diedrich 2018). Dabei haben nicht alle Verfahren den nötigen Erfolg gebracht,
weshalb einige in der Pilotphase oder Einzelfallbeobachtung blieben (vgl. Ludwig/Diedrich
2018). Des Weiteren lag der Fokus auf der Reduzierung des Mehrlingsrisikos und des Risikos
eines ovariellen Überstimulationssyndroms (OHSS), wobei einige Länder den elektiven
Einzelembryotransfer als Lösung fanden (vgl. Ludwig/Diedrich 2018). Weiters wurde auch die
In-vitro-Fertilisation vereinfacht, denn die Laparoskopie wurde von der transvaginalen
ultraschallgesteuerten Punktion abgelöst (vgl. Ludwig/Diedrich 2018).
2.2 Gründe für die Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin
2.2.1 Unfruchtbarkeit
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2020) hat ungewollte Kinderlosigkeit als Krankheit
definiert. Laut Definition der WHO (2020) spricht man von einem unerfüllten Kinderwunsch,
wenn trotz regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr nach einem Jahr noch keine
Schwangerschaft eingetreten ist.
132. Die Reproduktionsmedizin
Unfruchtbarkeit ist oft eine schwere Last für Paare, die sich Kinder wünschen. Die Gründe für
eine Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin sind vielfältig. Die Unfruchtbarkeit ist oft
eines der Probleme, wobei man zwischen Sterilität und Infertilität unterscheiden kann.
Bei der Sterilität tritt auch nach zwei Jahren regelmäßigem, ungeschütztem
Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft ein (vgl. Schultze-Mosgau 2007). Des Weiteren
kann primäre und sekundäre Sterilität unterschieden werden: Bei der primären Sterilität fand
nie eine Befruchtung statt, bei der sekundären Sterilität hingegen gab es bereits eine
Schwangerschaft, aus der ein Kind hervorgegangen ist oder die zu einem Abort geführt hat
(vgl. Schultze-Mosgau 2007).
Bei der Infertilität wird die Frau schwanger, jedoch wird kein lebendes Kind geboren (vgl.
Schultze-Mosgau 2007). Häufig werden die Begriffe Sterilität und Infertilität auch synonym
verwendet (vgl. Schultze-Mosgau 2007).
Laut WHO (2020) haben weltweit ungefähr 15 Prozent der Paare im gebärfähigen Alter mit
Unfruchtbarkeit zu kämpfen. Die Ursachen dafür hängen oft zusammen. Folgen von Konflikten
in der Beziehung oder im Beruf, die Stress bedeuten, können zur Unfruchtbarkeit beitragen.
Häufig sind der Druck Kinder zu bekommen oder andere seelische Leiden ein Grund dafür,
warum der Babywunsch nicht in Erfüllung geht und erst wenn der Druck nicht mehr da ist und
man sich eventuell schon für eine andere Option entschieden hat, funktioniert es auf einmal.
Unfruchtbarkeit kann also durch viele verschiedene Faktoren entstehen, die bei der Frau, dem
Mann oder bei beiden liegen können, aber oft ist es auch schwer erklärbar woran es liegt (vgl.
WHO 2020). Im Folgenden werden Ursachen für die Unfruchtbarkeit bei Frau und Mann
aufgezählt. Die Häufigkeit dieser Ursachen unterscheidet sich jedoch von Land zu Land (vgl.
WHO 2020).
Im weiblichen Fortpflanzungssystem kann die Unfruchtbarkeit laut WHO (2020) verursacht
werden durch:
142. Die Reproduktionsmedizin
Eileiterstörungen wie zum Beispiel blockierte Eileiter, die wiederum durch
unbehandelte sexuell übertragbare Infektionen oder Komplikationen eines
unsicheren Schwangerschaftsabbruchs, einer postpartalen Sepsis oder einer
Bauchoperation verursacht werden.
Gebärmutterkrankheiten, die entzündlicher Natur sein können wie zum Beispiel
Endometriose, angeborener Natur wie Gebärmutterseptat oder gutartiger Natur
wie zum Beispiel Myome.
Erkrankungen der Eierstöcke wie das polyzystische Ovarialsyndrom und andere
Follikelerkrankungen.
Störungen des endokrinen Systems, die ein Ungleichgewicht der
Fortpflanzungshormone verursachen. Zum endokrinen System gehören der
Hypothalamus und die Hypophyse. Ein Beispiel für häufige Störungen, die dieses
System betreffen, ist der Hypophysenkrebs.
Im männlichen Fortpflanzungssystem kann sie laut WHO (2020) verursacht werden durch:
Eine Obstruktion der Fortpflanzungswege, die zu Funktionsstörungen beim
Samenerguss führt. Diese Blockade kann in den Eileitern, die den Samen
befördern, auftreten. Blockaden sind oft auf Verletzungen oder Infektionen des
Genitaltrakts zurückzuführen.
Hormonstörungen, die zu Anomalien bei den von Hypophyse, Hypothalamus und
Hoden produzierten Hormonen führen. Beispiele für Störungen, die zu einem
hormonellen Ungleichgewicht führen, sind Hypophysen- oder Hodenkrebs.
Störung der Spermienproduktion im Hoden zum Beispiel aufgrund von
Krampfadern oder medizinischen Behandlungen, die die Spermien
produzierenden Zellen beeinträchtigen, wie dies bei der Chemotherapie der Fall
ist.
Abnorme Spermienfunktion und -qualität. Zustände oder Situationen, die eine
abnorme Form (Morphologie) und Bewegung (Motilität) der Spermien
verursachen, wirken sich negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Die Verwendung von
anabolen Steroiden kann zum Beispiel zu abnormalen Spermienparametern wie
Spermienzahl und -form führen.
152. Die Reproduktionsmedizin
Die Ursachen für Unfruchtbarkeit liegen laut Schultze-Mosgau (2007) zu 45 Prozent bei der
Frau, zu 40 Prozent bei dem Mann, zu 35 Prozent bei beiden Partnern und zu 15 Prozent
bleiben die Ursachen ungeklärt.
2.2.2 Das Alter
Auch das Alter ist ein wichtiger Faktor bei der Fortpflanzung. Die Fertilität der Frau nimmt mit
dem Alter ab, beim Mann ist dieser Zusammenhang nicht sicher geklärt (vgl. Schultze-Mosgau
2007). Auch die folgende Abbildung zeigt, dass die Fertilität mit dem Alter der Frau abnimmt.
Abbildung 1: Altersabhängigkeit der Fertilität in einer Population ohne
Empfängnisverhütung
Arbeitsgrundlage: Schultze-Mosgau 2007.
Das Alter der Erstgebärenden hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, denn die Frauen
heute sind beim ersten Kind im Schnitt älter als sie es früher waren. 1985 waren
österreichische Frauen bei der Geburt des ersten Kindes durchschnittlich 24 Jahre alt, 2013
lag das Alter bereits bei 29 Jahren (vgl. Kummer 2017). Prognosen der Statistik Austria deuten
an, dass bis 2030 die Frau bei der ersten Geburt im Schnitt 31 Jahre alt sein wird, was ein Trend
ist, der auch in anderen Industriestaaten zu beobachten ist (vgl. Kummer 2017). Dazu steigt
der Anteil der Frauen, die assistierte reproduktionsmedizinische Verfahren anwenden, in
dieser Altersgruppe an (vgl. Kummer 2017).
162. Die Reproduktionsmedizin
2.3 Veränderte Lebensformen
In den 1950er und 1960er Jahren gab es die klassische Familienstruktur: die Familie bestand
aus einem erwachsenen Paar mit Kindern, wobei die Erwachsenen verschiedenen Geschlechts
waren (vgl. Beck-Gernsheim 2013). Frau und Mann hatten auch ihre zugeteilten Aufgaben: Die
Frau war für den Haushalt und die Kinder zuständig und der Mann ging arbeiten (vgl. Beck-
Gernsheim 2013). Der normale Rhythmus der Familiengründung war folgender: „Love,
marriage, baby carriage“ (Beck-Gernsheim 2013).
Früher waren Mann und Frau verheiratet, bekamen Kinder und blieben bis an ihr Lebensende
zusammen. Heute gibt es andere Trends, denn viele Paare heiraten nicht mehr und wenn
geheiratet wird kommt es häufig wieder zur Scheidung. Die Partnerschaft von schwulen und
lesbischen Paaren hat sich auch verändert, denn wurden sie früher noch kriminalisiert und
verfolgt, hat sich dies in vielen Ländern gewandelt (vgl. Beck-Gernsheim 2013). Sie dürfen nun
ihre Partnerschaft offiziell registrieren lassen und in einigen Ländern auch heiraten (vgl. Beck-
Gernsheim 2013).
Die Ehe hing früher auch stark mit der Elternschaft zusammen, denn wenn ein Kind außerhalb
der Ehe gezeugt wurde, wurde es als Bastard bezeichnet, was eine Katastrophe im Leben einer
Frau darstellte (vgl. Beck-Gernsheim 2013). Auch dies hat sich verändert, da viele Kinder nicht
verheiratete Eltern haben und dies meist selbstverständlich ist und kein Unterschied zu
anderen Kindern gemacht wird.
Durch die Pluralisierung der Lebensformen hat sich auch die Gruppe der Menschen erweitert,
die Techniken der Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen. Viele Menschen, die zuvor
keine Chance mehr auf Kinder hatten, können nun durch diese Techniken ein Kind bekommen
wie zum Beispiel schwule und lesbische Paare; Singles; Frauen, die schon über 50 Jahre alt
sind; oder auch Frauen, deren Partner bereits verstorben sind (vgl. Beck-Gernsheim 2013). Die
Reproduktionsmedizin macht für diese Personen viel möglich, wobei sich auch immer die
Frage stellt, wie weit dies ethisch vertretbar ist.
173. Der Reproduktionstourismus in den USA
3. Der Reproduktionstourismus in den USA
Unter Reproduktionstouristen sind Personen zu verstehen, die wegen einer
Kinderwunschbehandlung ins Ausland reisen. Der Reproduktionstourismus ist eine Art des
Medizintourismus und kommt immer häufiger vor, vor allem bei Paaren aus Ländern in denen
es strenge gesetzliche Regelungen bezüglich Techniken der Reproduktionsmedizin gibt.
Im Folgenden werden sechs Methoden der Reproduktionsmedizin vorgestellt. Dies sind bei
weitem nicht alle, jedoch sind es die, die häufig verwendet werden und am Bedeutendsten
für den Reproduktionstourismus sind. Dabei ist jedes Kapitel gleich aufgebaut und beginnt mit
einer kurzen Übersicht über die vorgestellte Methode. Weiter geht es mit dem Ablauf,
daraufhin folgen die rechtlichen Grundlagen in Österreich und den USA und zum Abschluss
wird das Verfahren ethisch betrachtet.
Die sechs ausgewählten Methoden sind die Insemination, die In-vitro-Fertilisation, die
Eizellen- und Samenspende, die Kryokonservierung, die Präimplantationsdiagnostik und die
Leihmutterschaft. Zum Abschluss des Kapitels wird noch allgemein auf den
Reproduktionstourismus eingegangen.
3.1 Insemination
Die Insemination ist eine Technik der Reproduktionsmedizin, die bei
Kinderwunschbehandlungen sehr verbreitet ist (vgl. Dorn 2018). Man kann je nach Herkunft
zwei Arten der Insemination unterscheiden:
1. Die homologe Insemination, die auch „artificial insemination by husband“ genannt
wird, dabei wird der Samen des Ehemannes verwendet (vgl. Dorn 2018).
2. Die donogene oder heterologe Insemination, die auch als „artificial insemination
by donor“ bezeichnet wird, dabei wird der Samen eines anonymen Spenders
verwendet (vgl. Dorn 2018).
183. Der Reproduktionstourismus in den USA
Die Insemination kann intrazervikal oder intrauterin erfolgen, jedoch hat heute vor allem die
intrauterine Insemination einen hohen medizinischen Stellenwert (vgl. Dorn 2018). Diese
Technik wurde in den letzten Jahren auch immer weiter verbessert.
Die Insemination ist eine Technik der Reproduktionsmedizin, die große Anwendung findet. Im
folgenden Kapitel werden der Ablauf der Technik und die rechtlichen Voraussetzungen in
Österreich und den USA erläutert sowie die Methode ethisch betrachtet.
3.1.1 Ablauf
Die Inseminationsbehandlung beginnt mit der Gewinnung der Spermien. Dabei ist es nicht von
Bedeutung, ob diese zu Hause oder in der Praxis stattfindet, wichtig ist nur, dass der Beginn
der Insemination spätestens 90 Minuten nach der Abgabe der Spermien erfolgt (vgl. Dorn
2018). In einem weiteren Schritt müssen die Spermien aufbereitet werden, wobei es
verschiedene Techniken gibt (vgl. Dorn 2018). Dazu zählen laut Dorn (2018) die Wasch- und
Zentrifugationsschritte, die Dichtegradientzentrifugation oder Glaswollfiltration und die
Swim-up-Präparation.
Dem Ejakulat werden bei der Spermienwaschung ungefähr 3 ml Kulturmedium hinzugefügt
mit anschließender Zentrifugation bei ungefähr 500 g, im weiteren Schritt wird der Überstand
vom Pellet getrennt, woraufhin der zweite Waschgang erfolgt oder das Pellet direkt durch
frisches Medium resuspendiert wird (vgl. Dorn 2018). Diese Schritte werden auch in der
folgenden Abbildung dargestellt.
Abbildung 2: Wasch- und Zentrifugationsschritte
Arbeitsgrundlage: Dorn 2018.
193. Der Reproduktionstourismus in den USA
Bei der Dichtegradientzentrifugation werden durch verschiedene Gewichte defekte oder
intakte Zellen in Subpopulationen geteilt (vgl. Dorn 2018). Die Proben werden vor Gebrauch
auf 37 Grad erwärmt und danach werden zum Beispiel 2,5 ml in Zentrifugenröhren pipetiert
und unterschichtet (vgl. Dorn 2018). Auf die Flüssigkeitssäule werden 1 bis 3 ml verflüssigtes
Sperma aufgebracht und zentrifugiert, woraufhin der Überstand abgesaugt und das Pellet
resuspendiert wird (vgl. Dorn 2018). Danach wird noch einmal zentrifugiert und der
Arbeitsschritt wiederholt, um einen besseren Reinigungseffekt zu erzielen (vgl. Dorn 2018).
Zum Schluss wird das Pellet mit der gewünschten Verwendungsmenge resuspendiert (vgl.
Dorn 2018).
Die Ejakulationsprobe wird bei der Swim-up-Präparation nach Verflüssigung in ein
Reagenzglas gegeben und mit Kulturmedium überschichtet und danach bei 37 Grad maximal
60 Minuten inkubiert (vgl. Dorn 2018). Durch die Eigenbeweglichkeit der Zellen werden die
Spermien dann unterschieden und der Medienüberstand wird abgehoben (vgl. Dorn 2018).
Die Schritte der Methode sind in der Abbildung zu sehen.
Abbildung 3: Swim-up-Präparation
Arbeitsgrundlage: Dorn 2018.
203. Der Reproduktionstourismus in den USA
Bei den beschriebenen Methoden kann man nicht sicher sagen, welche eine bessere
Erfolgsrate hat (vgl. Dorn 2018). Der nächste Schritt ist dann das Einbringen der
Spermiensuspension, die in den Zervikalkanal, in die Gebärmutterhöhle oder in die Eileiter
gebracht werden kann (vgl. Dorn 2018). Am häufigsten dabei ist laut Dorn (2018) das
Einbringen von 0,2 bis 0,5 ml der aufbereiteten Spermien intrauterin. Dies ist auch in der
folgenden Abbildung zu sehen.
Abbildung 4: Intrauterine Insemination (IUI)
Arbeitsgrundlage: Dorn 2018.
Nach dem Einbringen der Spermiensuspension gibt es eine Ruhephase von zehn Minuten, die
die Schwangerschaftsrate laut Dorn (2018) erhöhen kann, was aber nicht eindeutig erwiesen
ist. Die Komplikationen bei der Intrauterinen Insemination (IUI) sind laut Dorn (2018) sehr
gering, denn die Infektionsrate nach dem Eingriff wurde mit 1,83 Fällen auf 1.000 Frauen
angegeben.
Der Erfolg der Insemination hängt laut Dorn (2018) von folgenden Faktoren ab:
Die Spermien müssen adäquat aufbereitet werden.
Die Spermien werden durch die Technik nahe zur Eizelle gebracht.
Der richtige Zeitpunkt, kurz vor der Ovulation, muss gewählt werden.
213. Der Reproduktionstourismus in den USA
Weiters Einfluss auf den Erfolg bei einer Insemination haben laut Dorn (2018) folgende
Faktoren: das Alter der Frau, die Dauer des Kinderwunsches, das Spermiogramm und der
tubare Faktor.
Pro Inseminationszyklus liegt die Schwangerschaftsrate bei 12 bis 15 Prozent und die
Geburtenrate liegt in einer Untersuchung von 893 Paaren nach 2,8 Inseminationszyklen bei
27,2 Prozent (vgl. Dorn 2018).
3.1.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA
Im österreichischen Fortpflanzungsmedizingesetz ist die Insemination erlaubt und unter
Paragraph 1 steht Folgendes zur Insemination:
„(2) Methoden der medizinisch unterstützten Fortpflanzung im Sinn des Abs. 1
sind insbesondere
1. das Einbringen von Samen in die Geschlechtsorgane einer Frau,
2. die Vereinigung von Eizellen mit Samenzellen außerhalb des Körpers einer Frau,
3. das Einbringen von entwicklungsfähigen Zellen in die Gebärmutter oder den
Eileiter einer Frau und
4. das Einbringen von Eizellen oder von Eizellen mit Samen in die Gebärmutter
oder den Eileiter einer Frau.“ (RIS 2020 a)
Die Durchführung einer Insemination in Österreich ist in einer zugelassenen Krankenanstalt
vorzunehmen oder wenn der Samen des Ehemannes oder des Lebensgefährten verwendet
wird, besteht nach Paragraph 1 Absatz 2 die Möglichkeit die Insemination in einer Ordination
eines Facharztes oder einer Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe durchführen zu
lassen (vgl. Urdl 2019).
Wenn nicht der Samen des Partners verwendet wird, müssen laut Urdl (2019) folgende
Voraussetzungen erfüllt werden:
223. Der Reproduktionstourismus in den USA
1. Das Alter und der Gesundheitszustand des Spenders sind zu erheben und es darf
kein Gesundheitsrisiko für ihn oder andere geben.
2. Die Serum- oder Plasmaproben des Spenders müssen negativ auf HIV 1 und 2,
HCV, HBV und Syphilis reagieren und die Urinprobe muss auf Chlamydien negativ
reagieren.
3. Abhängig vom Gebiet, in dem der Spender und seine Familie leben, muss ein
HTLV-I-Antikörpertest gemacht werden.
Die rechtliche Situation, was die Reproduktionsmedizin betrifft, ist in den USA sehr komplex.
Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Gesetze oder gar keine Regulierung, was dazu führt, dass
häufig von Fall zu Fall entschieden wird (vgl. Coparents 2020). Die Spermaspende ist von der
Food and Drug Administration (FDA) festgelegt, jedoch wird nicht alles genau geregelt,
darunter auch wie man mit der Anonymität des Spenders umgeht (vgl. Coparents 2020).
Meistens sind die Spermaspender anonym, wenn sie jedoch bekannt sind, machen viele
Kliniken es möglich, dass das Kind mit 18 Jahren erfährt, wer der Spender ist (vgl. Coparents
2020).
In den USA sind Spermaspenden häufig durch das Geld motiviert, denn Spender bekommen
für ihren Aufwand eine Entschädigung, die aber nicht zu hoch ausfallen sollte, da sonst die
einzige Motivation hinter der Spende das Geld sein könnte, was nicht der Fall sein darf (vgl.
Coparents 2020). Auch diese Vergütung ist nicht im amerikanischen Gesetz geregelt und kann
somit von den Kliniken selbst festgelegt werden (vgl. Coparents 2020). Die
Aufwandsentschädigungen für eine Spermaspende liegen laut Coparents (2020) zwischen 50
und 200 US-Dollar pro Spende.
Die Selbstinsemination ist in den USA nicht vom Gesetz geregelt, außer im Bundesstaat
Kalifornien, wo 2016 ein dahingehendes Gesetz verabschiedet wurde (vgl. Coparents 2020).
Dadurch sollen Familien besser geschützt werden, denn wenn man die Insemination zu Hause
durchführt und nicht von einem Spezialisten durchführen lässt, kann dies zu Komplikationen
führen. Deswegen wird den zukünftigen Eltern in den USA geraten sich vor der Behandlung
rechtlich beraten zu lassen (vgl. Coparents 2020).
233. Der Reproduktionstourismus in den USA
3.1.3 Ethische Betrachtung
Die Technik der Insemination ist medizinisch kein kompliziertes Verfahren und auch technisch
bedarf es keinen großen Anforderungen. Anders sieht dies jedoch von ethischer Sicht aus.
Ein Problem besteht darin, dass der biologische Vater des Kindes ein anderer als der soziale
sein kann (vgl. Fischer 2012). Somit hat das Kind zwei Väter, was für Verwirrungen für das Kind
sorgen kann. Die Methode wird nicht nur befürwortet, sondern auch kritisiert. Dafür spricht,
dass die Insemination eine Möglichkeit ist, um einem Paar zu helfen den Wunsch vom eigenen
Kind zu erfüllen (vgl. Fischer 2012). Dagegen spricht, dass es Gefahren für das Kind und die
Gesellschaft geben könnte, darunter fallen laut Fischer (2012):
psychologische Folgen für das gezeugte Kind;
keine klaren rechtlichen Verhältnisse zwischen dem Samenspender, den
Wunscheltern, dem medizinischen Fachpersonal und dem Kind;
eine Störung der „natürlichen“ Ordnung der Fortpflanzung.
Heutzutage ist die Insemination nicht rechtswidrig oder sittenwidrig, aber trotz des
Fortschritts in der Medizin ist die Therapieform noch immer mit Makeln belastet (vgl. Fischer
2012). Hier findet jedoch kein Reproduktionstourismus statt, denn Österreich und auch viele
andere europäische Länder erlauben die Insemination durch die Spermien des Ehegatten aber
auch eines Spenders. Deswegen können viele Paare diese Methode im Heimatland
durchführen lassen und fliegen für die Behandlung nicht in die USA oder ein anderes Land, in
dem die Methode ebenfalls erlaubt ist.
3.2 In-vitro-Fertilisation
Die In-vitro-Fertilisation (IVF) ist eine Methode der Reproduktionsmedizin, bei der außerhalb
des Körpers der Frau die Eizelle in einer Glasschale befruchtet wird und erst danach in die
Gebärmutter eingesetzt wird (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz 2020). Wie bereits im Kapitel 2.2 Historischer Abriss ausgeführt wurde,
waren Robert Edwards und Patrick Steptoe diejenigen, die diese Methode entwickelt haben.
Heutzutage ist die IVF eine Standardbehandlung bei unerfülltem Kinderwunsch.
243. Der Reproduktionstourismus in den USA
Eine spezielle Form der In-vitro-Fertilisation ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion
(ICSI). Bei der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion wird ein Spermium mit einer Pipette
unter dem Mikroskop in die Eizelle injiziert (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz 2020).
Im folgenden Kapitel werden die Abläufe der In-vitro-Fertilisation und der
Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion genauer erklärt. Des Weiteren geht es um die
rechtlichen Grundlagen der Methoden in Österreich und den USA sowie um die ethische
Betrachtung der Techniken.
3.2.1 Ablauf
Durch die Geburt des ersten Retortenbabys Louise Brown fing die intensive Forschung auf
dem Gebiet der Reproduktionsmedizin an (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Zu Beginn war es nicht
möglich Paaren zu helfen, bei denen die Samenqualität schwer beeinträchtigt war, dies
änderte sich erst durch die Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (vgl. Ebner/Diedrich
2018). Dadurch konnte man auch Paaren helfen bei denen die Samenqualität schwer
beeinträchtigt war. Die Technik der IVF ist dabei kaum verändert geworden, was im Folgenden
erläutert wird.
Zu Beginn werden durch eine Follikelpunktion die Eizellen aus dem Eierstock entnommen, die
nach ungefähr zwei bis drei Stunden im Kulturschälchen mit Spermien versetzt werden
können (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Wenn die Samenprobe des Partners vorhanden ist, muss
entschieden werden, ob eine klassische IVF-Behandlung möglich ist oder ob eine ICSI
durchgeführt wird, da die Samenqualität nicht ausreichend ist (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Die
Prüfung der Qualität der Samen geschieht durch ein Spermiogramm (vgl. Ebner/Diedrich
2018). Die Spermien werden nach WHO-Kriterien analysiert und dabei werden laut Ebner und
Diedrich (2018) die Spermienanzahl, die Beweglichkeit und Morphologie überprüft sowie mit
den Referenzwerten verglichen. Der Unterschied zwischen einer IVF und ICSI liegt darin, dass
bei der IVF das Spermium selbst in die Eizelle eindringt und den Embryo somit erzeugt und bei
der ICSI-Methode das Sperma in die Eizelle eingeführt wird (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Bei der
folgenden Abbildung ist eine Intrazytoplasmatische Spermieninjektion mit sichtbarem
Einstichtrichter zu sehen, wobei sich das Spermium noch in der Pipette befindet.
253. Der Reproduktionstourismus in den USA
Abbildung 5: Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
Arbeitsgrundlage: Ebner/Diedrich 2018.
Nach der Entnahme der Eizellen und der Analyse der Samenqualität sowie der Insemination
im Kulturschälchen wird am darauffolgenden Tag das Vorhandensein von zwei Vorkernen bzw.
zwei Polkörpern kontrolliert (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Nach drei oder fünf bis sechs Tagen,
je nach Umstand, kann der Embryotransfer stattfinden (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Wenn eine
erfolglose IVF-Behandlung bereits durchgeführt wurde, ist eine weitere nicht sinnvoll und es
sollte die ICSI bevorzugt werden (vgl. Ebner/Diedrich 2018).
Bei der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion darf der Zeitraum zwischen der
Eizellgewinnung und der Injektion sechs Stunden nicht überschreiten, da es sonst zur Alterung
der Eizellen kommen kann (vgl. Ebner/Diedrich 2018). Bei beiden Techniken ist es von großer
Bedeutung, dass ein genauer Zeitplan eingehalten wird, um die Schwangerschaftsraten zu
optimieren und somit viele gesunde Babys geboren werden können (vgl. Ebner/Diedrich
2018).
Die Zahl der Kinder, die durch künstliche Befruchtung geboren werden, nimmt immer weiter
zu, was auch daran liegt, dass der globale Markt für Reproduktionstechniken immer besser
funktioniert und dadurch auch immer mehr Geld verdient werden kann (vgl. Kummer 2017).
Die Baby-Take-Home-Rate beträgt bei der IVF zwischen 17 und 20 Prozent, jedoch gibt es
Schwankungen, da es keine standardisierte Methode gibt mit der diese Rate berechnet wird
(vgl. Kummer 2017).
263. Der Reproduktionstourismus in den USA
3.2.2 Rechtliche Regelung in Österreich und den USA
In Österreich wird die Reproduktionsmedizin durch das Fortpflanzungsmedizingesetz rechtlich
geregelt und die In-vitro-Fertilisation wird auch durch das In-vitro-Fertilisierungs-Fonds-
Gesetz (IVF-Fonds-Gesetz) geregelt (vgl. RIS 2020 a). 2015 wurde das
Fortpflanzungsmedizingesetz novelliert, was dazu führte, dass die Verwendung von
Spendersamen im Rahmen der In-vitro-Fertilisation und die Verwendung von Spermasamen
im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung gleichgeschlechtlicher weiblicher Paare erlaubt
wurde (vgl. RIS 2020 a).
Im Fortpflanzungsmedizingesetz ist unter Paragraph 1 folgendes zur IVF zu finden:
„(2) Methoden der medizinisch unterstützten Fortpflanzung im Sinn des Abs. 1
sind insbesondere
1. das Einbringen von Samen in die Geschlechtsorgane einer Frau,
2. die Vereinigung von Eizellen mit Samenzellen außerhalb des Körpers einer
Frau,
3. das Einbringen von entwicklungsfähigen Zellen in die Gebärmutter oder den
Eileiter einer Frau und
4. das Einbringen von Eizellen oder von Eizellen mit Samen in die Gebärmutter
oder den Eileiter einer Frau.“ (RIS 2020 a)
Das In-vitro-Fertilisierungs-Fonds-Gesetz gibt die Anspruchsvoraussetzungen im Paragraph 4
für eine Kostentragung wie folgt an (vgl. RIS 2020 b): Wenn die Sterilität der Frau vorliegt oder
wenn die Sterilität des Mannes besteht (vgl. RIS 2020 b).
Der Anspruch besteht nicht, wenn die Frau oder der Mann selbst die Sterilität herbeigeführt
haben zum Beispiel durch eine Sterilisation (vgl. RIS 2020 b). Der Anspruch besteht für
maximal vier Versuche pro Paar, wenn daraus ein Kind entstanden ist, hat das Paar wiederum
einen Anspruch auf Kostentragung für vier Versuche (vgl. RIS 2020 b). Voraussetzung für den
Anspruch ist das Alter des Paares, die Frau darf das 40. und der Mann das 50. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und es muss die Leistungszuständigkeit im Falle einer Krankheit
vorliegen (vgl. RIS 2020 b).
273. Der Reproduktionstourismus in den USA
Die Kosten für eine IVF- oder ICSI-Behandlung in einer öffentlichen Krankenanstalt für einen
Versuch einer IVF- oder ICSI-Behandlung werden in der folgenden Tabelle abgebildet.
Tabelle 1: Kosten für eine IVF- und ICSI-Behandlung in einer öffentlichen Krankenanstalt
IVF-Behandlung
Frauen unter 35 Jahre € 2.648,30
Frauen von 35 bis 40 Jahre € 2.826,42
ICSI-Behandlung
Frauen unter 35 Jahre € 2.939,48
Frauen von 35 bis 40 Jahre € 3.117,60
Arbeitsgrundlage: eigene Darstellung (Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz 2020).
Die Kosten für eine IVF- oder ICSI-Behandlung in einer privaten Krankenanstalt für einen
Versuch einer IVF- oder ICSI-Behandlung werden in der folgenden Tabelle abgebildet.
Tabelle 2: Kosten für eine IVF- und ICSI-Behandlung in einer privaten Krankenanstalt
IVF-Behandlung
Frauen unter 35 Jahre € 2.717,28
Frauen von 35 bis 40 Jahre € 2.899,96
ICSI-Behandlung
Frauen unter 35 Jahre € 3.008,46
Frauen von 35 bis 40 Jahre € 3.191,14
Arbeitsgrundlage: eigene Darstellung (Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz 2020).
283. Der Reproduktionstourismus in den USA
Die Kosten sind ohne Steuern angegeben und können somit entsprechend den
Steuerbestimmungen des IVF-Zentrums höher sein (vgl. Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020). Der Selbstkostenbeitrag beläuft sich auf
30 Prozent der angegebenen Kosten, da 70 Prozent von dem Fonds getragen werden.
Dass 70 Prozent der Kosten von dem Fonds getragen werden ist relativ viel, was auch daran
liegen kann, dass in Österreich weniger Kinder geboren werden als dies in anderen Ländern
der Fall ist. In Österreich lag die Fertilitätsrate, also die durchschnittliche Anzahl der
lebendgeborenen Kinder, die eine Frau im gebärfähigen Alter wahrscheinlich zur Welt bringt,
im Jahr 2019 bei 1,46 Kindern pro Frau (vgl. Statista 2020 a). Durch den Beitrag des Fonds zu
IVF-Behandlungen können sich diese mehr Paare leisten, wodurch auch mehr Kinder geboren
werden können, was helfen kann die Geburtenrate zu erhöhen. Dies führt in weiterer Folge
dazu, dass das Pensionssystem nicht zusammenbricht. Denn in Österreich gibt es das
Umlagesystem als Basis für die gesetzliche Pensionsversicherung, das darauf beruht, dass die
Pensionsversicherungsbeiträge der aktiven Erwerbstätigen für die Pensionen verwendet
werden (vgl. Felbinger 2006). Somit investiert der Staat durch den Fonds in die Zukunft, denn
so können mehr Kinder geboren werden und das Pensionssystem bleibt vorerst erhalten.
Der Markt für Reproduktionsmedizin ist auf dem Vormarsch, deswegen steigen auch die IVF-
Behandlungen an. Die IVF-Behandlungen in den USA sind von 90.000 im Jahr 2000 auf 150.000
im Jahr 2010 gestiegen (vgl. Kummer 2017). Laut Kummer (2017) liegt dies auch daran, dass
den Paaren zu früh das Verfahren geraten wird, da viele Paare nach der IVF auch natürlich ein
Kind bekommen konnten. Dies geschah bei 60 Prozent der Paare, die zuvor ein Kind durch die
In-vitro-Fertilisation bekamen (vgl. Kummer 2017). Weiters zeigte eine Studie aus dem Jahr
2016, dass 87 Prozent der Frauen, die untersucht wurden, zwei Jahre nach der Behandlung
natürlich schwanger wurden (vgl. Kummer 2017).
In den USA führten laut der Society for Assisted Reproductive Technology (Gesellschaft für
assistierte Reproduktionstechnologie) etwa 34 Prozent der im Jahr 2017 durchgeführten IVF-
Verfahren bei Frauen im Alter von 35 bis 37 Jahren zu einer Lebendgeburt (vgl. CNBC 2020).
Diese Erfolgsrate sinkt jedoch mit zunehmendem Alter der Frauen, denn die 41- bis 42-
Jährigen haben nur mehr eine Chance von zehn Prozent (vgl. CNBC 2020).
293. Der Reproduktionstourismus in den USA
Um die Chancen der Familien auf eine erfolgreiche IVF-Behandlung zu erhöhen, bieten viele
Kliniken Garantieprogramme und Preispakete an (vgl. CNBC 2020). Die Programme
unterscheiden sich geringfügig von Klinik zu Klinik, meist hinsichtlich der Geld-zurück-
Garantien für den Fall, dass die IVF nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft und Geburt
führt (vgl. CNBC 2020). Die Paare zahlen mehr für die Garantie, als sie sonst für eine
erfolgreiche IVF-Behandlung nach einem IVF-Zyklus zahlen würden (vgl. CNBC 2020).
Die IVF ist in den USA recht teuer, da die Kosten für die Behandlung für viele Frauen nicht von
der Versicherung übernommen werden (vgl. CNBC 2020). Etwa 71 Prozent der Frauen, die im
vergangenen Jahr eine IVF-Behandlung durchführten, hatten laut FertilityIQ keinen
Versicherungsschutz für eine Fruchtbarkeitsbehandlung (vgl. CNBC 2020).
Bis August 2020 haben 19 amerikanische Bundesstaaten Gesetze zur
Fruchtbarkeitsversicherung verabschiedet, 13 dieser Gesetze beinhalten IVF-Versicherungen,
und zehn Bundesstaaten haben Gesetze zum Erhalt der Fruchtbarkeit bei medizinisch
bedingter Unfruchtbarkeit (vgl. Resolve 2020). In der folgenden Tabelle sind die
Bundesstaaten mit ihren Fruchtbarkeitsversicherungsgesetzen abgebildet.
Tabelle 3: Ausgewählte Bundesstaaten der USA mit ihren
Fruchtbarkeitsversicherungsgesetzen
Arbeitsgrundlage: Resolve 2020.
30Sie können auch lesen