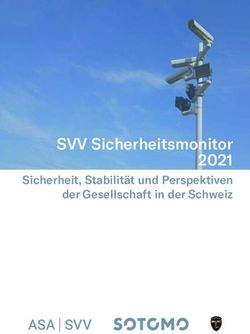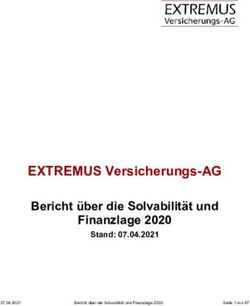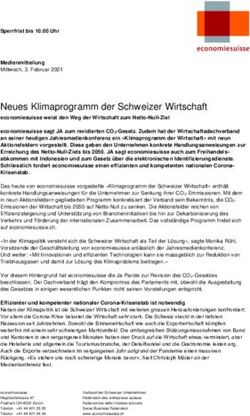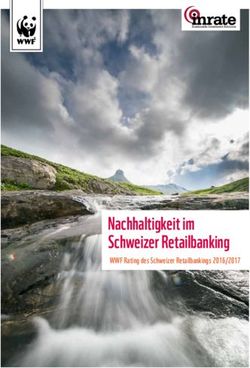Risiken der Elektrizitäts wirtschaft - Expertenmeinungen zur Energiepolitik der Schweiz - sinnovec
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
R isike n d e r S chwe izer Elektrizitätswir tschaf t Führung
Risiken der Elektrizitäts
Claudia Wohlfahrtstätter/
Roman Boutellier
wirtschaft
Expertenmeinungen zur Energiepolitik der Schweiz
Wie viele Länder Europas steht die Schweiz vor der Entscheidung, die Kapazitäten in der
Elektrizitätswirtschaft zu ersetzen und aufzubauen. Die Diskussion führt das Land zeitgleich
mit dem Beginn der Liberalisierung der Energiemärkte und unter dem Einfluss der direkten
Demokratie. Eine repräsentative Umfrage veranschaulicht, dass die größte Herausforderung
der Schweizer Elektrizitätswirtschaft die autarke Versorgungssicherheit des Landes
ist und dass die Risiken ungenügend gemanagt werden.
Einleitung energiepolitische Entscheidungspyramide, ange-
lehnt an die Bedürfnispyramide von Maslow.1
Ziel der Arbeit ist es, die Risiken und das Risikoma-
nagement der Schweizer Elektrizitätswirtschaft aus
einer gesamtwirtschaftlichen Sicht aufzuzeigen. Die Schweizer Elektrizitätswirtschaft
Die Datenbasis bilden Interviews mit 33 Entschei-
dungsträgern und Experten aus der Schweizer Elek- Der Bund und die Kantone stehen in der Pflicht, mit
trizitätswirtschaft, die im Sommer 2009 geführt geeigneten staatlichen Rahmenbedingungen dafür
wurden. Die Hintergründe der Analyse sind die Si- zu sorgen, dass die Energiewirtschaft die Versor-
cherstellung der Stromversorgung des Landes, die gungssicherheit gewährleisten kann.2 Den Schwei-
Marktliberalisierung, die Diskussion um Nachhal- zer Landesverbrauch von rund 63 Terawattstunden
tigkeit sowie der Einfluss der schweizerischen di- (TWh) generieren abgeschriebene Anlagen mit gün-
rekten Demokratie. Diskussionsgrundlage ist eine stiger Primärenergie (56 % Wasserkraft und 40 %
06/2010 (79. Jg.), Seite 391–399 zfo | 391Füh r un g R isike n d e r S chweizer Elektrizitätswir tschaf t
Nuklearkraft) ohne Emissionskosten schaftlichen, nicht technischen Literatur10 zum
Inhalt für CO2.3 schweizerischen Energiemarkt aus früheren Jahren
Seit rund 20 Jahren deckt sich die wird ferner deutlich, dass die Schweiz politisch und
• Einleitung Schweiz im Winterhalbjahr zu 20 % technologisch nicht bereit ist, ihre Kernenergie zu
• Die Schweizer Elektrizitätswirtschaft mit Atomstrom aus französischen ersetzen, ohne Gaskombikraftwerke einzusetzen –
• Interviews zur Energieversorgung Kraftwerken ein – gemäß langfristigen eine teure Art der Stromproduktion. Weiterhin wird
der Schweiz Verträgen, die ab 2017 nach und nach diskutiert, dass die Bevölkerung zwar Wasserkraft-
• Ergebnisse der Experteninterviews auslaufen. Die Schweiz importiert als und Gaskombiwerke akzeptiert, dass aber Kern-
• Management von Risiken einziges Land im Netzverbund der EU und Windenergie umstritten sind.
• Zusammenfassung/Summary diese Kapazitäten noch heute in privi-
legierter Position. Die Schweiz gene-
riert als Stromdurchgangsland rund 2 Interviews zur Energieversorgung
Mrd. CHF aus dem grenzüberschreitenden Handel. der Schweiz
Schätzungen zufolge4 klafft ab 2025 eine Versor-
gungslücke, Engpässe werden bereits ab 2018 er- Basis der vorliegenden Studie sind Interviews mit
wartet. Aktuell liegen drei unabhängige Projekte 33 Entscheidungsträgern und Experten der Schwei-
zum Bau von neuen Kernkraftwerken vor. Zwei Pro- zer Elektrizitätswirtschaft vom Sommer 2009. Die
jekten will die Regierung zustimmen. Der Bau von wichtigsten Gruppen sind die Versorger als Strom-
Nuklearkraftwerken untersteht seit dem revidierten produzenten und Verteiler, deren Eigentümer, die
Kernenergiegesetz von 20035 dem fakultativen Re- Konsumenten und die Politik als Regulator und po-
ferendum6. Über die neuen Anlagen kann frühes- litischer Taktgeber. Ergänzt wurde die Reihe durch
tens 2013 abgestimmt werden und sie wären in den Interviews mit fünf Know-how-Trägern, die den
Jahren 2025 bis 2027 betriebsbereit. Strommarkt in früheren Zeiten stark prägten (vgl.
Abb. 1). Die Größe des Landes und die Struktur der
Liberalisierung7 Branche ließen es zu, mit relativ wenigen Inter-
views eine große Repräsentanz zu erreichen.
Bis Anfang des Jahres 2009 war die Schweizer Elek- Alle Befragten erfüllen folgende Kriterien:
trizitätswirtschaft oligopolistisch organisiert. Die • Sie sind die wichtigsten Entscheidungsträger in
Branche besteht aus 840 Elektrizitätswerken, die ihrer Gruppe in der Schweizer Elektrizitätswirt-
zu durchschnittlich 80 % im Eigentum der öffentli- schaft und verfügen über direkte Entschei-
chen Hand – den Kantonen und Gemeinden – sind. dungsgewalt in letzter Instanz in ihrem Bereich.
Eine regulierte Teilmarktöffnung wurde im Januar • Expertenwissen: 85% der Befragten bringen
2009 für 53 % des Marktes eingeführt. Die Marktöff- mindestens zehn Jahre Erfahrung in der Elektri-
nung für Kleinunternehmen und Haushalte ist ab zitätswirtschaft mit.
2013 geplant und untersteht ebenfalls dem fakulta-
tiven Referendum. Die Grundgesamtheit der Versorger-Gruppe ent-
Das Parlament verabschiedete im März 2008 die spricht der Produktion des Schweizer Landesver-
neuen Regulierungen8. Bereits im Herbst waren die- brauchs von 63 TWh. Zu Wort kamen acht Entschei-
se Bestimmungen wegen der angekündigten Strom- dungsträger mit einem Anteil von 84 % der Jahres-
preiserhöhungen von bis zu 20 % wieder stark in der produktion. Die ausgewählten Unternehmungen
Diskussion. Der Bundesrat fror daraufhin im Dezem- sind zu 81 % in öffentlichem Eigentum, was dem
ber 2008 kurzfristig die Strompreiskomponente gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht.
Energie auf dem Niveau der Erzeugungskosten ein. Es wurden fünf Interviews mit Eigentümern der öf-
Dies galt jedoch nur für all diejenigen Konsumenten, fentlichen Hand, mit Kantons- oder Gemeinderä-
die den bisherigen Anbieter nicht wechseln. Im glei- ten, geführt.
chen Atemzug legte der Bund den Kapitalkostensatz Die 8 % der privaten, meist anonymen Eigenkapi-
des Übertragungs- und Verteilnetzes auf durch- talgeber sind durch vier relevante Finanzinstitute
schnittliche 4 % fest, was verglichen mit einem in- der Schweiz repräsentiert. Die Grundgesamtheit
dustriellen Satz von 7 bis 9 % sehr niedrig ist. dieser Gruppe ist schwierig zu erfassen. Interview-
Zur Überwachung und Einhaltung der gesetz partner waren einerseits Vertreter der Schweizer
lichen Grundlagen rief der Bund die ElCom als un- Banken, welche die sieben börsennotierten Versor-
abhängige staatliche Regulierungsbehörde mit um- ger professionell bewerten, und andererseits Fund-
fassenden Kompetenzen ins Leben. Sie ordnete Vertreter, die in der Branche für ihre finanziellen
beispielsweise im März 2009 die Senkung der Tari- Engagements bekannt sind. Die ausländischen Be-
fe des Übertragungsnetzes um rund 40 % für das teiligungen von rund 9 %11 wurden in der Befragung
gesamte Jahr 2009 an!9 Aus der wenigen wissen- nicht berücksichtigt.
392 | zfo 06/2010R isike n d e r S chwe izer Elektrizitätswir tschaf t Führung
Bund und Regulatoren sind seit der Teilmarktöff- Gruppe Grundgesamtheit Stellung der Befragten in % Anzahl
nung neue Mitspieler. Innerhalb der 38 für die Ener- Inter-
views
giebelange zuständigen National- und Ständeräte
Versorger Produktion CEO oder Verwaltungsrats- 84 % 8
konzentrieren sich acht auf den Bereich Elektrizi- Landesverbrauch Präsident oder -Vizepräsident,
tät. Die Energiedirektoren sind für die Energiepoli- Schweiz: 63 TWh Jahresproduktion: 53 TWh
tik auf Kantonsstufe zuständig. Zusammen mit der Eigentümer der Durchschnittlich zu 83 % Interviewte von Unternehmungen 81 % 5
obersten politischen Ebene auf Bundesstufe konn- Versorger: öffent- in öffentlicher Hand zu 81 % in öffentlicher Hand
liche Hand
ten von 14 Experten sieben befragt werden. Die fünf
Eigentümer der Durchschnittlich zu 8 % Alle im Schweizer Markt 4
wichtigsten Parteien der Schweiz12 werden mindes- Versorger: private im Eigentum von Privat- bekannten Finanzinstitute mit Kom-
tens durch je einen Interviewpartner repräsentiert. Kapitalgeber wirtschaft petenzen im Stromsektor
Die fünf Gespräche mit Großkonsumenten und Politik Regulatoren, Bund und Präsidium von ElCom und Bundes- 50 % 7
Kantonspolitik mit Fokus amt für Energie BFE, Parlamentarier
energieintensiven Industrien vertreten 46 % des Elektrizität & Kantonsregierung, Swissgrid
Stromverbrauchs auf dem freien Markt. Drei Inter- Parteien (19) SVP, SPS, FDP, CVP, GPS Mindestens ein Politiker pro Partei
views wurden mit Geschäftsführern von Interessen- vertreten
verbänden mit insgesamt 80 Mitgliederbetrieben Konsumenten Zugang zum freien Markt Vertreter von 13.8 TWh Konsum 46 % 4
geführt. Die Diversität der Mitglieder repräsentiert – 30 TWh
Unabhängige unabhängig großes Expertenwissen 5
die Großkonsumenten der Schweiz ausreichend. Know-how-Träger
Datenerhebung
raum. Die Genehmigung der Abschrift der Inter- Abb. 1 Repräsentativität
Die Untersuchung folgte einem explorativen Vorge- views durch die Gesprächspartner hat dies stark der Interviews
hen13, um möglichst viel Offenheit zu gewährleis- reduziert.
ten. Die Befragten sollten nicht durch vorgegebene Die Zuordnung der Interviewtextteile erfolgte
Hypothesen und Kategorien beeinflusst werden. nach Schlüsselworten. Die aus dem Untersu-
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass gerade Perso- chungshintergrund abgeleiteten Hauptkategorien
nen mit großer Verantwortung vorgegebene Risiken »Versorgungssicherheit«, »Liberalisierung und ge-
eher nennen, selbst wenn diese für sie nicht an ers- nerelle ökonomische Ineffizienzen«‚ »Nachhaltig-
ter Stelle stehen. Das Expertenwissen der Teilneh- keit und Umwelt« sowie »direkte Demokratie und
mer war eine unabdingbare Voraussetzung für die- soziale Akzeptanz« erwiesen sich als praktikabel.
ses Vorgehen, was der Interviewprozess auch be- Nur insgesamt fünf der 80 angesprochenen Risiken
stätigte: Je mehr Erfahrung der Befragte mitbrach- konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. Auch
te, umso umfangreicher und differenzierter waren die Unterkategorien ergaben sich aus den Inter-
die Antworten. views relativ eindeutig. Schwierigkeiten bestanden
Um ungefilterte Aussagen zu erhalten, wurden bei der Zuordnung zur »direkten Demokratie und
mit einer Ausnahme die Interviews in Form des per- sozialen Akzeptanz« sowie zur »Nachhaltigkeit und
sönlichen Gesprächs mit folgenden offenen Fragen Umwelt«. Alle drei Kategorien beeinflussen direkt
geführt: die Themenbereiche »Versorgungssicherheit« und
• Was sind die Risiken der Schweizer Elektrizitäts- »ökonomische Ineffizienzen«. Es wurde strikt nach
wirtschaft? Schlüsselworten ausgewertet.
• Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Die Quantifizierung der Resultate erfolgte über
Risiken zu verringern? das Zählen der Nennungen (vgl. die Klammerinhal-
te im Kapitel »Ergebnisse der Experteninterviews«).
Alle Gesprächspartner erhielten eine Abschrift des Dadurch ergab sich auch die Gewichtung der Risi-
Interviews, die angepasst und genehmigt wurde. ken: Je mehr und argumentativ stärker Experten ein
Thema ansprachen, desto größer ist die
Auswertung der Umfrage Risikowahrnehmung. Das Vorgehen wur- Qualitative Inhaltsanalyse
de für die Haupt- und Unterkategorien an- Der deutsche Psychologe, Soziologe und
Die Auswertung der Resultate orientiert sich an der gewendet. Veranschaulicht werden konn- Pädagoge Philipp Mayring entwickelte seit
qualitativen Inhaltsanalyse14, die qualitative mit ten nur diejenigen Risiken und Maßnah- 1980 die qualitative Inhaltsanalyse. Diese
quantitativen Ansätzen kombiniert: Der erste men zur Risikoverringerung, die von den Methode soll systematisch Texte analysieren
Schritt der Kategorienbildung und die Zuordnung Gesprächspartnern angesprochen wur- können, aber gleichzeitig der Interpretations-
bedürftigkeit des sprachlichen Materials ge-
zum Interviewtext sind qualitative Aspekte. Die den.
recht werden. Ein wichtiger Bestandteil
Quantifizierung erfolgt durch die Erhebung der Ka-
ist die Bildung von Kategorien, nach denen
tegorienhäufigkeiten. Die Messung der Daten
Aussagen anhand von Schlüsselworten
durch Auszählen, wie auch die Zuordnung der Text- sortiert werden können.
teile, bergen Unschärfen und Interpretationsspiel-
06/2010 zfo | 393Füh r un g R isike n d e r S chweizer Elektrizitätswir tschaf t
Ergebnisse der Experteninterviews (Stromausfälle) und Unfälle sowie generell techni-
sche Risiken nennen 27 % der Befragten. Eine Un-
Alle Interviewten nannten mindestens ein Risiko, terschätzung des Nachfrageanstiegs durch die
das die zukünftige Versorgungssicherheit der Elektrifizierung der Gesellschaft wird von 9 % als
Schweiz gefährdet. Je 79 % der Befragten sahen Ri- Risiko empfunden. Einzelne Personen sehen Risi-
siken in den Kategorien »Liberalisierung und öko- ken in der Finanzierbarkeit der neuen Kapazitäten
nomische Effizienz« sowie »direkte Demokratie und in der Langfristigkeit der Investitionen.
und soziale Akzeptanz«. Die wenigsten Risiken Gründe für eine unsichere zukünftige Versorgung
werden mit 48 % im Bereich »Nachhaltigkeit und liegen auch im Übertragungs- und Verteilnetz (58%,
Umwelt« wahrgenommen (vgl. Abb. 2). vgl. Abb. 5). Investitionen in Netzkapazitäten sind
wegen der geringen Rendite der Netze wenig attrak-
Versorgungssicherheit tiv (24%). Das generell hohe Alter der Netze ver-
Liberalisierung und
Markteffizienz
stärkt dies zusätzlich: Der aktuelle Wert des Netzes
Nachhaltigkeit und
Umwelt
beträgt laut Schätzungen der ElCom 1,6 Mrd. CHF;
Direkte Demokratie und soziale
Akzeptanz
der Wiederbeschaffungswert jedoch liegt bei 5 Mrd.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CHF.
Die Volatilität (Schwankung) im Netz steigt durch
Abb. 2 Die am häu- Versorgungssicherheit die Zunahme auf Seiten der erneuerbaren Energien
figsten genannten Risiken (12 %), – was ein Risiko für die Netzstabilität ist. Da
– die Hauptkategorien Alle Befragten weisen auf Risiken der zukünftigen die Schweiz kein EU-Mitglied und damit juristisch
Versorgungssicherheit hin: einerseits auf die Be- kein gleichberechtigtes Mitglied des europäischen
reitstellung der Produktionskapazitäten (100 %) Netzverbundes EntsoE ist, wird sie ihre Interessen
und andererseits auf die kritische Situation der ungenügend vertreten können (9 %).
Übertragungsnetze (58 %, vgl. Abb. 3).
Liberalisierung und ökonomische
Ineffizienzen
Bereitstellung der
Produktionskapazitäten
Übertragungs- und Verteilnetze In der Kategorie »Liberalisierung und ökonomische
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Ineffizienzen« konnten die Unterkategorien »Regu-
lierung«, »Struktur der Branche«und generell »öko-
nomische Risiken« gebildet werden (vgl. Abb. 6).
Abb. 3 Risiken der Immer mehr Auflagen und restriktivere Bewilli- Die neue Regulierung zur Teilmarktöffnung ist ge-
Hauptkategorie »Versor- gungsverfahren verzögern den Aufbau von Kapazi- nerell risikobehaftet (79 %, vgl. Abb. 7). 52 % der
gungssicherheit« (100 %) täten (27 %, vgl. Abb. 4). Schätzungen der Bundes- Befragten äußern sich kritisch und beschreiben ei-
behörde zufolge dauert der Bau eines neuen Kern- ne Marktordnung mit schwachen Kompromissen,
kraftwerks in der Schweiz heute rund 18 Jahre, fast vielen Unklarheiten sowie fehlenden und zu restrik-
doppelt so lange wie vor 30 Jahren – trotz technolo- tiven Vollzugsregelungen. In den Augen von 33 %
gischer Fortschritte. Mangelnde Bauerfahrung der Befragten fehlen das notwendige Wissen und
(6 %) verstärkt den Effekt. Die Versorgung ist zudem die Kenntnis von Zusammenhängen bei den Verant-
durch die auslaufenden Verträge mit Frankreich ge- wortlichen in der Politik. Kurzfristige Änderungen in
fährdet (18 %). der gesetzlichen Grundlage führten zu Unsicherhei-
Auf die Gefahren einer Importabhängigkeit wei- ten (66 %). Eine Ausnahme bilden die Konsumen-
sen 33 % der Befragten hin. Dies würde die Erpress- ten: Sie sind mit den Senkungen der Strompreis-
barkeit der Schweiz steigern. Die führende Rolle der komponenten zufrieden. Die Missbrauchsgesetz-
Abb. 4 Wichtigste Politik in der Sicherstellung der Versorgung wird als gebung der ElCom ist nach Ansicht von 18 % der
Risiken der Unterkategorie unbefriedigend wahrgenommen (25 %) wie auch Befragten beeinträchtigend.
»Produktionskapazitäten« die Verhandlungsfähigkeit der Branche (18 %). Die Eigentümer der Versorger – die Kantone und
(100 %) Risiken durch Kraftwerksausfälle, Blackouts Gemeinden – verlören Einnahmen, da die fixierten
Strompreise niedriger seien als der Marktpreis.
Nicht ein Strommarktgesetz, sondern ein Stromver-
Importabhängigkeit sorgungsgesetz sei geschaffen worden: Service pu-
Auflagen und restriktive Bewilligungsverfahren
technische Risiken blic (die Dienstleistungen, die die öffentliche Hand
Rolle der Politik in der Schweiz zu erbringen hat) stehe im Vorder-
Verhandlungsfähigkeit der Politik
Unterschätzung des Nachfrageanstiegs grund, nicht Wettbewerb. Das Risiko bestehe, dass
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% die Strommarktöffnung in der Schweiz nicht kom-
men werde, sagten 6 %. Eine Gefahr für die heimi-
394 | zfo 06/2010R isike n d e r S chwe izer Elektrizitätswir tschaf t Führung
schen Versorger ist für 12 % der Befragten die grö-
ßere Erfahrung der umliegenden EU-Länder mit Zinssatz Netze
dem Wettbewerb. Dies könne die Marktmacht ge- Privilegierung der Importe aus Frankreich
Volatilität durch erneuerbare Energien
fährden, wenn die Schweiz den Markt schließlich
Alter der Netze
doch öffne und sich die Preise anglichen. fehlende Verträge mit EntsoE
Ineffizienzen, verursacht durch die Struktur der 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Branche, nannten 70 % der Befragten als Risiko
(vgl. Abb. 8). Die Branche sei mit ihren 840 Werken Abb. 5 Wichtigste Risiken der Unterkategorie »Übertragungs- und Verteilnetze« (58 %)
sehr zerstückelt. Die Schweiz besitze so viele Elekt-
rizitätswerke wie Deutschland, das zehn Mal größer
sei. Die Bereitschaft, sich zu bewegen und etwas zu
ändern, fehle: Die Interviewten äußerten sich in fol- Regulierung
gender Weise: »Es geht zu gut«, »in Watte gepackt«, Struktur der
Branche
»die Kassen sind zu voll« und »Wohlfühleffekt«. Generelle ökonomische
Risiken
Ein weiteres Risiko wird in den Eigentümerstruk- 0% 20% 40% 60% 80% 100%
turen der Versorger (21 %) durch unklare Eignerstra-
tegien und eine mögliche Staatsgarantie bei Ver- Abb. 6 Risiken innerhalb der Hauptkategorie »Liberalisierung
lusten der Versorger wahrgenommen. Langsame und ökonomische Ineffizienzen« (79 %)
Entscheidungsprozesse wirkten verzögernd (6 %).
Die – im europäischen Vergleich – kleinen Schwei-
zer Versorger könnten Übernahmekandidaten wer- Kurzfristige Regulierungsänderungen
den (15 %). Regulierung zur Strommarktöffnung
Fehlende Kenntnis der Verantwortlichen
Generell ökonomische Risiken nannten 39 % der ElCom Missbrauchsgesetzgebung
Befragten (vgl. Abb. 9). Dass die Schweiz ihre Posi- Service public statt Wettbewerb
tion als Stromdrehscheibe im europäischen Um- Konkurrenz für Versorger durch Wettbewerb aus EU
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
feld verlieren könnte und dass daher die Einnah-
men sinken könnten, befürchten 30 % der Inter-
viewten. Die im Jahr 2009 neu eingeführte kosten- Abb. 7 Wichtigste Risiken der Unterkategorie »Liberalisierung« (79 %)
deckende Einspeisevergütung (KEV) zur Förderung
der erneuerbaren Energien wird als nicht wirt-
schaftlich angesehen (21 %). Auf Risiken aus dem Zerstückelt 840 Werke
derivaten Handel von Versorgern und auf finanziel- »Wohlfühleffekt« – »zu volle Kassen«
le Verpflichtungen von Muttergesellschaften wei- Eigentümerstrukturen
sen 12 % der Befragten hin. Einzelaussagen be- Übernahmekandidaten
leuchten Währungsrisiken und das Marktrisiko der 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
in Aktien angelegten Gelder des Entsorgungs- und
Stillegungsfonds für Nuklearkraftwerke. Abb. 8 Wichtigste Risiken der Unterkategorie »Struktur der Branche« (70 %)
Nachhaltigkeit
Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit und der Um- Verlust Stromdrehscheibe CH
welt nennen 48 % der Befragten (vgl. Abb. 10). Ein Förderung der neuen Erneuerbaren
Risiko für die Schweizer Elektrizitätswirtschaft wird Derivatehandel
von vielen Befragten (42 %) im beobachteten Trend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
zu Nachhaltigkeit und einer Ideologisierung und
sachfremden Politik wahrgenommen. Auch wird ein Abb. 9 Wichtigste Risiken der Unterkategorie »generelle ökonomische Ineffizienzen«
fehlendes physikalisches Verständnis der Elektrizi- (39%)
tät bemängelt, was zu Fehleinschätzungen führe.
Die kostendeckende Einspeisevergütung kanalisie-
re Investitionen unbefriedigend (18 %).
Ideologisierung und sachfremde Politik
Die nicht gelöste Entsorgungsproblematik von Zunehmende Auflagen und Abgaben
Nuklearabfällen sprechen 9 % der Interviewten an. KEV
Immer mehr Regulierungen wie etwa die Auflagen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
der Wasserkraftwerke, Renaturierungen, Wasser-
zinsen u.a. (21 %) und die Einschränkungen im Bau
fossiler Kraftwerke durch die geltende CO2-Kom- Abb. 10 Wichtigste Risiken der Hauptkategorie »Nachhaltigkeit und Umwelt« (48 %)
06/2010 zfo | 395Füh r un g R isike n d e r S chweizer Elektrizitätswir tschaf t
branche sei risikobehaftet (52 %): Partikularinter-
Partikulatinteressen der Versorger essen stünden oft im Vordergrund. Die Einstellung
Einsprachen vom Volk
Öffentlichkeitsarbeit
der Bevölkerung: »Wir in der Schweiz können uns
Fakultatives Referendum: Bau neuer Kernkraftwerke alles leisten«, wird als Gefahr für die Entwicklung
Reputation der Strombranche der Elektrizitätsversorgung gesehen (6 %).
NIMBY-Haltung
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Maßnahmen zur Verringerung der Risiken
Abb. 11 Wichtigste Risiken pensationsregelung der Schweiz (3 %) gelten als Bei fast allen Befragten war nach der Frage »Was
der Hauptkategorie »direkte weitere Risiken für die Elektrizitätswirtschaft. wird getan, um diese Risiken zu verringern?«, eine
Demokratie und soziale längere Pause beobachtbar. Oft wurde anschlie-
Akzeptanz« (79 %) Direkte Demokratie und soziale Akzeptanz ßend laut gedacht und nach Maßnahmen gesucht.
Einige nannten Wünsche und machten Vorschläge,
Die Schweizer Bürger verfügen in der direkten De- was zu tun wäre. Hier zeigte sich ein weiterer Vorteil
mokratie über weitgehende Mitbestimmungsrech- der gewählten Interviewtechnik: Die spontanen Re-
te. Der sozialen Akzeptanz kommt daher eine wich- aktionen der Befragten konnten ebenfalls ausge-
tige Bedeutung zu. 79 % der Befragten sehen eine wertet werden.
mangelnde Akzeptanz des Themas »Elektrizität« in 52 % der Befragten sind der Meinung, dass nicht
der Gesellschaft (vgl. Abb. 11). viel oder gar nichts getan werde, um die Risiken zu
Das fakultative Referendum gefährde den Bau reduzieren. Nur 6 % der Befragten erwähnten ein
der neuen Kernkraftwerke (30 %). Die Positionie- funktionierendes Risikomanagement. Die Inter-
rung der Branche und die Öffentlichkeitsarbeit wer- viewten nahmen insgesamt 80 verschiedene Risi-
den bemängelt (33 %): Das Vorgehen, drei separate ken wahr und sahen 20 risikomindernde Maßnah-
Kernkraftwerkprojekte zu präsentieren – obwohl men (vgl. Abb. 12).
nur zwei Projekte bewilligt werden – wird beispiels- 42 % der Befragten erkannten risikomindernde
weise als »ungeschickt« bezeichnet. Nur 9 % sehen Maßnahmen zum Thema »Versorgungssicherheit«:
ein Risiko, dass durch nukleare Unfälle die geplan- Die Branche trage durch geografische und technolo-
ten Anlagen nicht gebaut werden. Das fakultative gische Diversifikation und ihre Investitionsbereit-
Referendum für die Einführung der zweiten Hälfte schaft zur Versorgungssicherheit bei (36 %). Auch
der Liberalisierungsphase bedeutet für 9 % der Be- die Förderung der erneuerbaren Energien wird als
fragten ein Risiko. Diversifikationsmaßnahme gesehen (6 %). Die Vier-
Regional zu erteilende Baubewilligungen für Säulen-Strategie15 des Bundesrats und dessen Ener-
Übertragungsleitungen können vom Volk über Ein- gie-Außenhandelspolitik (18 %) sowie die Effizienz-
sprachen lange hinausgezögert oder gar verhindert maßnahmen der Kantone reduzieren gemäß (18 %)
werden (39 %). Eine NIMBY »Not-In-My-Backyard«- der Befragten das Risiko einer unsicheren Versor-
Haltung ist in der Schweizer Bevölkerung auszuma- gung. Die Versorgungspflicht (3 %) und die Aktien-
chen (15 %): Man möchte alle Sicherheiten und Vor- mehrheit des Staates (6 %) werden als solche risiko-
teile, ist jedoch nicht bereit, Einschränkungen da- mindernde Maßnahmen betrachtet, technologische
für in Kauf zu nehmen. Risikobehaftet sehen die Entwicklungen jedoch nur von einem Befragten.
Befragten die emotionale Kommunikation von Un- Blackouts würden die Bereitschaft zur Stärkung des
fällen, insbesondere von nuklearen Zwischenfällen Elektrizitätssystems erhöhen (3 %).
(9 %). Blackouts werden als geringes Risiko (6 %) Im Bereich »Liberalisierung und generelle ökono-
wahrgenommen. mische Ineffizienzen« ist die Klärung der Rahmenbe-
»Strom« sei ein unbeliebtes Thema, sagen 30 %; dingungen durch die ElCom für 9 % der Befragten ri-
Abb. 12 In welchen Haupt- der Grund sei ein Reputationsproblem der Branche. sikomindernd wie auch die weitere Arbeit an den
kategorien erfolgen Maßnah- Noch immer scheint das Image der arroganten, sich Rahmenbedingungen des Marktes (6 %). Der zuneh-
men, um die Risiken bereichernden »Strombarone« vorzuherrschen. mende Druck der EU und die globale Debatte im Aus-
zu mindern? Auch der Umgang innerhalb der Elektrizitäts land werden als unterstützend betrachtet (je 3 %).
Die Trennung von Produktion und Netzen schaffe
Transparenz und sei effizienzfördernd (3 %). Für die
Keine Maßnahmen ersichtlich Konsumenten war das im Dezember 2008 sehr er-
Versorgungssicherheit folgreiche Industrie-Lobbying risikomindernd (12 %).
Liberalisierung und ökonomische Ineffizienzen
Nachhaltigkeit und Umwelt
Handelsrisiken werden für 3 % durch Beschränkun-
Direkte Demokratie und soziale Akzeptanz gen der Kapitalverflechtungen reduziert.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maßnahmen der Risikoreduktion zum Thema
»Nachhaltigkeit und Umwelt« wurden nicht ge-
396 | zfo 06/2010R isike n d e r S chwe izer Elektrizitätswir tschaf t Führung
nannt. Im Bereich »direkte Demokratie und soziale
Akzeptanz« erkennen 36 % der Befragten Maßnah-
men zur Aufklärung der Bevölkerung mit Kommuni-
Zufriedenstellende Bedürfnisse
kationskampagnen. Der demokratische Prozess
allgemein (18 %) und die Kommunikation der Kan- 5. Soziale
tone mit dem Bund und den Geschäftsleitungen der Akzeptanz
Versorger (6 %) trügen dazu bei.
4. Nachhaltigkeit
Das Verhalten der Experten im Interview und auch
und Umwelt
ihre Aussagen lassen darauf schließen, dass sie in
Bezug auf den Umgang mit den Risiken wie gelähmt 3. Ökonomische Effizienz
sind. So werden wiederum Entwicklungen und inno-
vative Ansätze blockiert. Einige Gesprächspartner
Bedürfnisse
drückten dies auch direkt aus und sprachen von ei- 2. Versorgungssicherheit
Defizit-
nem gedämpften, nebulösen Bild, in dem Lustlosig-
keit herrsche und von einem spiralförmigen Prozess, 1. Zugriff auf nutzbare Energie
von dem man nicht wisse, wie man ihn beenden kön-
ne. Das Wort »Unsicherheit« konnte in allen Inter
viewabschriften 24 Mal gezählt werden.
gefährdet – eigentlich weniger wichtige Bedürfnis- Abb. 13 Energiepolitische
se, die auf den oberen Stufen der Maslow-Pyramide Entscheidungspyramide
Management von Risiken stehen. Nur geringe 9 % der Befragten nannten bei-
spielsweise das Risiko, dass durch Vorfälle in Nuk-
Den vielen Risiken stehen wenige risikomindernde learkraftwerken die neuen Kraftwerke nicht gebaut
Maßnahmen gegenüber. 52 % der Befragten erken- würden. Jedoch sehen 30 % ein hohes Risiko in ei-
nen keine oder zu wenig risikoreduzierende Aktivi- ner Volksabstimmung. Das Vertrauen der Experten
täten, das Risikomanagement in der Schweizer in die Technologie scheint wesentlich höher zu
Elektrizitätswirtschaft ist demnach ungenügend. sein, als in die Wähler.
Beobachtungen energiepolitischer Entscheidun- Folgende Aussage verdeutlicht dies zusätzlich:
gen anderer Staaten zeigen, dass eine sichere Ver- »… durch die Diskussionen werden die Bewilligun-
sorgung des Landes vor Themen wie ökonomische gen so lange verzögert, dass zwischen dem tech-
Effizienz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Ak- nisch notwendigen Abschalten alter Kraftwerke so-
zeptanz debattiert wird.16 wie dem Bau und der Inbetriebnahme der Ersatz-
Das Modell von Frei ist eine Analogie zur Bedürf- kraftwerke eine langjährige Lücke entsteht, wäh-
nispyramide von Maslow17, die allerdings in der Or- rend der die Versorgung infrage gestellt ist…«. Ei-
ganisationslehre kaum mehr akzeptiert wird.18 Sie gentlich müsste jeder mündige Bürger einer sol-
liefert aber einen einfachen Bezugsrahmen zur Dis- chen Argumentation folgen können.
kussion der Risiken und des Risikomanagements in Folgende Erklärungen bieten sich an:
der Elektrizitätswirtschaft. Die Maslow-Pyramide • Eine unmittelbare Erfahrung im Umgang mit Kraft-
legt nahe, dass höher geordnete Bedürfnisse erst werk-Neubauten bringen weder Bürger noch am-
Beachtung finden, wenn untergeordnete Bedürf- tierende Manager und Politiker mit. Die Langfris-
nisse befriedigt sind. Die Beobachtungen von Frei tigkeit sowohl des Baus wie auch des Betriebs
resultieren in der Hypothese, dass die Versorgungs- von Kraftwerken (und auch Netzen) übersteigt ge-
sicherheit entscheidend ist. wöhnliche Entscheidungserfahrun
Man würde in einem weit entwickelten Land wie gen. Die Laufzeit ist wesentlich län- Maslow’sche Bedürfnispyramide
der Schweiz erwarten, dass die Grundbedürfnisse ger als die Amtszeit eines Politikers In der Bedürfnispyramide von Maslow sind
(unten in der Pyramide) in der Energiepolitik ge- oder Managers. Das letzte Nuklear- die Bedürfnisse des Menschen hierarchisch
deckt sind und dass die Diskussionen mehrheitlich kraftwerk wurde in der Schweiz vor geordnet. Unten finden sich die physio
die oberen Stufen der Pyramide beleuchten. Über- rund 25 Jahren gebaut und die Geset- logischen Bedürfnisse, dann folgen Bedürfnisse
raschend zeigt die Umfrage jedoch, dass alle ze haben sich seither geändert. nach Sicherheit und Wertschätzung. Ganz oben
Schweizer Experten ein Risiko in der zukünftigen • Viele Bürger glauben den Experten in der Pyramide steht das Bedürfnis nach
und Stromkonzernen nicht. Emotio- Selbstverwirklichung. Maslow zufolge wird
Versorgungssicherheit sehen – auf der zweiten Stu-
ein höheres Bedürfnis erst dann befriedigt,
fe der Pyramide –, obwohl die technischen Voraus- nale Grundhaltungen erzeugen Vor-
wenn ein unteres Bedürfnis befriedigt ist.
setzungen dafür längst gegeben sind. stellungen, dass mit Energiesparen
Allerdings wird diese Theorie in der modernen
Die Interviewten sehen die Versorgung durch den oder mit erneuerbaren Energien die Organisationslehre normalerweise kaum
direkt-demokratischen Prozess, die soziale Akzep- Versorgungssicherheit zu gewähr- noch akzeptiert.
tanz und die Diskussionen um die Nachhaltigkeit leisten sei.
06/2010 zfo | 397Füh r un g R isike n d e r S chweizer Elektrizitätswir tschaf t
• Politiker und Stromkonzerne sind nicht über- ge eigene Produktion sehr wohl einer sehr teu-
zeugt, dass die Bürger ihnen glauben werden. ren Versorgung entgegen.
Das Vertrauen in den politischen Prozess scheint
zu fehlen. In der Umfrage äußerte sich ein Drittel Auffallend hoch sind für die Befragten die Risiken,
der befragten Politiker positiv über den Verlauf die aus der Einführung der neuen Marktordnung re-
des politischen Prozesses, während die Versor- sultieren. Die Schweizer Regierung gab in der Zwi-
ger diesen vor allem kritisieren und als Risiko schenzeit auch bekannt, dass die Regulierungen
wahrnehmen. überarbeitet werden sollen.
• Die Bereitschaft zu radikalen Änderungen ist bei In der Schweiz ist das Verständnis für die zukünfti-
den Betroffenen – den Versorgern und Großkon- ge Versorgungsproblematik ungenügend. Das Exper-
sumenten – nicht vorhanden. Sie halten am Bau tenwissen ist primär in der Strombranche vorhan-
von Großanlagen fest. Alternative Lösungen wur- den. Die Umfrage zeigt, dass nach der Planung von
den in den Gesprächen selten genannt. Es ist Produktionskapazitäten Maßnahmen zur Aufklä-
jedoch wahrscheinlich, dass die Schweiz als rung und zur Wissensvermittlung in der Politik und
Stromdurchgangsland geringe Versorgungspro- bei den Wählern eine äußerst wichtige Aufgabe sein
bleme haben wird. Sie sieht jedoch ohne günsti- werden.
Zusammenfassung Summary
Eine repräsentative Umfrage bei Entscheidungsträgern A representative survey among experts and decision-
im Umfeld der Schweizer Elektrizitätswirtschaft vom makers in the Swiss electricity sector in summer 2009
Sommer 2009 zeigt, dass die Stromversorgung der shows that Switzerland will face insecurity in energy
Schweiz zukünftig nicht gesichert ist, wenn Risiken supply if risks are not managed successfully. The same
nicht erfolgreich gemanagt werden. Dieselben Exper- experts identify an insufficient Risk management. The
ten halten das heutige Risikomanagement für mangel- discussion shows that communication and education
haft. In der Diskussion wird klar, dass Aufklärung und are necessary to solve the dilemma. Switzerland
Kommunikation unabdingbar sind. In der Schweiz seems to lack a clear and common understanding of
scheint ein klares gemeinsames Verständnis zum The- the security energy supply topic. This leads to pseudo-
ma »Versorgungssicherheit« zu fehlen. Dies führt zu discussions about technologies and to misjudgments
Scheindiskussionen über Technologien und zu Fehl- of citizens and politicians.
einschätzungen bei Bürgern und Politikern.
Anmerkungen mildert damit die Strompreiserhöhungen deutlich ab
1 Vgl. Maslow, A.: A theory of human motivation. (09.03.2009).
In: Psychological Review, 1943, Nr. 50, S. 370–396. 10 Literaturübersicht: Es gibt wenig nicht technische,
2 Vgl. Schweizerische Bundesverfassung Art. 89 Abs. 1., wissenschaftliche Literatur zum Schweizer Elektrizitäts-
Energiegesetz Art. 4 Abs. 2., Energiegesetz Art. 6a markt. Vier Publikationen sind für einen Teilaspekt
Abs. 1. der vorliegenden Studie interessant: Sie analysieren
3 Vgl. www.admin.bfe.ch: Themen und Energie das größte Risiko der Schweizer Elektrizitätswirtschaft,
statistiken, Elektrizitätsstatistik, Schweizer die Versorgungssicherheit, und betrachten das zu
Elektrizitätsstatistik 2008. künftige Produktionsportfolio genauer.
4 Vgl. www.drs3.ch/nachrichten/Schweiz: Darin heißt es, Ochoa sowie Ochoa und Ackere diskutieren Szenarien
die Stromlücke sei weniger akut als angedroht eines Ausstiegs der Schweiz aus der Kernenergie und
(6.10.2009). dessen Auswirkungen auf Importe und Exporte. Ochoa,
5 Vgl. www.bfe.admin.ch/Themen/Energierecht und P.: Policy changes in the Swiss electricity market:
Wasserrecht: Kernenergiegesetz und Kernenergiever- Analysis of likely market response. In: Socio-Economic
ordnungen. Planning Sciences, 2007, Nr. 41, S. 336–349; Ochoa, P./
6 Fakultatives Referendum: Es kommt zu einer Volks Ackere, van A.: Policy changes and the dynamics
abstimmung, falls dies 50.000 Bürger und Bürgerinnen of capacity expansion in the Swiss electricity market.
verlangen. Die Unterschriften müssen innerhalb von In: Energy Policy, 2009, Nr. 37, S. 1983–98.
100 Tagen nach der Publikation des Erlasses vorliegen. Aus ihrer Studie folgt, dass die Schweiz politisch und
Vgl. www.bk.admin.ch/Dokumentation technologisch nicht bereit ist, ihre 40 %-Kapazität aus
7 Vgl. Wohlfahrtstätter, C./Boutellier, R.: Die Strommarkt- Kernenergie zu ersetzen, ohne auf Gaskombikraftwerke
liberalisierung kommt und keiner geht hin. In: io new zurückzugreifen. Diese teure Stromproduktion bekäme
management, 2009, Nr. 1–2, S. 39–43. Konkurrenz von Importen aus Tiefpreisländern, was den
8 Vgl. www.bfe.admin.ch/Themen/Stromversorgung Aufbau eigener Kapazitäten verhindern könnte.
Stromversorgungsgesetz (Strom VG). Jegen und Wüstenhagen veranschaulichte die Einstel-
9 Vgl. www.elcom.ch/Neues Die ElCom senkt die Tarife lung von Schlüsselpersonen zum Portfolio-Mix der
2009 des Stromübertragungsnetzes um rund 40 % und Schweiz aus einer standardisierten Umfrage bei
398 | zfo 06/2010R isike n d e r S chwe izer Elektrizitätswir tschaf t Führung 250 Schweizer Schlüsselpersonen der Elektrizitäts SPS – Soziale Partei Schweiz, Wähleranteil: 21,5 %, CVP wirtschaft: Es herrschte eine breite Akzeptanz für die – Christliche Volkspartei Wähleranteil: 15,5 %, FDP – Wasserkraft-Technologien, für Energieeffizienz und Freisinnig-demokratische Partei: Wähleranteil: 15,5 %, auch für Gaskombikraftwerke. Ein großes Fragezeichen GPS – Grüne Partei, Wähleranteil: 10 %. wurde hinter die Kernkraft gesetzt und auch Windkraft In: www.parlament.ch/Dokumentation war umstritten. Jegen, M./Wüstenhagen, R.: Modernise 13 Vgl. Lamnek, S: Qualitative Sozialforschung, München/ it, sustainabilise it! Swiss energy policy on the eve Weinheim 2005. of electricity market liberalisation. In: Energy Policy, 14 Vgl. Mayring, P.: Neuere Entwicklungen in der 2001, Nr. 29, S. 45–54. qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhalts- Eine neuere Studie von Roth untersucht den zukünfti- analyse, Weinheim 2005. gen Produktionsmix des größten Schweizer Versorger- 15 Vgl. www.news.admin.ch/messages Der Bundesrat Konzerns Axpo unter Einbezug von 85 Mitarbeitern: Die beschließt eine neue Energiepolitik. erneuerbaren Energien waren prioritäre Wahl. Roth, S. 16 Vgl. Frei, C. W: The Kyoto Protocol – a victim of supply et al.: Sustainability of electricity supply technology security? Or: if Maslow were in energy politics. portfolio. In: Annuals of Nuclear Energy, 2009, Nr. 36, In: Energy Policy, 2004, Nr. 32, S. 1253–1256. S. 409–416. 17 Vgl. Maslow: a. a. O. 11 Vgl. www.admin.bfe.ch Energiestatistiken, Schweizer 18 Vgl. Wahba, A./Bridgwell, L: Maslow verunsichert. Elektrizitätsstatistik 2008. In: Organisational Behaviour and Human Performance, 12 SVP – Schweizerische Volkspartei, Wähleranteil: 31 %, 1976, Bd. 15, H. 2, S. 212–240. Dr. sc. ETH Claudia Wohlfahrtstätter Prof. Dr. sc. math. Roman Boutellier Department of Managment, Technology, Department of Managment, Technology, and Economics Chair of Technology and Innovation and Economics Chair of Technology and Innovation Management, ETH Zürich Management, ETH Zürich cwohlfahrtstaetter@ethz.ch rboutellier@sl.ethz.ch 06/2010 zfo | 399
Sie können auch lesen