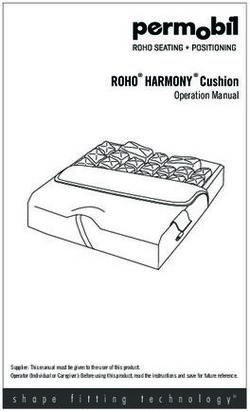Statt aufs Jungfraujoch ins Spital - Von Iwan Städler. Aktualisiert am 06.11.2012
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Statt aufs Jungfraujoch ins Spital Von Iwan Städler. Aktualisiert am 06.11.2012 Reiche Medizintouristen aus Russland und den Golfstaaten geben in Schweizer Spitälern Millionen aus. Und ihr Begleittross erfreut Hotels und Bijouterien. Letzte Woche waren Vermittler solcher Reisen vor Ort. Organisiert für Ukrainer Medizinreisen in die Schweiz: Irene Schkarowskaja zu Besuch im Zürcher Kinderspital. Bild: Sophie Stieger Sie kommen nicht in die Schweiz, um in Luzern die Kapellbrücke zu besichtigen oder aufs Jungfraujoch zu fahren. Ihre Destination ist ein Schweizer Spitzenspital. Dort lassen sich Reiche aus Russland und den Golfstaaten zum Beispiel ein künstliches Knie einbauen oder am Herzen operieren. Solche Medizintouristen sind gern gesehen. Denn sie und ihre Begleitpersonen bringen viel Geld ins Land. Entsprechend intensiv bemühen sich die Schweizer Touristiker um die reichen Gäste. Auf Einladung der Schweiz sahen sich letzte Woche acht russische und ukrainische Vermittler solcher Reisen in hiesigen Spitälern um und liessen sich die medizinischen Angebote präsentieren. «Derartige Behandlungen kann man in Russland im Reisebüro buchen», weiss Martin Nydegger von Schweiz Tourismus. Reiche Russen schätzen den hohen medizinischen Standard in der Schweiz. Und oft trauen sie ihren eigenen, mässig verdienenden Ärzten nicht. Zu häufig haben diese schon einen Tumor geortet, wo keiner war – zwecks Aufbesserung des Einkommens. Auch wollen viele Reiche nicht, dass ihr Leiden bekannt wird. Lieber reisen sie in geheimer Mission ins Ausland.
Hunderte von Begleitern Der saudische Kronprinz Nayef liess sich ebenfalls gerne in der Schweiz behandeln. Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass er in einem Genfer Spital verstorben war. Der 79-Jährige weilte aber nicht das erste Mal in einer Schweizer Klinik. Hunderte hätten ihn jeweils begleitet, erzählt ein Insider. Bei anderen Medizintouristen ist der Begleittross weniger gross. Aber auch sie reisen in der Regel nicht allein, sondern nehmen ihre Angehörigen mit. Diese wohnen meist in luxuriösen Hotels, kaufen teuren Schmuck und unternehmen zwischen den Spitalbesuchen touristische Ausflüge. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Gesundheitstourismus übersteigt den medizinischen Umsatz also bei weitem. Wie hoch er genau ist, lässt sich nur schätzen. Denn noch sind die Medizintouristen keine statistische Grösse, die amtlich erhoben wird. Bekannt ist nur, dass die Schweizer Spitäler jährlich über 40'000 ausländische Patienten behandeln. Diese Zahl umfasst allerdings auch den ausländischen Skifahrer, der nach einem Unfall im Spital behandelt werden muss. Rémy Schleiniger, der mit seiner zwölf Angestellte zählenden Firma Swixmed Medizintouristen an Schweizer Kliniken vermittelt, schätzt das Marktvolumen allein im Gesundheitswesen auf rund eine Milliarde Franken. Und es sei noch ausbaubar: «Swixmed geht von einem Potenzial von mindestens drei bis fünf Milliarden aus.» Andere Experten halten diese Zahlen für zu hoch gegriffen. Aber fast alle sprechen von einem beträchtlichen Steigerungspotenzial. Den Trend verschlafen Im weltweiten Konkurrenzkampf um Gesundheitstouristen kann die Schweiz laut Schleiniger viele Trümpfe ausspielen: «Unsere Medizin ist Weltspitze und die Pflege hervorragend. Zudem sorgen eine sensationelle Infrastruktur und die touristischen Attraktionen dafür, dass es einfach schön ist, in der Schweiz zu sein.» Auch die politische Stabilität, die Sicherheit und die Sprachenvielfalt wissen reiche Gesundheitstouristen zu schätzen. Aber: Die Schweiz hat den Trend lange verschlafen. Andere Länder wie Deutschland, die USA, Thailand und Singapur setzen schon länger auf den Medizintourismus und haben ihr Potenzial bisher besser ausgeschöpft. Entsprechend klein ist der aktuelle Marktanteil der Eidgenossen. «Die Schweiz ist bekannt für Ferien, Banking, Versicherungen und Uhren, aber weniger für ihr Gesundheitswesen», sagt Gregor Frei. Er will dies nun ändern – als Geschäftsführer des Vereins Swiss Health, der vor vier Jahren von Schweiz Tourismus und der Exportagentur des Bundes Osec gegründet wurde. Kunden aus den Golfstaaten und Russland Markus Wyss, der bei der Osec für diesen Bereich zuständig ist, erinnert sich: Eine Studie habe damals ergeben, dass sich die Förderung des Medizintourismus aufdränge, insbesondere wegen der finanziellen Nebeneffekte durch die Begleitpersonen. Darum habe man die Promotionsplattform Swiss Health ins Leben gerufen. Getragen wird sie von rund 40 interessierte Spitälern, die je nach Grösse jährlich zwischen
15'000 und 50'000 Franken an den Verein beisteuern. Hinzu kommen Sponsoringbeiträge von Banken und Bijoutiers, die sich dadurch gemeinsame Auftritte sichern. Im Wesentlichen konzentriert sich Swiss Health auf zwei Märkte: auf die Golfstaaten sowie auf Russland und angrenzende Staaten. Dort sprechen Frei und seine Leute potenzielle Kunden an, indem sie zum Beispiel bei Öl- und Gasclubs einen Vortrag über Diabetes, Übergewicht oder Schönheitsoperationen organisieren. Auch auf Schweizer Botschaften finden immer wieder solche Anlässe statt. Austausch unter Kollegen Swiss Health selbst vermarktet nur das Schweizer Gesundheitswesen als Ganzes und tritt nicht als Vermittler auf. Konkrete Anfragen leite man aber «nach bestem Wissen und Gewissen» an geeignete Spitäler weiter, sagt Frei, der vor Swiss Health mehrere Spitäler leitete und als Delegierter für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) im Mittleren Osten tätig war. Besonders wichtig ist im Gesundheitstourismus der persönliche Kontakt. Swiss Health versucht daher, Schweizer Spitäler mit solchen in Russland und den Golfstaaten zu verlinken. Die Idee dahinter: Gibt ein Schweizer Chirurg sein Know-how in Abu Dhabi an lokale Kollegen weiter, kann er damit rechnen, dass diese ihn in einem schwierigen Fall konsultieren und den Patienten in die Schweiz überweisen. Noch zielgerichteter wäre ein von Schweizer Ärzten geführtes Diagnostikzentrum vor Ort. Dieses könnte Patienten in die Schweiz vermitteln sowie die Vor- und Nachbetreuung übernehmen. Doch das ist noch Zukunftsmusik. So setzt Swiss Health nach wie vor auf lokale Vermittler in den Zielmärkten. Ihnen versucht Frei die Schweizer Spitäler näherzubringen – wie letzte Woche den sieben Russen und der Ukrainerin Irene Schkarowskaja. Sechs Tage lang liessen sie sich ein Spital nach dem anderen zeigen. Schkarowskaja war beeindruckt: «Alles in bester Qualität und so präzis wie Schweizer Uhren», lobt die auf Medizin- und Wellnessreisen spezialisierte Ukrainerin. Sie organisiert für ihre Kunden nicht nur die ärztliche Behandlung, sondern auch die Hotelbuchungen, Ausflüge und Shoppingtouren für die Begleitpersonen. Spezielle Patientenbetreuer Jeder zehnte russische Gesundheitstourist lässt sich laut Frei in der Schweiz behandeln. Je schwerer die Komplikation, desto höher ist die Chance, dass ein Schweizer Spital zum Zug kommt. Etwa eine Klinik der Hirslanden-Gruppe, die jährlich rund 3000 internationale Patienten behandelt. Diese Klientel macht laut Hirslanden-Sprecher Tobias Faes bereits drei Prozent des Umsatzes aus – Tendenz steigend. Für sie schuf die Gruppe eigens eine Abteilung, die sich um die Bedürfnisse der anspruchsvollen Kundschaft kümmert. Die Guest-Relation-Mitarbeitenden seien im Umgang mit anderen Kulturen geschult und würden die Sprachen der häufigsten Herkunftsländer sprechen, so Faes. Auch das Unispital Basel kennt eine Abteilung International Service. Sie betreut jährlich rund 70 Gesundheitstouristen und erzielt einen Umsatz von 1,5 Millionen Franken. Das sei – unter
Berücksichtigung der vollen Kosten inklusive Infrastrukturanteil – «knapp gewinnbringend», sagt Spitalsprecher Andreas Bitterlin. Überdies könne man so die Belegung ausgleichen, weil sich die Termine der Medizintouristen gut steuern und zum Beispiel in die Sommerferien legen liessen. Man nehme also keinem Schweizer einen Spitalplatz weg. Fussballer aus Dubai Besonders gute Kontakte hat das Basler Unispital zu Dubai und dessen Fussballern. Dort flögen die Basler Ärzte zwecks Vor- und Nachuntersuchung auch mal hin, was für das Personal eine willkommene Abwechslung sei, so Bitterlin. Erfreulich sind die Gesundheitstouristen auch für das Basler Fünfsternhotel Les Trois Rois, das wenige Schritte vom Unispital entfernt liegt. Hier logieren in der Regel die Familienangehörigen. Und wenn der Patient spätabends einen speziellen kulinarischen Wunsch haben sollte, erfüllt ihn das Les Trois Rois gerne. Auch das Zürcher Kinderspital behandelt jährlich gut 50 internationale Fälle. Sie sind in der Regel deutlich komplexer als bei einem durchschnittlichen Schweizer Patienten. Die Kapazität des Kinderspitals sei jedoch begrenzt, sagt Urs Rüegg von der Spitaldirektion. Es dürfe nicht zu Engpässen für Schweizer Patienten kommen. Die internationalen Privatpatienten seien aber für die Spitalkasse und die im Quervergleich weniger gut verdienenden Kinderärzte attraktiv. «Angesichts des Nachwuchsmangels ist dieser Zustupf für die Ärzte erfreulich», so Rüegg. Gesundheits-Check-up in einem Tag Das Berner Inselspital hingegen setzt laut Sprecher Markus Hächler nicht auf den Gesundheitstourismus: «Das ist ein verschwindend kleiner Teil unserer Patienten.» Der Berner Starchirurg Thierry Carrel ist ebenfalls eher skeptisch. Er behandle nur wenige Personen aus Russland und den Golfstaaten, sagt er. Zwar lehnt Carrel den Medizintourismus nicht grundsätzlich ab, stellt sich aber ethische Fragen – etwa wenn er Werbung für Schönheitschirurgie im Bordmagazin der Swiss sieht. Auch habe Russlands Gesundheitssystem ein Problem, wenn diesem die finanzkräftigen Patienten fehlten. Ein Teil der reichen Russen geht zu Gieri Cathomas. Der 36-jährige Bündner leitet beim Zürcher Bahnhof Stadelhofen die Praxis Double Check, die für 4480 Franken einen Ganztages-Check-up anbietet. Über 90 Prozent seiner Klienten seien Ausländer – die meisten Russen, sagt Cathomas. Etliche werden durch Banker und Anwälte vermittelt, die der Bündner als Botschafter für Double Check gewonnen hat. Andere Patienten akquiriert er auf seinen regelmässigen Reisen nach Russland. Weiteres Zentrum am Flughafen Sehr wichtig ist dabei die Diskretion: Einige Klienten würden mit der Limousine direkt in die Tiefgarage fahren und Wert darauf legen, dass ausser ihnen und dem Arzt niemand in der Praxis sei, sagt Gieri Cathomas. In zwei Drittel aller Fälle führten die Check-ups zu weiteren Untersuchungen oder Behandlungen – vor allem am Zürcher Universitätsspital und in der Hirslanden-Klinik.
Double Check wird von anderen Ärzten kritisiert: Bei Gesunden seien Check-ups fragwürdig und schädlich. Cathomas entgegnet, die meisten seiner Klienten hätten schon zu Hause einen Arzt konsultiert. Aber sie trauten dessen Diagnose nicht. Wie auch immer: Das Geschäft mit den reichen Gesundheitstouristen scheint zu rentieren. So ist auch im neuen Luxus-Dienstleistungszentrum, das nächstes Jahr beim Zürcher Flughafen gebaut wird, ein medizinisches Zentrum geplant. Es wird sich vor allem an vermögende Ausländer richten. (Tages-Anzeiger) Erstellt: 06.11.2012, 08:10 Uhr
Sie können auch lesen