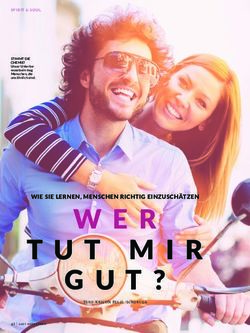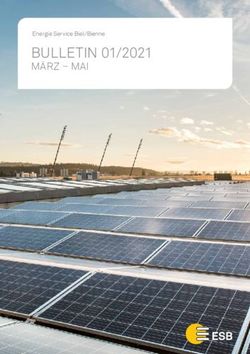Sammelrezension: Anime - Herbert Schwaab Repositorium für die Medienwissenschaft - media/rep
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Repositorium für die Medienwissenschaft Herbert Schwaab Sammelrezension: Anime 2020 https://doi.org/10.25969/mediarep/13617 Veröffentlichungsversion / published version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Schwaab, Herbert: Sammelrezension: Anime. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 37 (2020), Nr. 1, S. 90–94. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/13617. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung 3.0/ Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Attribution 3.0/ License. For more information see: Auskünfte zu dieser Lizenz finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
90 MEDIENwissenschaft 01/2020 Sammelrezension: Anime Mit e Anime Machine (Minneapo- Im Vergleich dazu ist die Lektüre lis/London: University of Minnesota von e Anime Ecology, das neue Werk Press) hat omas Lamarre 2009 eine von Lamarre, nun eher enttäuschend. wichtige Arbeit herausgebracht, die den Ähnlich lang und umfangreich, auch Anime im Anschluss an Gilles Deleuze im Format dem Vorgängerwerk sehr als ‚Maschine‘ zu denken versucht, als ähnlich gestaltet, scheint es den Ver- einen technologischen und ästhetischen such zu machen, e Anime Machine Komplex sowie eine Kraft des bewegten und seine Ambitionen noch zu über- Bildes, das basierend auf den Verfahren treffen und die Reichweite einer eo- der limitierten Animation einen eige- rie, die sich aus dem Anime als Form nen Raum, eine eigene Zeit und Dar- ableiten lässt, noch weiter auszudehnen, stellungen der Welt hervorbringt. Dieses was diese Arbeit aber ausufern lässt. e Buch ist äußerst instruktiv, geht es bei- Anime Ecology legt den Fokus auf den spielsweise darum, zu verstehen, wie in Fernsehanime und betrachtet ihn als der Animation mit der Verschiebung von Möglichkeit, das Medium Fernsehen Folien gearbeitet wird, um Bewegungs- an sich, aber auch eine weitreichende eindrücke zu erzeugen, wie Immobilität transmediale Infrastruktur zu verste- in Bewegungsdarstellungen integriert hen, die sich beim Anime in unzähligen werden kann, die sich von realfilmischen Franchises und vielen weiteren trans- Bewegungseindrücken unterscheiden medialen Phänomenen offenbart (vgl. und sich durch ein Durchbrechen der S.1). Lamarre möchte eine Ansicht ver- sensomotorischen Schemata der Anime tiefen, die mit dem Fernsehanime ver- als eine audiovisuelle Form manife- bunden ist, nämlich dass die Geschichte stiert, was sich tatsächlich sehr gut mit der Konvergenz und der Transmedi- Deleuzes Begriff des Zeitbildes verste- alität nicht erst mit digitalen Medien hen lässt. Die Lesenden lernen daher beginnt, sondern weit zurückreicht in von diesem Werk von Lamarre nicht die japanische Medien- und Fernsehge- nur medienphilosophische Deutungen schichte, die schon immer (im Anime des Anime, sondern zusätzlich sehr viel seit den frühen 1960er Jahren) Kopp- über dessen Ästhetik, Gestaltung und lungen von Fernsehserien, Konsum- einzelne Anime kennen. produkten und Werbung gekannt hat.
Fotografie und Film 91 Auch hier fungiert die ‚anime machine‘ des Zusammenschlusses von Anime als ein Katalysator und Initiator dieser mit der Technologie und Institution transmedialen Entwicklungen. des Fernsehens produziert werden, Was das Buch interessant macht, über Konzepte der Zuschauer_in, über ist vor allem der Versuch, Fernsehen medienkritische Diskurse und in der als zentral für die Veränderungen zu Gesellschaft zirkulierende Ängste vor betrachten, die mit den neueren Medien dem Fernsehen und vieles mehr. Die- einhergehen, und nicht als Medium, ser Ansatz ist durchaus interessant und das von einer digitalen Medienkultur wird äußerst material- und theoriereich abgelöst wird. Lohnend sind auch die behandelt. So setzt sich Lamarre zum Einblicke in die japanische Medienge- Beispiel mit einzelnen Animeserien und schichte, etwa wenn wir die Geschichte -franchises auseinander, und versucht des japanischen Fernsehens und dessen mit ihnen diese neue Medienökolo- Beziehung zu den Digitalisierungspro- gie und ihre Effekte zu perspektivie- zessen der Medien kennenlernen (vgl. ren. Das gelingt ganz gut, wenn die Kapitel 6 und 7). Was die Lektüre aber Serie Crayon Shin-chan (1990-2010) anstrengend macht, ist der Versuch, die diskutiert wird, deren transformative Anime-Ökologie als Ankerpunkt für Hauptfigur weder Kind noch Erwach- eine Auseinandersetzung mit Effek- sener ist (vgl. S.238). Hier werden unter ten von Medien auf die Menschen und anderem Wirkungen des Fernsehens in ihre Wahrnehmung zu nutzen. Hierbei Frage gestellt und mit der eigenwilligen wird ständig eher zwanghaft und auch Hauptfigur ein eigenartiger Vertreter auf etwas ermüdende Weise versucht, des von den Cultural Studies konzi- Anime mit den Großtheoretikern wie pierten aktiven Publikums gezeichnet. Gilles Deleuze, Felix Guattari, Michel Im Franchise und der ästhetischen Dif- Foucault oder Jacques Lacan, aber auch ferenz zwischen Fernseh- und Film- erst in jüngster Zeit diskutierten eo- anime werden produktive Prozesse von retikern wie Jacques Rancière oder Divergenz erkannt und Henry Jenkins Gilbert Simondon zusammenzuden- alles vereinigende Konvergenzfantasie ken. erfolgreich in Frage gestellt (S.244). Hintergrund dieser Auseinander- Aber in anderen Kapiteln ist das setzung und Leitmotiv dieses Buches Buch auch sehr anstrengend, bisweilen ist der sogenannte Pokémon-Schock verwirrend zu lesen; es fällt nicht immer von 1997 (vgl. S.33), als die Ausstrah- leicht, zu verstehen, auf was Lamarre lung einer Episode dieser Animeserie eigentlich hinauswill: Der Versuch, bei jungen Zuschauern und Zuschau- den esen durch eorien Autorität erinnen epileptische Anfälle ausgelöst zu geben, trägt häufig eher zur Ver- haben soll. Dieser Moment, auf den im wirrung bei und wirkt etwas wahllos, Band immer wieder rekurriert wird, wenn etwa auf Seite 48 so unterschied- bietet den Anlass dazu, über die neu- liche eoretiker_innen wie Elizabeth ropsychologischen Effekte nachzuden- Grosz, Judith Butler, Bruno Latour, ken, die durch die spezifischen Folgen Friedrich Kittler oder Isabelle Stengers
92 MEDIENwissenschaft 01/2020 in einem einzigen, kleinen Abschnitt Reihe (1982-90) und deckt dabei die zitiert werden. Dennoch gelingt es dem medial bedingten Unterschiede als kon- Werk, immer wieder neue Perspektiven stitutive Merkmale beider Objekte auf auf den Anime und die audiovisuelle (Kapitel 1). In diesem Fall und auch in Kultur zu eröffnen und vielleicht bedarf den anderen Lesarten, die immer ein es noch mehr Lektüren, um e Anime Kapitel des Bandes einnehmen, funkti- Ecology besser verstehen und abschlie- oniert der Anspruch sehr gut, Ästhetik ßend beurteilen zu können, was es tat- und Narration zusammenzudenken: sächlich zu leisten vermag. So behandelt Bolton die Frage, ob Etwas einfacher, aber ebenso Akira eher als Auseinandersetzung mit gestützt auf eine lange Reihe mittler- dem japanischen Trauma der Atom- weile klassisch gewordener Ansätze wie bombe zu betrachten ist (S.27f.), oder die von Michel Foucault, Jean-François als zynischer, postmoderner Text, der Lyotard, Roland Barthes, Vivian keine Möglichkeit bietet, für eine Poli- Sobchack, Judith Butler oder Donna tik vereinnahmt zu werden, sondern nur Haraway operiert der Band Interpreting die Verlorenheit des Subjektes darstel- Anime von Christopher Bolton. Auch len kann (S.34f.). In dieser Auseinan- sein Ziel ist es, den Anime als Genre dersetzung lernen wir sehr viel über die ernst zu nehmen und seine Objekte als japanische Kulturgeschichte und einen Texte auszuweisen, die mit allem Auf- widersprüchlichen Opferstatus kennen, wand und allen eorien auf produktive weil häufig die Rolle Japans als Aggres- Weise diskutiert werden können und sor verkannt wird. sollen. Bolton betont, dass seine Les- Für Bolton sind aber diese Wider- arten, im Gegensatz zu vielen anderen sprüche auch ein Kennzeichen für eine Auseinandersetzungen, immer auch bestimmende Eigenschaft des Anime, die Ästhetik und die Medialität des auf Gegensätzen aufgebaut zu sein. Anime in den Blick zu nehmen versu- Bei ihm ist dies vor allem der Gegen- chen (vgl. S.4). satz zwischen Immersion und Distanz Er organisiert seine Lesarten von (S.27). Hier schließt Bolton auch an Animeklassikern wie Akira (1988), Lamarre an, wenn er etwa betont, wie Ghost in the Shell (1995), Millennium dieser Kontrast mit dem Wechselspiel Actress (2001) oder Howl‘s Moving Castle von Bewegung und Stillstand in der (2004), aber auch unbekannteren Werke limitierten Animation korrespondiert wie 3x3 Eyes (1991 und 1992), die für und der Anime generell die Tendenz Videoveröffentlichungen und Fernse- dazu habe, seine Darstellung immer hen produziert wurden, immer über die wieder zu unterbrechen. Bolton gibt Diskussion ihrer Beziehungen zu einem diesem Aspekt, den er etwas zu pene- anderen Medium. So stellt er Ghost in trant als ,Prozess des Oszillierens‘ the Shell in Kontrast zum klassischen bezeichnet, an vielen Stellen Bedeu- japanischen Marionettentheater (vgl. tung. So korrespondiert die Ambiva- Kapitel 3), oder vergleicht den Anime lenz, die Akira auszeichnet, auch mit Akira mit der gleichnamigen Manga- einer Ästhetik des begrenzten Blickes,
Fotografie und Film 93 wenn die Hauptfi gur Tetsuo mit dem Gendertheorie und liefert ähnlich Motorrad durch die Nacht fährt und wie diese keine Auflösung des Wider- das Licht immer nur einen kleinen spruchs, eine geschlechtliche Identität Abschnitt der Straße erhellt (vgl. S.53). zu produzieren, in dieser Produktion Dieser begrenzte Blick unterscheidet aber ein Subjekt zu sein, dass von sich allerdings signifi kant von einem Sprache und Gesellschaft produziert weitreichenden, detaillierten Blick auf wird. Der Film ist nicht nur ein spiele- die geografischen Details der Stadt im risches Potpourri der vielen von einem parallel veröffentlichten Manga und weiblichen Star verkörperten Rollen, zeigt auch die Limitationen der gra- die Satoshi Kon scheinbar zentrums- phischen Gestaltung im Anime auf. Im los aneinanderreiht, sondern stellt auch Anime offenbart sich der Verlust von die Künstlichkeit dieser stereotypen Orientierung, im Manga ist die Ver- Bilder als Produkte der japanischen ortung der Figuren und der Lesenden Kultur und Gesellschaft heraus (vgl. möglich (vgl. S.53). Ein Oszillieren, S.188f). das analog zum grundsätzlichen Oszil- Es spricht für die Stringenz des lieren des Anime zwischen Immersion Zuganges von Bolton, dass er den und Distanz ist, findet Bolton in jedem Band mit der Interpretation von Howl‘s der interpretierten Werke wieder: Pat- Moving Castle von Hayao Miyazaki labor 2 (1993) wird Vivian Sobchack enden lässt. Miyazakis Abgrenzung folgend als Oszillieren zwischen dem vom Anime, den dieser vorwiegend cinematischen, körperlichen und dem mit billigen Fernsehproduktionen und elektronischen, körperlosen Blick gele- der limitierten Animation assoziiert, sen (vgl. S.60 und 66). Dass Patlabor führe auch dazu, dass es in diesem (und 2 diesen Unterschied auch in seiner anderen) Filmen von ihm auch nicht Ästhetik ref lektiert, wird an einer das Wechselspiel zwischen Immer- Reihe von Einstellungen gezeigt, sion und den künstlichen, reflexiven die den Blick eines Mediums imitie- Momenten gibt, die dieses Unterbre- ren, wenn wir etwa durch das Auge chen bietet. Stattdessen fordern sie von einer Überwachungskamera auf eine den Zuschauenden eher eine komplette Szene zu blicken scheinen (vgl. S.88). Immersion in die von ihm gebauten In Ghost in the Shell identifi ziert er Welten (S.238). Bolton betont hier eine ein Wechselspiel von Emotion und Besonderheit, aber auch eine Limita- Künstlichkeit im Zusammenhang tion von Miyazakis Filmen, die ihn von mit der Hauptfi gur eines weiblichen den anderen besprochenen Anime und Cyborgs, die auch das klassische japa- der von ihnen ermöglichten Distanz nische Puppentheater Bunraku aus- unterscheidet. Miyazakis Hang zur zeichnet (vgl. S.124), was Bolton als Immersion manifestiert sich in seiner Kommentar zum Cyborg-Feminismus Adaption eines Kinderbuches unter von Donna Haraway versteht. Millen- anderem darin, dass er konsequent nium Actress wiederum liest sich wie alle selbstreflexiven Aspekte der litera- ein Kommentar zu Judith Butlers rischen Vorlage weglässt und umdeutet.
94 MEDIENwissenschaft 01/2020 So beweist Christopher Bolton den Blick des Anime besser zu ver- ähnlich wie omas Lamarre, dass stehen und ihnen Bedeutung zu der Anime sich bestens dafür eignet, geben, und nicht etwa nur eorien über Effekte der Medienkultur, über zu gebrauchen, um einen Anime les- Geschlechterpolitiken und nicht zu- bar zu machen, der dieses Lesbarma- letzt auch über wissenschaftliche e- chen heute schon längst nicht mehr orie nachzudenken. Denn bei beiden braucht. wird dankenswerterweise auch die Möglichkeit genutzt, eorien durch Herbert Schwaab (Regensburg)
Sie können auch lesen