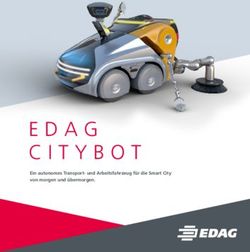Schröder, Riester, Müntefering: Die Demontage der Rente
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schröder, Riester, Müntefering: Die Demontage der Rente von Martin Staiger Seit Andrea Nahles, die neue Bundesministerin für Arbeit und Soziales, vor kurzem ihr Rentenpaket der Öffentlichkeit vorgestellt hat, wird über die Altersversorgung wieder breit diskutiert. Die Vorschläge gehen zumindest zum Teil in die richtige Richtung: Die Erhöhung des Rehabudgets und die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente sind für Erwerbstätige mit Rehabilitationsbedarf und für Menschen, die dauerhaft nicht oder nicht mehr vollschichtig arbeiten können, ein echter Gewinn. Auch die Verbesserungen bei den Kindererziehungszeiten für Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern waren schon lange fällig – auch wenn sie zu niedrig ausfallen. Da sie jedoch aus der Rentenkasse und damit aus dem falschen Topf finanziert werden, wird das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Rentenpolitik weiter beschädigt. Eindeutig zu kurz greift jedoch die Rente mit 63. Wer 45 Beitragsjahre auf dem Buckel hat, soll demnächst mit 63 Jahren eine abschlagsfreie Rente erhalten. Nahles will damit diejenigen belohnen, „die sich reingehängt und angestrengt haben“. Es gibt jedoch Millionen anderer, die das auch gerne getan hätten. Es war ihnen aber nicht vergönnt, da sie körperlich oder seelisch dazu nicht in der Lage waren, da sie in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit lebten oder da sie aufgrund einer Insolvenz ihres Arbeitgebers im höheren Alter ihren Job verloren und keinen neuen gefunden hatten. Für sie ändert sich nichts. Gute Sozialpolitik sieht anders aus. Betrachtet man die Rentenpolitik über einen längeren Zeitraum, ist das neue Rentenpaket lediglich ein Sammelsurium von „Notreparaturen“. Diese Notreparaturen können nur notdürftig die Beschädigungen verdecken, die der gesetzlichen Rentenversicherung durch die große Rentenreform des ersten rot- grünen Kabinetts unter Gerhard Schröder, die heute verkürzt unter dem Namen „Riesterrentenreform“ firmiert, zugefügt wurden. Als im Herbst 1998 nach 16 Jahren Kohl-Ära das erste rot-grüne Kabinett seine Arbeit aufnahm, sah es zunächst nach einer Renaissance in der Sozialpolitik aus. So vereinbarten die beiden Partner, dass sie „den Sozialstaat sichern und erneuern“, „die solidarische Gesellschaft stärken“ sowie „den Generationenvertrag erneuern und auf eine neue Grundlage stellen“ würden. So steht es in der schon recht vergilbten Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 1998. In ihrem rentenpolitischen Teil wurde „ein bezahlbares Rentensystem, das den Menschen im Alter einen angemessenen Lebensstandard garantiert“, angekündigt. Besonderes Augenmerk wollten die Koalitionäre darauf legen, unstete Erwerbsverläufe, Teilzeitarbeit und schlecht bezahlte Jobs rentenrechtlich abzusichern. Zur langfristigen Finanzierung der Altersvorsorge wurde vereinbart, neben der gesetzlichen Rentenversicherung – von der es hieß, sie werde „auch in Zukunft die entscheidende Säule der Altersvorsorge bleiben“ – die betriebliche und die private Rente zu stärken und
noch eine vierte Säule in die Altersversorgung einzubeziehen. Die vierte Säule sollte durch „eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital und am Gewinn der Unternehmen“ gebildet werden. Im Dezember 1998 wurde mit dem Rentenkorrekturgesetz als erster Maßnahme ein großer Teil des noch unter der Regierung Kohl beschlossenen Rentenreformgesetzes ausgesetzt. Infolge dieses Rentenkorrekturgesetzes lag im Jahr darauf zum ersten Mal seit vier Jahren der Rentenanstieg in Ost und West über der Teuerungsrate. Dies war ein wichtiges Signal an die Rentnerinnen und Rentner, die nun wieder etwas mehr Geld in der Tasche hatten, was die Inlandsnachfrage stärkte. Durch weitere Reformen wurde die Einnahmeseite der gesetzlichen Rentenversicherung gestärkt, ohne die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu belasten. So konnte durch das 630-Mark-Gesetz der in den Jahren davor zu beobachtende Trend, „geringfügige“ Beschäftigung auf Kosten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auszudehnen, gedreht werden. Dies gelang vor allem dadurch, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber „geringfügig Beschäftigter“ verpflichtet wurden, für diese eine Pauschale an die Kranken- und Rentenversicherung zu zahlen. Es wurde somit für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unattraktiver, Minijobs zu schaffen, was die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärkte und die Einnahmen der Sozialkassen erhöhte. Durch das Rentenkorrekturgesetz wurde außerdem der Bund verpflichtet, Bundessteuermittel für Kindererziehungszeiten und für die Kosten der deutschen Einheit, die die Vorgängerregierung allein der Rentenkasse aufgebürdet hatte, an die Rentenkasse zu überweisen. Der Effekt dieser Rentenpolitik, die durch eine auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ausgerichtete Steuerpolitik ergänzt wurde, konnte sich sehen lassen: Die Wirtschaft wuchs, die Zahl der Arbeitslosen ging zurück, die Löhne und Renten stiegen und die Beiträge zur Sozialversicherung ließen sich sogar senken – obwohl, oder genauer gesagt: weil man das soziale Netz wieder etwas dichter geknüpft hatte. Denn endlich wurde wieder eine Wirtschafts- und Sozialpolitik gemacht, die sich nicht einseitig auf die Verbesserung der Angebotsbedingungen konzentrierte, sondern die Stärkung der Inlandsnachfrage in den Mittelpunkt stellte. Warum Rot-Grün diese erfolgreiche Politik nicht fortgesetzt hat, sondern zum Entsetzen vieler Wählerinnen und Wähler bereits vor der Jahresmitte 1999 und vor allem in den Folgejahren durch eine diametral konträre Politik ersetzte – darüber streiten sich die Gelehrten. Es deutet einiges darauf hin, dass der sich dann bald in Armani-Anzügen als „Genosse der Bosse“ gerierende Gerhard Schröder den Wechsel hin zu einer den Sozialstaat weiter einschränkenden Politik schon vor der Wahl geplant hatte. Der Rücktritt des kurzzeitigen Finanzministers Oskar Lafontaine, der das linke Lager in der SPD nachhaltig schwächte und die sogenannten Modernisierer stärkte, erleichterte ihm sein Vorhaben wesentlich. Inzwischen hatte Schröder auch den englischen Premierminister Tony Blair besser kennengelernt und sich mit ihm zusammen zu einer Art sozialdemokratischen Avantgarde aufgeschwungen. Die beiden Regierungschefs hatten es sich zum Ziel
gesetzt, die europäische Sozialdemokratie aus ihrer „traditionellen“ Vergangenheit in eine „moderne“ Zukunft zu führen. In der Schrift „Ein Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten. Ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair“, die als Schröder-Blair-Papier bekannt werden sollte, beschrieben die beiden, was sie sich unter moderner Sozialdemokratie vorstellten: „Mehr Flexibilität“, „ein gestrafftes und modernisiertes Steuer- und Sozialleistungssystem“ und eine Umwandlung des „Sicherheitsnetz[es] aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung“. Rückenwind bekam Schröder durch den neoliberalen Zeitgeist, der inzwischen auch in den meisten Medien Einzug gehalten hatte. Man schrieb und redete vom „überbordenden Sozialstaat“, der zum „Rundum-sorglos- Paket“ geworden sei und zum Abhängen in der „sozialen Hängematte“ geradezu einlade. Teilprivatisierung der gesetzlichen Altersvorsorge Den Rest erledigten die Lobbyistinnen und Lobbyisten der Finanzbranche und der an einem niedrigen Rentenversicherungsbeitrag interessierten Arbeitgeberverbände sowie die für die weiteren Reformen entscheidenden Ministerien. Das waren das seit Oskar Lafontaines Rücktritt von Hans Eichel geführte Bundesfinanzministerium und das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung unter Walter Riester. Im Bundesfinanzministerium, zu dem die Finanzbranche enge Verbindungen pflegte, wurden zentrale Elemente der später als Riester-Rente bekannt gewordenen Teilprivatisierung der Alterssicherung ausgearbeitet. Der „eiserne Hans“, der vom Ehrgeiz getrieben war, einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vorzulegen, war an der Teilprivatisierung der Rente schon deswegen sehr interessiert, weil so der Rentenversicherungsbeitrag und damit auch der Steueranteil sinken konnte, den er an die Rentenkasse überweisen musste. Außerdem versprach sich Eichel „von der steuerlichen Förderung aktienbasierter Vorsorgeformen primär eine ‚Belebung’ des deutschen Finanzmarktes“. Und Walter Riester? Der wackere Gewerkschafter spielte in der Phase, in der die Rentenreformen auf den Weg gebracht wurden, nicht die allein entscheidende Rolle, die ihm heute gewöhnlich zugeschrieben wird. Riester hatte sich zwar schon zu seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender der IG Metall dafür ausgesprochen, die Alterssicherung auf mehrere Säulen zu stellen; er hatte sich jedoch für das in der Koalitionsvereinbarung festgeschriebene Viersäulenmodell starkgemacht. Die vierte Säule, die eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital und am Gewinn der Unternehmen vorsah, wurde jedoch im Laufe der Verhandlungen sang- und klanglos beerdigt. Ganz Parteisoldat, beugte sich Riester sehr schnell der von oben vorgegebenen Linie. Inzwischen ist er von „seiner“ Reform felsenfest überzeugt und macht seit Jahren als gefragter Vortragsredner bei Banken und Versicherungen unverdrossen und gut bezahlt Werbung für den Abschluss weiterer Riester-Renten. Das alles überragende Ziel der rot-grünen Rentenreform war die kurzfristige Senkung und langfristige Stabilisierung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung.
Die Stabilisierung des Beitragssatzes wurde erreicht, indem man in die Rentenformel zwei sogenannte Dämpfungsfaktoren einfügte, für die man die wenig aufschlussreichen Namen Riester-Faktor und Nachhaltigkeitsfaktor erfand. Beide Faktoren sollten den Anstieg der Renten dämpfen, aber natürlich nur ein bisschen – so schlimm würde es schon nicht kommen. Und außerdem gab „der Staat“ zum Ausgleich der Dämpfungen Zuschüsse zum Aufbau von privaten und Betriebsrenten, die dann – so der wirklich geglaubte oder zumindest überzeugend vorgetragene Gedanke – dank hoher Renditen am Kapitalmarkt zu einem sorgenfreien Alter führen würden. Seit 2002 gibt es für einen Vertrag über eine Riester-Rente direkte Zulagen aus dem Steuersäckel. Einzahlungen in eine als Entgeltumwandlung bezeichnete Betriebsrente werden seitdem steuer- und sozialabgabenfrei gestellt. Private Vorsorge: Gut für Gutverdiener, schlecht für die Sozialkassen Aus der Sicht von gut verdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hatten die Rentenreformen zunächst durchaus positive Effekte. Durch den sinkenden Rentenversicherungsbeitrag blieb mehr Netto vom Brutto, und die aus den Sozialkassen und durch den Fiskus subventionierte Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung wirkte sich beim Einzelnen lange positiv aus. So gibt es nicht wenige gut verdienende Arbeitnehmer, die von der neuen Gesetzgebung tatsächlich profitierten. Für den Fiskus und die Sozialkassen waren und sind die Reformen jedoch teuer. Die Zulagen und Steuererleichterungen für die Riester-Rente summieren sich bisher auf rund 17 Mrd. Euro. Allein die Einnahmeausfälle der Sozialkassen durch Entgeltumwandlung dürften etwa in gut doppelter Höhe liegen. Obwohl es um sehr viel Geld geht, ist die Datenlage extrem lückenhaft. Es gibt lediglich Schätzungen der Bundesregierung aus den Jahren 2006 und 2007, als die Sozialabgabenfreiheit der Beiträge zur Entgeltumwandlung breit diskutiert wurde. Die völlig unsinnige Subventionierung dieser Form der betrieblichen Altersvorsorge zulasten der Sozialkassen sollte nämlich 2008 auslaufen. Die damals regierende Große Koalition verlängerte sie jedoch bis zum Sankt- Nimmerleins-Tag – unter einhelligem Beifall von Versicherungswirtschaft, Arbeitgeberlobby und selbst aus den Reihen der Gewerkschaften. Die Gelackmeierten waren und sind die Sozialkassen. Durch Entgeltumwandlung werden der Kranken-, der Renten-, der Pflege- und der Arbeitslosenversicherung Jahr für Jahr mehrere Milliarden Euro entzogen. Diese Milliarden wandern zu den Banken und Versicherungskonzernen und spielen im weltweiten Anlageroulette mit – und sie tragen ihren Teil zu der bis heute nicht ausgestandenen, fälschlich als Staatsschuldenkrise bezeichneten Krise des Weltfinanzsystems bei. Dass die Dämpfungsfaktoren nicht so harmlos sind, wie der Begriff Dämpfung zunächst suggerierte, zeigte sich rasch. Mehrere Nullrunden und weitere Rentenreformen schickten die Renten auf Talfahrt. Allein zwischen 2003 und 2005 ergab sich eine reale Rentenkürzung von fünf Prozent, und seitdem sind die Renten mit lediglich zwei Ausnahmen stets hinter der Teuerungsrate zurückgeblieben. Diese Entwicklung hatte und hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die
Inlandsnachfrage. Die vielen Milliarden, die den Rentnerinnen und Rentnern durch die Reformen entzogen werden, fehlen in den Kassen der Konsumgüterindustrie, des Einzelhandels, der Handwerksbetriebe, der Gastronomie und anderer Dienstleistungsbetriebe. Nicht erst seit heute wird über die mangelnde Binnennachfrage geklagt – was auch mit den Rentenkürzungen zusammenhängt. Die Teilprivatisierung der Altersvorsorge fällt in die große Zeit des Neuen Marktes, als kleine Softwareschmieden innerhalb kürzester Zeit einen völlig realitätsfernen Börsenwert in Millionen- oder gar Milliardenhöhe erreichen konnten. Man war geradezu besoffen von den Möglichkeiten des Kapitalmarktes und den lockenden Renditen, die die Rendite der biederen gesetzlichen Rentenversicherung angeblich weit in den Schatten stellten. Es war die Zeit, als der Schlachtruf von Margaret Thatcher mit einiger Verspätung auch diesseits des Ärmelkanals plötzlich in aller Munde war: „Es gibt keine Alternative“, tönte es von allen Seiten, was nicht nur in diesem, sondern auch in allen anderen Zusammenhängen falsch ist. Es gibt immer Alternativen. Man wollte aber die Alternativen nicht prüfen. Und Walter Riester verstieg sich, nachdem die „Jahrhundertreform“ in trockenen Tüchern war, sogar zu der Aussage: „Jede Rentnerin und jeder Rentner wird jetzt und in Zukunft mehr Renten erhalten als nach altem Recht.“ Dass mit der Krise des Neuen Marktes damals die erste Hoffnungsblase bereits geplatzt war, focht ihn nicht an. Einwände gegen diese Rentenpolitik verhallten weitgehend ungehört. So protestierte der schon damals vermutlich beste Kenner der Materie, der langjährige Vorsitzende des Sozialbeirates, Winfried Schmähl, scharf gegen die Teilprivatisierung der Rente. Schmähl hatte schon damals vorausgesehen, was dann später eintreten sollte, und davor gewarnt, die Akzeptanz des Rentensystems zu verspielen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einseitig zu belasten. Aber anstatt ihm ernsthaft zuzuhören, setzte Riester ihn kurzerhand vor die Tür. Typen wie Schmähl, die nicht in erster Linie betriebs-, sondern volkswirtschaftlich dachten, passten nicht mehr in die neue und vermeintlich bessere Zeit, in der selbst Vertreter des Staates den neoliberalen Neusprech à la „privat ist besser als staatlich“, „der Staat kann es nicht“ etc. pflegten. Schmähls Posten im Sozialbeirat wurde dann mit Bert Rürup besetzt, der beste Beziehungen zur Versicherungswirtschaft pflegte und an der Erfindung einer weiteren kapitalgedeckten Rentenform, die dann später als Rürup-Rente bekannt werden sollte, maßgeblich beteiligt war. Die Hartz-Reformen: Es geht den Einnahmen an den Kragen Die Teilprivatisierung der gesetzlichen Rentenversicherung war kaum durchgesetzt, da kamen die Hartz-Reformen, die auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten jedoch sehr viel mit der Rentenversicherung zu tun hatten. Mit den Hartz-Gesetzen, die zwischen 2003 und 2005 in Kraft traten, hatte Deutschland nämlich, so Gerhard Schröder am 28. Januar 2005 in einer Rede vor dem World Economic Forum in Davos, „einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt“.
Mit Hartz I fielen einige bis dahin geltende Beschränkungen für Leiharbeit weg, was dazu führte, dass die Zahl der Leiharbeitsplätze stark anstieg. Viele dieser Arbeitsplätze entstanden jedoch nicht zusätzlich, sondern wurden auf Kosten bisher bestehender besser bezahlter Arbeitsplätze geschaffen. Mit Hartz II wurde dann die Lohngrenze für Minijobs deutlich auf damals 400 Euro (heute: 450 Euro) pro Monat angehoben. Außerdem wurde die Arbeitszeitbeschränkung von bis dahin 15 Stunden pro Woche abgeschafft, was dem Lohndumping im Bereich der Minijobs Tor und Tür öffnete. Mit Hartz II wurde außerdem der Midijob erfunden. Midijobs sind Arbeitsverhältnisse mit einem monatlichen Bruttolohn von bisher über 400 bis 800, seit 2013 zwischen über 450 und 850 Euro. Für Midijobs muss seit Hartz II ein geringerer Prozentsatz des Einkommens an die Sozialversicherungen abgeführt werden als für besser bezahlte Beschäftigungen. In vielen Branchen, zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Gastronomie, wurden ab 2003 viele Vollzeitstellen in mehrere Midi- oder Minijobs aufgespalten. Da Mini- und Midijobbern außerdem oft ein deutlich geringerer Stundenlohn bezahlt wird als Vollzeitkräften, spart der Arbeitgeber doppelt. Leidtragende sind die Beschäftigten – und die Sozialversicherung. 2005 wurde mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ der Schlussstein in das Niedriglohngebäude eingefügt. Wer auf Hartz IV angewiesen ist, muss so gut wie jeden Job zu beinahe jedem Lohn annehmen. Hartz IV gab damit dem Wachstum des Niedriglohnsektors einen weiteren Schub. Inzwischen arbeitet fast ein Viertel der Beschäftigten für einen Bruttostundenlohn von unter 9,15 Euro. Aus Minilöhnen werden jedoch nicht nur Minirenten, sondern auch Minirentenversicherungsbeiträge. So fehlt der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Ausweitung des Niedriglohnsektors bereits heute sehr viel Geld – und über die Rentenformel, nach der sich die Höhe der Renten berechnet, drücken die niedrigen Löhne bereits die heutigen Renten. Kaum waren die ersten beiden Hartz-Gesetze in Kraft, veränderte sich die Relation zwischen den beiden Einkommensarten, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammen das Volkseinkommen bilden, dramatisch. Seit Anfang der 90er Jahre war das Verhältnis zwischen dem zum Großteil rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmereinkommen und dem – von Ausnahmen abgesehen – nicht rentenversicherungspflichtigen Unternehmens- und Vermögenseinkommen relativ stabil. Zwischen 2003 und 2007 stiegen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen dann um mehr als 220 Mrd. Euro an, während die Arbeitnehmereinkommen im gleichen Zeitraum um nicht einmal 50 Mrd. Euro nach oben gingen – was inflationsbereinigt ein deutliches Minus bei den Arbeitnehmereinkommen ergab. Für die Rentenversicherung bedeutete diese Entwicklung Mindereinnahmen in Milliardenhöhe. Und so wurde trotz mehrerer Nullrunden bei den Renten, die zu realen Rentenkürzungen führten, der Rentenversicherungsbeitrag sogar angehoben.
Zusätzlich zur politisch gewollten Schwächung der Arbeitnehmereinkommen entzogen einige weitere Entscheidungen der gesetzlichen Rentenversicherung viele Milliarden Euro. So wurden die Rentenversicherungsbeiträge für Langzeitarbeitslose in mehreren Schritten bis auf null herabgesetzt: Noch bis 1996 wurden für Langzeitarbeitslose, die die damalige Arbeitslosenhilfe erhielten, Beiträge auf der Basis von 80 Prozent ihres letzten Lohnes in die Rentenversicherung eingezahlt. Für die gesetzliche Rentenversicherung führte diese Regelung zu jährlichen Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Euro, die aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert wurden; für die Langzeitarbeitslosen der 90er Jahre bedeutete sie die Aussicht auf eine einigermaßen passable Rente. In den Jahren 1997, 2000 und 2007 wurden die Beiträge immer weiter gesenkt, bis sie 2011 gänzlich abgeschafft wurden: Seitdem werden für Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach Sozialgesetzbuch II gar keine Rentenversicherungsbeiträge mehr eingezahlt. „Mehr Netto vom Brutto“ – der falsche Lockruf An dieser Reformkette zeigt sich schlaglichtartig ein Paradigmenwechsel der Sozialpolitik. Der bis Mitte der 90er Jahre bestehende Konsens, auch Langzeitarbeitslose rentenrechtlich abzusichern, bröckelte nach und nach, bis davon nichts mehr übrig blieb. Diese Entwicklung liegt in der Logik eines anderen Blicks auf langzeitarbeitslose Menschen. Wurde früher Langzeitarbeitslosigkeit hauptsächlich auf Wirtschaftskrisen, Missmanagement bei insolventen Betrieben und den Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft zurückgeführt, hat sich dieser Blick komplett gewandelt. Langzeitarbeitslosigkeit gilt heute bei der Mehrheit – zumindest bei der Mehrheit der Medien, die unsere Einstellung wahrscheinlich wesentlich stärker prägen, als uns lieb ist – als größtenteils individuell verschuldet. Innerhalb einer solchen Logik sind Rentenversicherungsbeiträge für Langzeitarbeitslose rausgeschmissenes Steuergeld. Die jahrelange Desavouierung der gesetzlichen Rentenversicherung und darüber hinaus des ganzen Sozialstaates hatte jedoch noch andere Folgen. Viele Menschen, insbesondere viele junge, haben den Glauben an die Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme weitgehend verloren. Nicht nur für viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sondern auch für viele abhängig Beschäftigte sind die Sozialversicherungsbeiträge inzwischen ein Ärgernis. Die große Gehirnwäsche hat funktioniert. Warum sollte man sozialversicherungspflichtig arbeiten, wenn die Rente sowieso nicht sicher ist? Klingt da nicht „mehr Netto vom Brutto“ viel verlockender? In diesem Klima entstand in den letzten Jahren eine ganze Reihe von sozialversicherungsfreien „Arbeitsverhältnissen“, von denen manche legal, manche am Rand der Legalität und manche jenseits dieses Randes angesiedelt sind. Eine beliebte Möglichkeit, die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen zu umgehen, ist die Beschäftigung „auf Honorarbasis“. Wer auf Honorarbasis
beschäftigt ist, erhält für seine Tätigkeit ein Honorar, für das der Auftraggeber keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer abführt. So gibt es zum Beispiel Sozialberatungsstellen, bei denen einige Stunden pro Woche auf Honorarbasis beschäftigte Psychologinnen oder Sozialarbeiter Beratungszeiten abdecken, die von den „regulär“ Beschäftigten nicht geleistet werden können. Da in diesen Fällen die auf Honorarbasis Beschäftigten in die Arbeitsorganisation ihres Auftraggebers eingegliedert sind, müssten sie jedoch nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches IV sozialversicherungspflichtig angestellt werden – was für den „Arbeitgeber“ oder die „Arbeitgeberin“ deutlich teurer wäre als die Beschäftigung auf Honorarbasis. Auch der oder die Beschäftigte hätte in manchen Fällen weniger Netto vom Brutto, aber mehr soziale Sicherheit. Diese wird jedoch nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch – siehe oben – immer häufiger von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eher geringer geschätzt. Die vermeintliche Win-win-Situation ist aber bei genauem Hinsehen eine Win-lose-lose-Situation. Gewinnerinnen und Gewinner sind die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Verliererinnen und Verlierer sind die Beschäftigten – und die Sozialversicherung. Viele dieser Konstruktionen sind sozialrechtlich äußerst fragwürdig. Man ist geneigt, in dem einen oder anderen Fall von Sozialversicherungsbetrug zu sprechen. Dennoch gibt es diese Konstruktionen – nicht zuletzt zum Schaden der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine weitere Möglichkeit für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Sozialversicherungspflicht zu umgehen, ist der Abschluss von Werkverträgen. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist diese Form von Beschäftigung insbesondere in der Getränkeindustrie, der Milchwirtschaft sowie der Brot- und Backwarenindustrie stark auf dem Vormarsch. In Schlachthöfen oder auch im Bereich der Paketzustellung gibt es schon länger Werkverträge. Wer auf der Basis eines Werkvertrages arbeitet, bekommt keinen Stundenlohn, sondern wird nach abgeschlossenen „Werken“ bezahlt – pro geschlachtetem Tier, pro zugestelltem Paket, pro eingeräumtem Regal oder pro gebackenem Brot. Der Vorteil für den „Arbeitgeber“ liegt auf der Hand: Die Bezahlung unproduktiver Zeiten wie Krankheit oder Urlaub fällt ebenso weg wie der Kündigungsschutz oder die Bezahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das Nachsehen haben auch hier die Beschäftigten und die Sozialversicherung. Eine Möglichkeit, ganz legal Sozialversicherungsbeiträge zu sparen, bieten die Sozialversicherungsverordnung und das Einkommensteuergesetz. Sehr beliebt sind Benzingutscheine, die bis zu einem Wert von 44 Euro pro Monat für den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten: So lässt sich zum Beispiel ein Teil des Lohnes steuer- und sozialabgabenfrei als Essensgeld, als Internetpauschale oder als „Erholungsbeihilfe“ auszahlen – ganz legal. Das Geschäft der Lohnoptimierungsbranche boomt. Nach einem Bericht von „Welt Online“ hat allein die Bocholter Unternehmensberatung „praemium“ rund 280 Unternehmen mit mehr als 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Senkung der Lohnnebenkosten verholfen. Von den meisten Belegschaften ist gegen ein solches
Gebaren kaum Widerstand zu erwarten – im Gegenteil: Mehr Netto vom Brutto nimmt jeder gern. Die Ehrlichen sind die Dummen Die Ausbreitung der verschiedenen Spielarten von nicht oder nur zum Teil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung führt auch zu negativen Zweitrundeneffekten. Denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten voll sozialversicherungspflichtig anstellen, erleiden gegenüber denjenigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht oder nur zum Teil sozialversichert beschäftigen, Wettbewerbsnachteile. Da in vielen Dienstleistungsberufen wie zum Beispiel im Einzelhandel die Höhe der Lohnkosten ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ist, können diese Wettbewerbsnachteile so groß werden, dass den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die ihre Beschäftigten voll sozialversicherungspflichtig anstellen, nur noch zwei Möglichkeiten bleiben: mitmachen oder aufgeben. Mini- und Midijobs, Honorarjobs, Werkverträge, unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika und die sozialversicherungsfreie Auszahlung von Lohnbestandteilen haben eines gemeinsam: Sie führen zu keinen oder nur zu geringen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, der damit weitere Milliarden fehlen. Und für die Betroffenen, die vielleicht in manchen Fällen nicht einmal ungern in einem solchen „Arbeitsverhältnis“ arbeiten, kommt das böse Erwachen im Rentenalter, da es für nicht sozialversicherungspflichtige Bezüge auch keine Rente gibt. Obwohl sie mit der Einführung der Riester-Rente und den weiteren Reformen schon sehr viel mehr bekommen, als sie vermutlich zu hoffen gewagt hatten, gaben die Lobbyistinnen und Lobbyisten keine Ruhe. Wegen der – im Versicherungsdeutsch wenig charmant „Langlebigkeitsrisiko“ genannten – gestiegenen Lebenserwartung sollten die Leute doch bitte gefälligst auch länger arbeiten, so argumentierten die Versicherungswirtschaft und die Arbeitgeberverbände. Und sie stießen damit bei der ab Herbst 2005 regierenden Großen Koalition auf offene Ohren. Die Rente mit 67 Ist die Teilprivatisierung der Rente mit dem Namen Walter Riester verknüpft, lässt sich die Rente mit 67 nicht von Franz Müntefering trennen. Der Arbeits- und Sozialminister, der damals just selbst 67 wurde, setzte 2007 zum Entsetzen vieler seiner Genossinnen und Genossen mit großer Zähigkeit diese bisher letzte große Rentenreform durch. Diesmal protestierte nicht nur die Linkspartei, auch aus dem Lager der Gewerkschaften, die den vorhergehenden Rentenreformen nicht sehr viele Steine in den Weg gelegt hatten, war heftiger Widerstand zu vernehmen. Der Protest nutzte jedoch nichts; die Rentenreform wurde mit überwältigender Mehrheit vom Parlament beschlossen. Das Renteneintrittsalter steigt nun schrittweise an, bis die Jahrgänge 1964 und jünger erst mit 67 eine volle Altersrente erhalten können.
Die Ausnahme für langjährig Beschäftigte mit mindestens 45 Versicherungsjahren, die mit 65 Jahren abschlagfrei in Rente gehen konnten, soll nun schon ab 63 Jahren greifen. Davon profitieren jedoch nur wenige ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind nach wie vor kaum bereit, über Fünfzigjährige einzustellen. So ist zu erwarten, dass auch in Zukunft viele Beschäftigte nicht bis zum Renteneintrittsalter sozialversicherungspflichtig arbeiten werden. Die Zahl der rentennahen Jahrgänge, die Arbeit haben, steigt zwar seit Jahren leicht an, was von den Befürworterinnen und Befürwortern der Rente mit 67 als Erfolg gewertet wird. Sozialversicherungspflichtig arbeitet jedoch nach wie vor nur eine kleine Minderheit der Älteren. Es ist absehbar, dass die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters für viele Rentnerinnen und Rentner der Zukunft neben all den anderen Kürzungen zur weiteren Verminderung ihrer Altersbezüge führt. Schon seit Jahren gehen rund 50 Prozent der Neurentnerinnen und Neurentner vor dem gesetzlichen Eintrittsalter in Rente, was zu Abschlägen führt. Wer heute beispielsweise bereits mit 62 in Rente geht, muss mit mehr als elf Prozent Rentenabschlag rechnen. Die durchschnittlichen Abschläge liegen seit Jahren stabil bei etwas über hundert Euro pro Monat. Und eine Änderung ist nicht in Sicht – daran werden auch die jüngsten Vorschläge der neuen Arbeitsministerin nichts ändern. * Der Beitrag basiert auf dem jüngsten Buch des Autors, Rettet die Rente, das 2013 in der Publik-Forum Verlagsgesesellschaft mbH, Oberursel, erschienen ist (Bestellnummer 3024, auch als E-Book erhältlich).
Sie können auch lesen