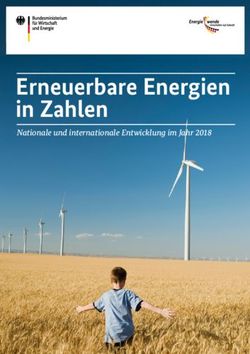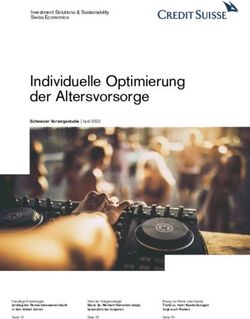SCHWEIZER SPITÄLER: SO GESUND WAREN DIE FINANZEN 2018 - MARKTTRENDS ANTIZIPIEREN UND SICH FÜR DIE ZUKUNFT RÜSTEN - PWC
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schweizer Spitäler:
So gesund waren die
Finanzen 2018
Markttrends antizipieren und sich für die Zukunft rüsten
Vergleich der wichtigsten Kennzahlen von Schweizer Spitälern,
achte Ausgabe, November 2019
www.pwc.ch/gesundheitswesenAkutsomatik Psychiatrie
Wachstumsraten im Jahr 2018 Wachstumsraten im Jahr 2018
2,3 %
2,1 % 2,0 %
1,8 %
0,9 %
-1,0 %
Umsatz Personal- Sach- Umsatz Sach-
aufwand aufwand aufwand
Personal-
aufwand
Kostensplit im Jahr 2018 (in % vom Umsatz) Kostensplit im Jahr 2018 (in % vom Umsatz)
64,6 % 11,5 % 74,9 % 14,5 %
Personalaufwand Übriger Aufwand Personalaufwand Übriger Aufwand
16,4 % 2,5 %
Medizinischer Bedarf Medizinischer Bedarf
Profitabilitätsmargen im Jahr 2018 Profitabilitätsmargen im Jahr 2018
10,0 %
Zielmarge 8,0 %
Zielmarge
7,5 % 8,2 %
6,0 % 6,2 %
EBITDAR- EBITDA- EBITDAR- EBITDA-
Marge Marge Marge Marge
2 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Inhalt
Zum Auftakt 5 Neue Kennzahlen im Spitalbau 35
Spitäler werden Eigentümer der Immobilien 36
Exkurs: Mehrwertsteuer bei Spitalneubauten 37
Teil I: Finanzielle Entwicklung des Exkurs: Auslagerung der Immobilien
Schweizer Gesundheitswesens 6 von Swiss Medical Network 38
In der Schweiz werden 10 bis 20 Mrd. CHF für die
Akutspitäler stehen
Finanzierung von Spitalbauvorhaben benötigt 39
unter wirtschaftlichen Spannungen 7
Anhaltend hohes Interesse an Spitalanleihen 39
Ambulanter Spitalmarkt wächst überproportional 8
Exkurs: Spitalanleihe des Kantonsspitals Winterthur 40
Ambulante Vergütung in Spitalstrukturen nicht
kostendeckend 9 Exkurs: Innovative Fremdkapitalbeschaffung
mit Loanboox 40
Exkurs: Ambulant operieren in der Eulachklinik
in Winterthur 10 Die Entwicklung der Z-Spreads 41
Kosten wachsen schneller als Umsätze 12 Zinsabsicherung erwägen 41
Exkurs: Sachaufwand optimieren 14 Future of Finance – der Weg zum
Mit Effizienzmassnahmen zu konstanter Profitabilität 15 weitsichtigen Businesspartner 42
10-Prozent-EBITDAR-Zielmarge selten erreicht 16 Die Finanzabteilung hat sich professionalisiert 42
Exkurs: Systematische Effizienzsteigerung 17 Erwartungen von Verwaltungsrat und Management
Spitäler brauchen ihr Eigenkapital auf 18 unerfüllt 43
Ökonomische und regulatorische Ansprüche steigen 19 Von der Finanzabteilung zum strategischen Partner 45
Exkurs: Zukunftsfähige Gesundheitsversorgung Erfolgreich transformieren 46
für Deutschland 20 Pilotprojekt RPA: Wie der Roboter bei der Qualität
von Patientenstammdaten hilft 49
Psychiatrien agieren nachhaltig profitabel 21
TARPSY-Einführung gelungen 21
Rückläufiger Personalkostenanteil 22 Teil III: Das Wichtigste auf den
Profitabilität auf nachhaltigem Niveau 22 Punkt gebracht 51
Gesunde Eigenkapitalquoten 23
Entwicklung und zukünftige Gestaltung
Ambulante Psychiatrie als Wachstumstreiber 24 des Schweizer Gesundheitswesens 52
Fachkräfte dringend benötigt 25
Zwischen Spezialisierung und regionaler Versorgung 25
Schlüsseltreiber Netzwerkbildung, Personalgewinnung,
Anhang 54
Ambulantisierung 26 Stichprobe 54
Median- und Durchschnittswerte 55
Rehabilitationseinrichtungen sind nicht
Quellenverzeichnis 55
genug profitabel 27
Kennzahlen 55
Pflegemarkt konsolidiert und schafft neue Endnotenverzeichnis 56
Leistungsangebote 30 Abbildungsverzeichnis 57
Regionale Überkapazitäten, grosses Marktpotenzial 30 Abkürzungen und Glossar 58
Nachfrageentwicklung geprägt durch Babyboomer 31
«Ambulant vor stationär» auch in der Alterspflege 32
Unsere Studien 60
Teil II: Investitionsentwicklung und
Kontakte 62
Finanzfunktion der Zukunft 33
Investitionsbedarf und Finanzierung 34
Hohe Investitionen in Spitalinfrastruktur erwartet 34
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 3Die Trendwende
im Schweizer
Gesundheitswesen
ist eingetroffen
44 | | Schweizer
SchweizerSpitäler:Spitäler: So gesund
So gesund waren die Finanzenwaren
2018 die Finanzen 2018Zum Auftakt
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Diskussionen über regionale sowie überkantonale Versorgungsstrukturen und -netzwerke intensivieren sich. Einige
Vorreiter setzen neue Modelle um. Diese Spitäler begegnen der sich ändernden Nachfrage mit klaren, zeitnahen
Leistungsanpassungen und bauen Überkapazitäten ab. Das infrastrukturelle Aufrüsten gehört unserer Meinung nach
schon bald der Vergangenheit an. Das stationäre und ambulante Umsatzwachstum war 2018 vergleichsweise beschei-
den; gerade im ambulanten Bereich hat der Tarifeingriff des Bundesrats Spuren hinterlassen. Das Porträt der finan-
ziellen Gesundheit von Schweizer Spitälern im Jahr 2018 ergänzen wir seit 2011 nun um die achte Ausgabe. In dieser
wagen wir erneut einen Blick in die Zukunft.
2019 sind wir von PwC eine exklusive Kooperation mit dem Verein SpitalBenchmark eingegangen. Damit beziehen
wir die aufschlussreichen Daten vom Verein SpitalBenchmark erstmals in unsere Betrachtungen ein und teilen unsere
Erkenntnisse mit Ihnen.
Die diesjährige Studie legen wir für Sie in drei Hauptkapiteln aus:
In Teil I stellen wir die Finanzkennzahlen für die Akutsomatik, Psychiatrie, Rehabilitation und Pflege dar und verdeut-
lichen wie sich deren finanzielle Gesundheit 2018 entwickelt hat. Auf der Grundlage einer holistischen Perspektive
gehen wir detailliert auf zukünftige Auswirkungen ein. Die Daten des Vereins SpitalBenchmark erlauben eine vertiefte
Betrachtung weit über die Analyse der publizierten Geschäftsberichte hinaus. Damit erhöhen wir gemeinsam mit dem
Verein SpitalBenchmark die Transparenz im Schweizer Gesundheitswesen.
• In der Akutsomatik ist der Margendruck erneut gestiegen, was angesichts des Tarifeingriffs im ambulanten Bereich
nicht überrascht. Nur wenige Institutionen erreichen die definierte EBITDAR-Zielmarge von 10,0 Prozent. Einige
Spitäler weisen ein bedrohlich tiefes Eigenkapitalniveau aus. Gewisse Spitäler werden daher finanzielle Sanierungen
und Restrukturierungen angehen müssen – oder haben bereits damit begonnen.
• Schliesslich erläutern wir die finanziellen Entwicklungen und Aufgaben der Psychiatrie, Rehabilitation und Alters-
und Pflegeheime. Sie alle müssen sich den Herausforderungen einer effizienten, kostenoptimalen, qualitativ hoch-
stehenden Leistungserbringung stellen. Die Schlüsselfragen, die hier anzupacken sind die Pflegefinanzierung oder
die Auswirkung der neuen Tarifstrukturen in Psychiatrie und Rehabilitation.
In Teil II befassen wir uns mit Investitionen und Finanzierungsfragen sowie mit der Zukunft der Finanzfunktion. In Zeiten
geringer Eigenfinanzierungsmöglichkeiten gewinnen Investitionsentscheidungen an Bedeutung. In diesem Kapitel be-
handeln wir bestehende Investitionsvolumen, Kennzahlen im Spitalbau und Finanzierungsfragen im Negativzinsumfeld.
Mit dem wirtschaftlichen Druck ist auch die Finanzfunktion immer stärker gefragt. Unter dem Motto Future of Finance
zeigen wir auf, wie der CFO mit einer optimalen Struktur der Finanzfunktion, effizienten digitalen Prozessen und gut
ausgebildeten Mitarbeitenden seine Abteilung zum strategischen Businesspartner avanciert. Dazu sprechen wir über
ein Pilotprojekt des Universitätsspitals Basel im Bereich Robotic Process Automation (RPA).
Mit einer kurzen Tour d’Horizon in Teil III runden wir unsere Einschätzungen ab.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und zahlreiche nützliche Denkanstösse.
Patrick Schwendener Philip Sommer
Director Partner
Leiter Deals Gesundheitswesen Leiter Beratung Gesundheitswesen
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 5Teil I Finanzielle Entwicklung des Schweizer Gesundheitswesens «Der Kostendruck im Gesundheitswesen fördert neue Geschäfts- und Versorgungsmodelle durch Kooperationen, Joint Ventures oder Fusionen. Dafür benötigt das Spitalmanagement und insbesondere der CFO zunehmend M&A-Kompetenzen.» Dr. Serge Altmann, Group CEO, RehaClinic 6 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018
Akutspitäler stehen
unter wirtschaftlichen
Spannungen
Das Jahr 2018 war in vielerlei Hinsicht bewegend. Einen Spitäler benötigen Geld für die Modernisierung ihrer Infra-
grossen Einfluss auf die Finanzen der Spitäler hatte der struktur und die Digitalisierung. Mit solchen Investitionen
bundesrätliche Tarifeingriff auf die Abrechnung von ambu- stellen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicher,
lanten ärztlichen Leistungen. Der neue TARMED 1.09 trat vorausgesetzt, die Finanzierung ist nachhaltig tragbar. Im
am 1. Januar 2018 in Kraft. Er beeinflusste die Wirtschaft- Negativzinsumfeld verbesserten sich die Fremdkapital-
lichkeit der Leistungserbringer insgesamt negativ. Diese konditionen für die Kapitalnehmer erneut. Für den einzel-
haben mit Effizienzsteigerungsmassnahmen reagiert – und nen Leistungserbringer mag das erfreulich sein. Aus der
passen spitalambulante Prozesse und Strukturen konse- Gesamtperspektive heraus ist dieser Umstand kritisch
quent an. zu beurteilen. Die rekordtiefen Finanzierungskonditionen
zeigen, dass die impliziten Garantien im öffentlichen
Viele Spitäler stehen also vor der Aufgabe, ihre Leistungs- Bereich die Risikoeinschätzung dominieren, nicht nur bei
erbringung fundamental zu überdenken; sei es mit einem systemrelevanten Akteuren.
klareren Fokus, Kooperationen oder dem Verzicht auf
gewisse Angebote. Die Strategien der Vergangenheit des
gezielten Ausbaus von Angeboten stehen nicht mehr so
stark im Vordergrund. Die meisten Leistungserbringer
verfehlen nach wie vor den postulierten Richtwert für die
EBITDAR-Marge von 10,0 Prozent. Gerade kleine Spitäler
kämpfen mit hohen Fixkosten und kommen in Bedräng-
nis. Flankierend zu strategischen Strukturentscheidungen
werden zunehmend systematische Effizienzprogramme
erarbeitet und umgesetzt. Kooperation für
mehr Transparenz
In unserer letztjährigen Studienausgabe1 präsentierten wir
die Idee von regional abgestuften Versorgungsnetzwerken PwC Schweiz hat mit dem Verein Spital-
mit einer stationären Konzentration bei einer geringeren Benchmark eine exklusive Zusammenarbeit ver-
Anzahl hochinstallierter Leistungserbringer. Dieses Modell einbart. Der Verein SpitalBenchmark vertritt öffent-
wurde kontrovers diskutiert, interessanterweise sogar im lich-rechtliche und private Leistungserbringer der
benachbarten Ausland wie zum Beispiel in Deutschland. Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation. Das Ziel
Im Kanton St. Gallen unterstützen wir die Spitalverbunde des Vereins ist es, betriebliche Daten der Vereins-
zurzeit darin, die Spitalversorgung zukünftsfähig aus- mitglieder objektiv vergleichbar aufzubereiten, zu
zugestalten. Insgesamt fünf der heute neun stationären analysieren und den Mitgliedern zugänglich zu
Standorte sollen in Gesundheits- und Notfallzentren um- machen. Mit dieser Transparenz sollen die Mitglieder
gewandelt werden. ihre eigene Kostenstruktur und Abläufe optimieren
können. Im Rahmen unserer Kooperation wollen wir
die jährlich vermittelten Daten noch differenzierter
auswerten. So können wir wesentliche und repräsen-
tative Aussagen über den Gesundheitsmarkt Schweiz
treffen und diese mit weiteren Interessengruppen
teilen. Erste Erkenntnisse sind in der vorliegenden
Publikation enthalten. Weitere Spezialanalysen von
SpitalBenchmark-Daten werden folgen.
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 7Ambulanter Spitalmarkt wächst diesem Jahr stiegen sowohl die stationären Fallzahlen
überproportional als auch die Umsätze der 44 untersuchten Akutspitäler im
Median um rund 0,6 Prozent beziehungsweise 1,9 Prozent
Nach der Einführung des DRG-Systems im Jahr 2012 an. Die Wachstumsrate liegt unter dem Medianwert der
stiegen die stationären Umsätze jährlich an. Das Null- Jahre 2012 bis 2017 von 2,8 Prozent. Massgebend dafür
wachstum von 2017 markiert für uns den Beginn stagnie- sind die Bevölkerungszunahme der Schweiz (2018: +0,7
render bis nur noch leicht steigender stationärer Fallzah- Prozent) und das Wachstum der Altersgruppe 65+ (+1,8
len. Mittelfristig werden die Dynamik der Alterspyramide Prozent).4 Die merklich steigenden stationären Umsätze
und die Zuwanderung ein gewisses Wachstum begüns- bestätigen die Annahme, dass die Fallschwere im sta-
tigen; wir schätzen dieses auf jährlich rund 1,1 Prozent tionären Bereich zunimmt – unter anderem als Folge der
bis 2030.2 Bei kleinen Spitälern waren die Fallzahlen 2017 Ambulantisierung. Bei unseren Studienspitälern zeigt sich
im Median negativ. 2018 stellt sich erneut ein gewisses eine konstante bis leicht steigende Fallschwere, gemes-
Wachstum ein, unabhängig von der Spitalgrösse.3 In sen als Case-Mix-Index (CMI).
Umsatzwachstum Akutspitäler
2,9 % 3,7 % 4,0 % 1,5 % 1,8 %
8,8 %
5,7 %
4,6 %
3,9 %
3,0 %
2,7 %
1,9 %
1,7 %
(0,0 %) 1,2 %
2014 2015 2016 2017 2018
Ambulantes Wachstum Stationäres Wachstum Umsatzwachstum
Abbildung 1: Umsatzwachstum der Schweizer Akutsomatik, aufgeteilt nach ambulanten und stationären Erträgen (Medianwerte)
Vergleich mit den SpitalBenchmark-Daten
Die Beurteilung der Daten des Vereins SpitalBenchmark stützt unsere obigen Aussagen.5 Im stationären
Bereich beläuft sich das Umsatzwachstum 2018 auf 1,9 Prozent. Während sich die Fallzahlen im sta-
tionären Bereich um 0,6 Prozent erhöhten, schlug der CMI um 1,0 Prozent auf. Das Wachstum der Fall-
zahlen ist hauptsächlich den Altersgruppen 65–80 und 80+ zuzuschreiben. Hier zeigt sich die grösste
Bevölkerungsveränderung im Vergleich zum Vorjahr. In den Alters-
gruppen 10–64 verringerte sich die Anzahl Fälle, obschon die Bevölkerung auch hier
leicht gewachsen ist. Wir werten das als Fortsetzung der Verlagerung von stationär Umsatz-
zu ambulant. Das Besondere: Die erhöhten stationären Fallzahlen gehen auf eine wachstum +1,9 %
Zunahme von Patienten zurück, die im Ausland wohnen. Bei den Inländern sind die Fallzahlen +0,6 %
DRG-Fälle trotz Bevölkerungszunahme zurückgegangen. Der Zusatzertrag der halb- (Bevölkerung +0,7 %)
privat und privat Versicherten hat sich um rund 0,1 Prozent reduziert und es fand
eine Verringerung des Erlöses um 0,2 Prozent statt. Insgesamt ist die durchschnitt- CMI-Erhöhung +1,0 %
liche Verweildauer 2018 um 1,8 Prozent auf 5.5 Tage gesunken. In der Deutsch-
schweiz liegt diese noch immer klar tiefer als in der französischen und italienischen Reduktion HP/P-
Entgelte -0,1 %
Schweiz, obwohl sich die Abstände verringert haben.
8 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Wie erwartet verlangsamte sich im ambulanten Bereich Der Median des Umsatzwachstums von Spitälern mit
insbesondere wegen des Tarifeingriffs des Bundesrats im über 250 Betten ist im ambulanten Bereich im Vergleich
Jahr 2018 das Umsatzwachstum. 2018 lag es bei 1,2 Pro- mit den kleineren Häusern unterdurchschnittlich ge-
zent, 2017 legte es 4,6 Prozent zu. Das Mengenwachstum wachsen. Das gegenteilige Bild zeigt sich im stationären
dürfte sich auf Vorjahresniveau bewegen. Die positive Bereich, wo die grösseren Spitäler ein vergleichsweise
Entwicklung beim Umsatz wurde teilweise durch den überdurchschnittliches Wachstum verzeichneten. Diese
Tarifeffekt neutralisiert. Die angepeilte Verlagerung vom Dynamik wird sich in Abhängigkeit der Grösse fortset-
stationären in den ambulanten Bereich schreitet dennoch zen. Die vorliegenden Wachstumsraten können mangels
voran. Auch die Zahlen des SpitalBenchmarks zeigen ein Daten einzelner Spitäler Verzerrungen aufweisen.
klares Wachstum der ambulanten Erträge, wenn auch
tiefer als in den Vorjahren.
Umsatzwachstum nach Grösse
2,5 %
2,1 %
1,9 % 1,9 % 1,8 %
1,7 % 1,7 %
1,1 % 1,2%
≤ 250 Betten > 250 Betten Alle Spitäler
Median ambulantes Wachstum Median stationäres Wachstum Median Umsatzwachstum
Abbildung 2: Umsatzwachstum (2018) in der Schweizer Akutsomatik nach Anzahl Betten
Ambulante Vergütung in Spital- Die Leistungserbringung und somit die Spitäler werden
strukturen nicht kostendeckend immer ambulanter. Damit Akutspitäler für die ambulante
Zukunft fit bleiben, benötigen sie neue Betriebsmodelle
Seit unserer Studie «Ambulant vor stationär: Oder wie für eine effiziente ambulante Leistungserbringung. Die
sich Milliarden Franken jährlich einsparen lassen» im Infrastruktur muss zweckmässig und kostengünstig sein.
Jahr 2016 hat die Ambulantisierung an Tempo zugelegt.6 Die sonstigen Vorhaltekosten fallen in einer ambulanten
Kantone und Bund haben Listen in Kraft gesetzt, die Umgebung um einiges geringer aus. Wo immer möglich
ambulant durchzuführende Eingriffe vorschreiben. müssen die Spitäler vermeidbare Kosten abbauen und
Gleichzeitig wurden wesentliche Fehlanreize nicht be- Personalressourcen teilen. Sie sollten vermehrt Operations-
seitigt oder sogar verschärft. Das behindert eine konse- säle für ambulante Eingriffe einrichten – je nach Grösse
quente und medizinisch sinnvolle Ambulantisierung. des Spitals eher in Kooperation mit anderen Partnern
Ein Grossteil der spitalambulanten Leistungen wird nach (kleinere Häuser) oder alleine (grössere Häuser mit ent-
wie vor nicht kostendeckend entschädigt. Es bestehen sprechender Kapazität).7
deutliche Unterschiede im Taxpunktwert zwischen den
Kantonen. Zudem wurden die von uns angeregten ambu- Die Spitäler sollten daher neue ambulante Geschäfts-
lanten Pauschalen noch nicht flächendeckend eingeführt, modelle etablieren, um trotz Ambulantisierung und wirt-
trotz interessanter Aktivitäten von SwissDRG, Santésuisse schaftlich enger Tarifstrukturen qualitativ hochstehende
und FMCH in den letzten Jahren. Leistungen zu erbringen. Wie ein ambulantes Setting mit
langfristig kostendeckender Leistungserbringung aus-
sehen könnte, erfahren Sie im folgenden Exkurs.
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 9Exkurs: Ambulant operieren
in der Eulachklinik in
Winterthur
Die Eulachklinik in Winterthur stellt ein gutes
Beispiel einer sowohl wirtschaftlich als auch Gründung und Besitz:
operativ gut funktionierenden ambulanten Ko-Gründung der Eulachklinik in
Einrichtung dar. Sie hat sich als ambulantes 2012 durch die NSN Medical AG
Zentrum einen Namen gemacht. und Winterthurer Fachärzte
Ramona Engel, Centerleiterin der Eulach- OP-Säle: 2
klinik, hält die Mitarbeitenden für einen
erheblichen Erfolgsfaktor. Denn deren Ver- Kapazitäten:
ständnis und Eigeninitiative in der ambu- 2 Operationssäle werden pro
lanten Leistungserbringung sind essenziell. Woche an drei Wochentagen
Die ambulanten Arbeitsabläufe und die betrieben (je nach Auslastung)
Arbeitsweise der Mitarbeitenden sind für eine
effiziente Leistungserbringung entscheidend. Leistungsspektrum:
Die ärztliche Leitung und Mitarbeitende mit 10 Disziplinen
Erfahrung leiten die täglichen Prozesse – in
der Eulachklinik sind das Anästhesisten und Stationär:
Anästhesiepflegekräfte und das OP-Personal. In Ausnahmefällen können
Eine tiefe Fluktuation – bedingt durch attrakti- Selbstzahler (ohne Spitallistenplatz)
ve Arbeitsbedingungen und Gestaltungsspiel- übernachten.
Ramona Engel, Centerleiterin der Eulachklinik
räume – sowie ein hohes Verantwortungs- Infrastrukturelle Betten: 3
bewusstsein und unternehmerisches Handeln
unterstützen die reibungslosen Abläufe in der Investitionen:
Eulachklinik. Dazu Ramona Engel: «Die Be- Circa 4 Mio. CHF in Infrastruktur
legärzte schätzen unsere raschen Abläufe.» (2012)
Qualität und Effizienz sind das A und O der Umsatz: 4.2 Mio. CHF (2018)
Leistungserbringung. Ramona Engel ist
überzeugt, dass zufriedene Patienten und Festangestellte:
zufriedene Belegärzte einen effizienten 200 Prozent OP-Pflege,
Ablauf fördern. Einen solchen stellt ein 80 Prozent Empfang
erfahrenes Team von Anästhesisten der
narkose.ch sicher. Narkose.ch ermöglicht
zusätzlich Flexibilität bei Nachfrage-
schwankungen.
Die Eulachklinik hat zwar in den Patienten- Erfolgsrelevante Kriterien wie flexible Infra-
zahlen einen Schwerpunkt in der Ophthalmo- strukturen, effiziente Prozesse oder ein
«Die Belegärzte schätzen logie, doch sie zeigt auch, dass ein breites auf ambulante Leistungen ausgerichtetes
unsere raschen Abläufe.» Behandlungsspektrum mit unterschiedlichen
Belegärzten möglich ist. Ein ambulantes OP-
Betriebsmodell stellen die Verantwortlichen
schon an sich vor eine anspruchsvolle
Zentrum kann nur mit einer schlanken Infra- Aufgabe. Zusätzlich ist es entscheidend,
struktur und kurzen Wegen effizient arbeiten. dass die medizinische Qualität allerhöchs-
«Für die Effizienz sind zwei bis maximal fünf ten Ansprüchen genügen muss. Zusätzlich
Säle für ein ambulantes OP-Zentrum aus legt die Eulachklinik Wert darauf, dass der
meiner Sicht optimal», so Ramona Engel. Patient die effizienten Abläufe nicht als
Gemäss der Centerleiterin ist die minimale Fliessbandleistung empfindet, sondern
Betriebsgrösse nicht pauschal bestimmbar, sich in der kurzen Aufenthaltsdauer durch
sondern abhängig von Leistungsangebot, die professionelle und sehr persönliche
Auslastung und Prozesseffizienz. Dazu Organisation gut betreut fühlt. Das Thema
Engel: «Der Break-even für ein ambulantes ambulante OP-Zentren ist derzeit omni-
OP-Zentrum kann bei effizienter Leistungs- präsent. Auch die akutsomatischen Spitäler
erbringung und schlanken Strukturen schon prüfen Investitionen in ambulante Strukturen
bei 2000 bis 2500 Behandlungen mit zwei oder haben bereits darin investiert. Aufgrund
OP-Sälen liegen.» ihrer organisatorischen Komplexität ist eine
10 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018nicht-steriler Bereich
steriler Bereich
Aufwachraum Empfang
Schleuse
Aufenthalt
OP-Personal
Umkleide
Personal Wartebereich
OP2/OP3 OP1
Technik
Logistik Sterilgut und Sterilgutlager
Aufenthalt
Personal
Technik und Patienten- Patienten-
Büro
Lüftungsanlage zimmer zimmer
Abbildung 3: Schematischer Bauplan der Eulachklinik zeigt eine auf Effizienz ausgerichtete Infrastruktur
effiziente ambulante Leistungserbringung für • Vollständig getrennte Infrastruktur, die • Gute Patientenselektion und weitsichtiges
sie jedoch noch anspruchsvoller. Der Betrieb auf die effiziente Leistungserbringung Risikomanagement für alle gültigen
eines ambulanten OP-Zentrums innerhalb ausgerichtet wird Standards und Behandlungspfade
eines Spitals ist nur mit klar dedizierten
• Selbstständige Organisation, die Entschei- • Wirksame Zusammenarbeit mit nieder-
Strukturen und einem hochflexiblen Mitarbei-
dungen rasch und eigenständig umsetzt gelassenen Ärzten
terteam realisierbar.
• OP-Mitarbeitende und Anästhesisten, • Anbindung an einen zentralen Einkauf
Aus dem Beispiel der Eulachklinik und aus die hauptsächlich oder ausschliesslich im und eine optimierte Lagerbewirtschaftung
unserer Erfahrung leiten wir die folgenden ambulanten Geschäft arbeiten und sich
• Administration, die auf eine ambulante
Faktoren für mehr Effizienz in der ambulan- darauf spezialisiert haben
Leistungsabrechnung spezialisiert ist
ten Leistungserbringung ab:
• Innovative Führungsstruktur (z. B. die
Leitung durch OP-Mitarbeitende und
Anästhesisten) und Unabhängigkeit vom
stationären Bereich, um fachübergreifende
Effizienz zu garantieren
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 11Kosten wachsen schneller Viele Spitäler setzen Ergebnisverbesserungsprogramme
als Umsätze um oder leiten solche ein. Zudem zeigen strukturelle
Angebotsanpassungen Wirkung. Aus einer PwC-Unter-
2018 lag das Umsatz- und Kostenwachstum auf einem suchung gehen jährliche Effizienzsteigerungen über
ähnlichen Niveau wie im Vorjahr: Der Umsatz wuchs die letzten Jahre von etwa 0,5 Prozent hervor. Vor dem
im Median um 1,8 Prozent, die Kosten um 2,0 Prozent. aktuellen Hintergrund haben die so erzielten Effizienzvor-
Das entspricht einem Verhältnis von Ertrags- zu Kosten- teile die Margen bestenfalls stabilisiert, nicht aber erhöht.
wachstum von 0,94. Entsprechend haben sich die Die Schweizer Spitäler müssen ihre Betriebsabläufe
Margen 2018 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. demnach weiter optimieren und die Kosten noch besser
in den Griff bekommen.
Umsatz- und Kostenwachstumsraten
0,85 0,98 0,94 0,61 0,94
4,3 %
4,0 %
3,7 % 3,7 %
3,4 %
2,9 %
2,4 %
1,8 % 2,0 %
1,5 %
2014 2015 2016 2017 2018
Umsatzwachstum Wachstum Personal- und Sachaufwand Ratio Ertrags- zu Kostenwachstum
Abbildung 4: Wachstum von Kosten und Umsatz bei Schweizer Akutspitälern (Medianwerte)
Die Kostenstruktur zeichnet ein ähnliches Bild wie im Sach- und geringerem Personalkosteneinsatz verbunden.
Vorjahr. Die Personalkosten bilden weiterhin den grössten Ausserdem wirken kleinere Spitäler dem Fachkräfte-
Kostenblock, nämlich zwei Drittel der Gesamtkosten. Im mangel teilweise mit zusätzlichen Lohnanreizen entgegen.
Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 0,1 Prozentpunkte
marginal an. Nach wie vor machen die Personalkosten im Das Verhältnis der Sachkosten (exkl. Anlagenutzungs-
Median bei Leistungserbringern mit weniger als 250 Betten kosten) zum Umsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum
einen höheren Anteil am Umsatz aus als bei grösseren verändert: Der medizinische Bedarf sank in Relation zum
Häusern. Diese weisen in der Tendenz einen höheren Umsatz um 0,3 Prozentpunkte, der übrige Aufwand stieg
CMI aus. Weniger spezialisierte Fälle sind mit höherem um 0,1 Prozent auf 11,5 Prozent.
Kostenentwicklung
7,9 % 8,2 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %
12,0 % 12,1 % 12,5 % 11,4 % 11,5 %
16,2 % 16,1 % 16,4 % 16,7 % 16,4 %
63,9 % 63,6 % 63,6 % 64,5 % 64,6 %
EBITDAR
Übriger Aufwand (exkl. Mieten)
Medizinischer Bedarf
Personalaufwand
2014 2015 2016 2017 2018
Abbildung 5: Kostenentwicklung in Prozent des Umsatzes von 2014 bis 2018
12 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Vergleich mit den SpitalBenchmark-Daten
Mit Hilfe der Daten vom Verein SpitalBenchmark haben wir die Kostenseite weiter ausgeleuchtet.
Die Arztkosten bei einem Fallgewicht von 1,0 und ohne Anlagenutzungskosten sowie Arzthonorare
sind stagniert. Über die letzten vier Jahre bewegten sich diese stets bei rund 2100 CHF pro Fall.
2018 präsentiert sich ein Kostenrückgang von 0,4 Prozent.
Die Einzelkosten für Arzneimittel, Material, Instrumente, Utensilien, Textilien inklusive Gemeinkosten-
zuschlag erhöhten sich nach einer Reduktion im Jahr 2016 ab 2017 wieder. 2018 lag der Wert fast
unverändert bei 1177 CHF pro Fall.
-0,4% 0,8% -0,4%
2104 2095 2112 2103
-2,4% 1,4% 0,1%
1189 1160 1176 1177
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Abbildung 6: Einzelkosten in CHF bei Fallgewicht 1.0 von 2015 bis 2018 Abbildung 7: Arztkosten ohne ANK und Honorare bei Fallgewicht 1.0
(Medianwerte) (Medianwerte)
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 13Exkurs: Sachaufwand
optimieren
Angesichts des zunehmenden wirtschaft- Wir stellen den Eintritt von internatio-
lichen Drucks werden Ergebnisverbesse- nalen Einkaufsgemeinschaften fest.
rungsprogramme immer gefragter. Dabei Wie sehen Sie diese Entwicklung?
steht die Optimierung der Sachkosten in der
Schweiz noch nicht so sehr im Mittelpunkt. International aufgestellte Einkaufsgemein-
Im nahen Ausland hingegen sind sie oft schaften werden in der Schweiz immer ein-
Teil von Optimierungsinitiativen. Zu diesem flussreicher. Die hiesigen Verbünde erreichen
Thema unterhielten wir uns mit Sieglinde in der Regel zu kleine Umsatzvolumina, um
Breinbauer, Leiterin des Bereichs Betrieb am wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Vergleich
Universitätsspital Basel (USB). Sie verant- zum Ausland haben wir bei den Preisen im-
wortet unter anderem die Beschaffung und mer noch ein erhebliches Senkungspotenzial.
Logistik. Zur Wichtigkeit und Entwicklung der
Sachkosten äussert sich Sieglinde Breinbauer Was bedeutet das für ein Spital?
im Gespräch.
Spitäler müssen zunehmend standardisieren.
Frau Breinbauer, welche Bedeutung Persönliche Präferenzen und Spezialwün-
haben für Sie die Sachkosten, wenn sche, die nicht medizinisch begründet sind,
doch zwei Drittel der Kosten der haben keinen Platz mehr. Die Transparenz für
Spitäler auf das Personal entfallen? Entscheidungen steigt markant.
Sieglinde Breinbauer: In der Beschaffung Was kommt sonst noch auf die
Sieglinde Breinbauer, Leiterin des Bereichs stellen wir sicher, dass das Sachmaterial in Beschaffung zu?
Betrieb am Universitätsspital Basel (USB) einer hohen Qualität und Verfügbarkeit wirt-
schaftlich bereitgestellt wird. Der wirtschaft- Neben Optimierungen bei den Preisen bleibt
liche Optimierungsdruck auf die Spitäler es das wichtigste Ziel der Beschaffung, die
nimmt zu. Hier kann die Beschaffung einen Patientinnen und Patienten mit Medizinal-
wesentlichen Beitrag leisten. Jedoch nur, produkten zu versorgen. Durch die neuen
wenn die Verantwortlichen Entscheidungen Regularien steht uns bei manchen Produkt-
treffen und konsequent umsetzen, zum Bei- gruppen eine anspruchsvolle Versorgungssi-
spiel das Sortiment nach medizinischen und tuation bevor. Die Digitalisierung erfasst auch
betriebswirtschaftlichen Kriterien bereinigen. den Spitaleinkauf. Hier müssen wir unsere
Ergebnisbeiträge durch Optimierung des Beschaffungs- und Logistikprozesse wie
Einkaufs gibt es nicht zum Nulltarif. die Stammdatenbeschaffung, die Bestell-
abwicklung oder den strategischen Einkauf
Wie sehen Sie die Zukunft des Spital- stetig optimieren. Nur so bleiben wir auch
einkaufs? in diesem Bereich effizient. Der Einkauf der
«Der wirtschaftliche Spitäler unterliegt aktuell einem enormen
Optimierungsdruck Die Beschaffungseinheit des Spitals gewinnt
an Bedeutung. Die Spitäler professionali-
Veränderungsdruck. Für mich persönlich ist
das ein sehr spannendes Feld, das ich gerne
auf die Spitäler sieren sich im strategischen und operativen mitgestalte.
Einkauf. Hier weiten wir unser Aufgaben-
nimmt zu.» gebiet merklich aus, indem wir nicht nur Frau Breinbauer, vielen Dank für
Verbrauchsmaterial und Gerätschaften ver- das Gespräch.
handeln, sondern auch den Dienstleistungs-
einkauf thematisieren.
14 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Mit Effizienzmassnahmen zu Trotz Megatrends wie der Ambulantisierung, der am-
konstanter Profitabilität bulanten Tarifanpassung, dem Druck auf Zusatzversi-
cherungserträge, den Mindestfallzahlen und anderen ist
die mediane EBITDAR-Marge 2018 gegenüber 2017 bei
7,5 Prozent stabil geblieben. Die Betriebsgewinnmarge
EBITDA blieb mit 6,0 Prozent ebenfalls konstant zum
Historische EBITDAR- und EBITDA-Margen
Vorjahr. Seit drei Jahren reagieren Schweizer Spitäler mit
verschiedenen Massnahmen auf die erwähnten Entwick-
6,0 %
2018 lungen. So halten sie die Margen konstant.
7,5 %
6,0 % Der 2011 von uns definierte und etablierte langfristige
2017
7,5 % Zielwert einer EBITDAR-Marge von 10,0 Prozent wird
5,9 % weiterhin nur von sieben Spitälern aus einer Stichprobe
2016 von 44 Spitälern erreicht. Diese Marge ist notwendig, um
7,5 %
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltig
6,3 % in Infrastruktur, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle
2015
8,2 % und medizinische Innovationen zu investieren. Ob die
6,0 % fehlenden 2,5 Prozentpunkte insbesondere auch durch
2014
7,9 % Effizienzgewinne aus Neubauten erreicht werden, ist un-
Marge in % des Gesamtumsatzes gewiss. Dies hängt unter anderem von der Zweckmässig-
keit der Bauvorhaben ab (vgl. auch Kapitel Investitions-
EBITDA EBITDAR bedarf und Finanzierung). Erste Hinweise auf mögliche
Effizienzverbesserungen wird der laufende Betrieb von
Abbildung 8: EBITDAR- und EBITDA-Entwicklung der Schweizer Akutspitäler neu gebauten Spitälern (wie zum Beispiel demjenigen des
(Medianwerte) Spitals Limmattal) zeigen.
EBITDA- und EBITDAR-Marge nach Grösse
63,5 68,5 66,5 EBITDA je Bett in TCHF
7,3 % 7,5 % 7,5 %
6,4 %
6,0 % 6,0 %
Median EBITDA
Median EBITDAR
≤ 250 Betten > 250 Betten Alle Spitäler
Abbildung 9: EBITDAR- und EBITDA-Margen nach Spitalgrösse
Anders als in den Vorjahren waren kleinere Spitäler 2018 abweichung zum arithmetischen Mittel sowohl bei der
leicht weniger profitabel als Universitäts- und Zentrums- EBITDAR- als auch der EBITDA-Marge seit 2012 konti-
spitäler mit mehr als 250 Betten. Vergleicht man deren nuierlich. Vor einigen Jahren prognostizierten wir, dass
EBITDAR-Margen von 2018, so erreichen Spitäler mit die Margenunterschiede zwischen den wirtschaftlich
mehr als 250 Betten eine im Median marginal höhere besten und schlechtesten Spitälern grösser würden. In
EBITDAR-Marge von 7,5 Prozent gegenüber 7,3 Prozent dieser Logik müsste die Standardabweichung zunehmen.
bei den Spitälern mit 250 und weniger Betten. Das Streu- Dass dem nicht so ist, liegt vermutlich unter anderem
ungsmass, das eine Grösse zur Messung der Abweichun- in offenen oder verdeckten Finanzierungen (z. B. gross-
gen vom Median darstellt, hat sich bei Spitälern beider zügig bemessene gemeinwirtschaftliche Leistungen) von
Grössenkategorien wie in den Vorjahren weiter verringert. Spitälern in wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch deren
In unserer Stichprobe verkleinert sich die Standard- Eigner begründet.
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 15Die Annäherung der Margen ist zudem Ausdruck davon, Margenunterschiede nach Spitalgrösse
dass die Spitäler mit Effizienzprogrammen eine Stabilisie-
rung der Profitabilität erreichen. Grössere bevorstehende
Ereignisse wie Tarif- oder Finanzierungsänderungen,
eine weitergehende Ambulantisierung, neue Geschäfts-
modelle oder die Inbetriebnahme von grossen Neubau-
0,99 %
projekten werden unserer Meinung nach dazu führen, 1,93%
dass die Streuung der Ergebnisse in den nächsten Jahren 2,00 %
2,40 % 1,91 % 1,32 %
zunimmt. Angesichts der bedrängten Margen sollten 2,19 %
Spitäler jeder Grösse mit Effizienzmassnahmen ihre wirt- 2,94 %
schaftliche Situation nachhaltig sichern.
Abbildung 10 belegt, dass die Profitabilität besonders
EBITDAR EBITDAR EBITDA EBITDA
bei kleinen Spitälern stark variiert. Eine naheliegende ≤ 250 > 250 ≤ 250 > 250
Erklärung wäre, dass spezialisierte kleinere Kliniken mit Betten Betten Betten Betten
optimierten Prozessen erfolgreich sind, während kleine
Spitäler mit dem Ansatz einer umfassenden (Grund-)- Abbildung 10: EBITDAR- und EBITDA-Marge nach Bettenzahl im Jahr 2018
Versorgung und einem breiten Portfolio eher unrentabler (Medianwerte, zweites Quartil in Hellorange, drittes Quartil in Dunkelorange)
arbeiten. Die grossen Spitäler schneiden erstmals
besser ab. Ob sich darin bereits erste realisierte Vorteile
aus von uns vorgeschlagenen Hub-and-Spoke-Struktu-
ren abzeichnen, bleibt abzuwarten.8
10-Prozent-EBITDAR-Zielmarge
selten erreicht
2018 erreichten 7 Spitäler eine EBITDAR-Marge von
über 10 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 9 Spitäler.
Während 2017 noch 17 Spitäler 8 Prozent Marge und
mehr erzielten, waren es 2018 Jahr nur noch 15 Spitäler.
12 Spitälern gelang es nicht, eine EBITDAR-Marge von
mindestens 5 Prozent zu erwirtschaften; im Vorjahr waren
es 7. Hierbei gilt es anzumerken, dass Spitäler zwischen Historische EBIT- und Reingewinn-Margen
den Ergebniskategorien wechselten.
0,6 %
2018
Die EBITDAR- und EBITDA-Marge blieben gegenüber 1,1 %
2017 konstant. Hingegen nahmen die EBIT- sowie die
Reingewinn-Marge um 0,1 respektive 0,3 Prozent ab. 0,9 %
2017
1,2 %
Insgesamt fiel die EBIT-Marge verteilt über die letzten
5 Jahre um über die Hälfte (von 2,3 Prozent in 2013 auf 1,1 %
2016
1,1 Prozent in 2018). Die Eigenkapitalquote sank ebenfalls 1,3 %
stetig. Das lässt sich teilweise durch negative Resultate
1,2 %
oder tiefe Margen sowie durch die Ausgabe von Spital- 2015
1,5 %
anleihen erklären.
0,9 %
2014
2,0 %
Marge in % des Gesamtumsatzes
Reingewinn EBIT
Abbildung 11: EBIT- und Reingewinn-Entwicklung der Schweizer Akutspitäler
(Medianwerte)
16 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Exkurs: Systematische
Effizienzsteigerung
Effizienzsteigerungsprogramme sind ein Beim Vorgehen greifen die Institutionen medizinisch-pflegerische Qualität mindestens
nützliches Instrument, um die Unternehmens- häufig auf einen Best-Practice-Ansatz wie in auf dem bestehenden Niveau sichergestellt.
effizienz systematisch zu steigern. Abbildung 12 dargestellt zurück. Dieser unter- Oft ergeben sich aus verbesserten organisa-
Die Spitäler lancieren sie meistens in den scheidet zwischen zwei wesentlichen Phasen: torischen Abläufen Vorteile für die medizi-
folgenden Situationen: In der Diagnostikphase wird das Spital auf nisch-pflegerische Behandlung. Effizienz-
Herz und Nieren geprüft. Vergleiche mit programme setzen bei allen wesentlichen
• Langjährige unzureichende Profitabilität
anderen Spitälern helfen bei der Einordnung klinischen Leistungen und Supportdiensten an
(EBITDARSpitäler brauchen ihr Eigen-
kapital auf
Die Eigenkapitalquote der Studienspitäler sank im Median Eigenkapitalquote
in den letzten fünf Jahren kontinuierlich und lag 2018 bei
42,8 Prozent. In unseren Vorgängerstudien bezeichneten 49,3 % 48,3 %
45,5 % 44,7 %
wir eine Eigenkapitalquote von 40 Prozent als gut. Sollte 42,8 %
sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen, wird
dieser Wert mit den Abschlüssen 2019, 2020 oder 2021
unterschritten. Die Spannweite der Eigenkapitalquoten ist
relativ gross und korreliert nicht mit der Betriebsgrösse.
50 Prozent der untersuchten Spitäler liegen innerhalb
einer Bandbreite von 33 bis 56 Prozent, das heisst je ein
2014 2015 2016 2017 2018
Viertel darüber und darunter. Bei Letzteren verschlechter-
te die niedrige Eigenkapitalquote die Verschuldungs-
kapazität. Unsere Betrachtungen enthalten keine implizi- Abbildung 13: Eigenkapitalquoten der Schweizer Akutspitäler von 2014 bis 2018
ten Garantien durch Eigner. Im Extremfall gefährdet eine (Medianwerte)
fehlende Verschuldungskapazität Infrastrukturprojekte
und Investitionen in die Digitalisierung. Solche sind
für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit dringend
notwendig.
Wesentliche Ursache für die sinkenden Eigenkapitalquoten
sehen wir in der unterdurchschnittlichen Profitabilität der
Spitäler (vgl. S. 16). Die Refinanzierung der Investitions-
kosten ist beim Durchschnitt nicht gesichert und damit
ökonomisch nicht nachhaltig.
18 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Ökonomische und regulatorische weniger Standorten. Parallel dazu werden systematische
Ansprüche steigen operative Effizienzprogramme immer bedeutsamer.
Abbildung 14 stellt die erwartete zukünftige Entwicklung
Viele Spitäler und Kliniken befinden sich in einer kont- des Vergütungssystems der Akutspitäler und dessen
roversen Situation: Einerseits sollen sie qualitativ hoch- Wirkung auf selbige dar.
wertige, breite Angebote an teilweise unterschiedlichen
Standorten aufrechterhalten. Andererseits müssen sie Unmittelbar wird versucht, durch zusätzliche Regulierungen
ihre Wirtschaftlichkeit deutlich erhöhen. Durch die Ein- (z. B. Mindestfallzahlen, Globalbudgets, mengeninverse
führung von Mindestfallzahlen werden besonders kleine Vergütungen, ambulante Listen, Einschränkung Leis-
Spitäler strategische Anpassungen vornehmen müssen. tungsumfang) die Fehlwirkungen auf die Leistungserbrin-
Zudem ist unklar, wie sich die sektorale Abgrenzung in ger zu korrigieren. Langfristig sind neue Anreizsysteme
den nächsten Jahren verändert. Der Bund wird voraus- auf Basis neuer Versorgungsstrukturen denkbar. Diese
sichtlich die Liste ambulant durchzuführender Eingriffe in stellen Qualität im Sinne des Outcome der Patienten ins
den nächsten Jahren erweitern. Die Investitionen in den Zentrum und prüfen diese.
Aufbau ambulanter Zentren und den Aus- und Aufbau
ambulanter Leistungen bestärken den Trend nach mehr In unserer letztjährigen Studie9 haben wir die Diskussion
ambulanten Eingriffen. über eine stärkere Ausrichtung an der Qualität ange-
stossen. Diesen Diskurs führt die Branche angeregt fort.
Eine nicht nachhaltige Profitabilität stellt die Leistungser- Nicht nur die grossen Leistungserbringer, sondern auch
bringer vor die Frage, wie sie die anstehenden Investiti- Medizintechnik- und Pharmahersteller sowie Krankenver-
onsvorhaben langfristig finanzieren sollen. Erweiterungs- sicherungen positionieren sich mehr und mehr im Thema
bauten, Neubauten oder grosszyklische Sanierungen im Value-based Healthcare. Mit einem Whitepaper10 haben
Hinblick auf den verschärften Wettbewerb gelten nicht wir 2019 einen konkreten Vorschlag unterbreitet. Gut
mehr als einziges Mittel zur Sicherung der Wettbewerbs- möglich, dass die Branche solche Ansätze in den nächs-
fähigkeit. In Zukunft geht es um Investitionen in Daten, ten Jahren verstärkt aufgreift.
Prozesse und IT sowie in neue Betriebsmodelle. Gleich-
zeitig konzentrieren sich die stationären Leistungen an
Neues
Anreizsystem
DRG-System DRG-System mit in veränderten
(Vergangenheit erhöhter Regulierung Versorgungs-
bis heute) (nahe Zukunft) strukturen
– Reduktion von – Erhöhte Transparenz – Qualität und volkswirt-
Verweildauern – Reduktion der schaftlicher Impact als
– Erhöhung der Vergütung je Leistung Vergütungskriterium
Effizienz – Kostendruck – Konzentrations-
– Mengenausweitung prozess weitgehend
– Strukturbereinigungen
zur Auslastung abgeschlossen
Spitallandschaft
der Kapazitäten – Bildung von interkanto-
– Ambulanter Sektor
– Optimierung der nalen Versorgungs-
gewinnt Bedeutung
Leistungsabbildung regionen
– Qualitätsabhängige
Vergütung
– Intersektoral durch-
lässige Tarifstrukturen
Abbildung 14: Erwartete Entwicklung des Vergütungssystems von Schweizer Akutspitälern
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 19Exkurs: Zukunftsfähige Gesundheits-
versorgung für Deutschland
Die deutsche Bertelsmann Stiftung befasst sich in einer Studie11 mit der Zukunft der deutschen Spitallandschaft, analog zu unserer siebten Ausgabe
der vorliegenden Studie.12 Die Bertelsmann-Analyse weist viele Parallelen zu unseren Prognosen und Denkansätzen für die Entwicklung des Schweizer
Gesundheitssystems auf.
1) Ähnliche Methode, gleiche Aussagen 2) Neustrukturierung der Spitalversorgung 3) Behandlungsqualität im Fokus
notwendig
Die Bertelsmann-Studie setzt auf eine ähnliche Ausgehend von OECD-Vergleichen zu Gesund- Führende deutsche Mediziner erachten die
Methodik und schlägt die Erreichbarkeit von heitskosten, Behandlungshäufigkeiten und Versorgungsqualität in der Medizinbericht-
95 Prozent der Bevölkerung in maximal Ambulantisierung stellt die Bertelsmann erstattung als Schlüsselargument, vor allem
30 Minuten per motorisiertem Individualverkehr Stiftung fest, dass Deutschland genau wie die bei spezialisierten Behandlungen und in der
vor. Allerdings geht sie von aktuellen Standorten Schweiz zu den Ländern mit dem grössten Notfallversorgung. Um in einer fortschreitenden
und nicht wie PwC von einem «Grüne-Wiese- Optimierungspotenzial gehört. Sie macht auf und sich spezialisierenden Medizin eine hohe
Ansatz» aus und leitet aus einer Versorgungs- Überkapazitäten, unzureichenden Fokus und Versorgungsqualität sicherzustellen, gehen sie
region Auswirkungen auf die gesamte Bundes- mangelhafte Spezialisierung aufmerksam. Das von einer kritischen Spitalgrösse aus.
republik ab. Die Studie folgert, dass das garantiert insgesamt keine optimale Qualität
System eine Konsolidierung zu integrierten der Versorgung der Bevölkerung, sondern setzt Hier sehen wir Parallelen zur Schweizer Ver-
Versorgungsnetzwerken und einen Abbau von Fehlanreize. Zudem weist die Studie auf den sorgungslandschaft, etwa mit der Einführung
Überkapazitäten erfordert. Sie konstatiert: aktuellen Wettbewerb unter Spitälern hin, der von Mindestfallzahlen. Die deutschen Autoren
«Jedes zweite Krankenhaus sollte schliessen. eine «ruinöse Konkurrenz» schaffen würde. nehmen in ihrem Modell eine Mindestspital-
Eine bessere Versorgung ist mit halb so vielen grösse von 200 Betten an (der Durchschnitt
Kliniken möglich.» Die Bertelsmann-Studie schlägt vor, die liegt bei über 700 Betten) und erachten 25
Spitalanzahl in Deutschland von rund 1400 Stationsbetten als Mindestgrösse für kleinere
Das Gesundheitswesen in Deutschland lässt Standorten auf weit unter 600 Standorte und Einheiten. Obwohl diese Grössenordnung für die
sich gut mit dem Schweizer System verglei- somit um fast 60 Prozent zu reduzieren. Damit Schweizer Versorgungsstrukturen nicht ganz
chen. So kommt die Studie der Bertelsmann liesse sich das Kostenwachstum im Gesund- passt, weist sie dennoch auf eine anstehende
Stiftung zu ähnlichen Schlüssen. Auch in heitswesen eindämmen und weiteren Themen Konsolidierung hin.
Deutschland ist eine Versorgung mit weniger wie beispielsweise dem Fachkräftemangel
Standorten möglich und sinnvoll. Die Studie begegnen.
verlangt nach vernetzten und integrierten
Versorgungsregionen, die sich am Bedarf und
an der Ressourceneffizienz orientieren. Im
Weiteren fordern die Autoren die Konsolidierung
und stärkere Spezialisierung von deutschen
Spitälern. Anzeichen dieser Entwicklung zeigen
sich auch in der Schweiz, etwa mit der Ein-
führung von Mindestfallzahlen. Dieser Ansatz
dürfte in Zukunft weiter vorangetrieben werden.
Die regionalen Gegebenheiten – insbeson-
dere in ländlichen Gebieten – gelten auch in
Deutschland als wirksamer Hebel.
20 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Psychiatrien agieren
nachhaltig profitabel
TARPSY-Einführung gelungen Im Jahr 2018 fiel das Wachstum der stationären Fälle im
Vergleich zu 2017 geringer aus. Es lag bei tiefen 0,3 Pro-
Das neue Tarifmodell TARPSY wurde Anfang 2018 mit zent, während die ausgewiesenen stationären Umsätze
einer zweijährigen Übergangsphase eingeführt. Die im Median mit 1,2 Prozent anstiegen. Das Wachstum der
Psychiatrien mussten sowohl ihre IT-Systeme anpassen ambulanten Fälle und des ambulanten Umsatzes lag mit
als auch Dokumentationsprozesse, Kodierung und die 1,9 Prozent beziehungsweise 1,8 Prozent eindeutig unter
Leistungsabbildung auf TARPSY ausrichten. dem Vorjahresniveau.
Umsatzwachstum Psychiatrien
2,0 % 2,6 % 1,0 % 2,5 % 0,9 %
11,5 %
5,9 %
4,1 %
1,6 % -0,2 % 0,7 % 1,8 %
-0,2 % 1,1 % 1,2 %
2014 2015 2016 2017 2018
Ambulantes Wachstum Stationäres Wachstum Umsatzwachstum
Abbildung 15: Umsatzwachstum der Schweizer Psychiatrien, aufgeteilt nach ambulanten und stationären Behandlungen (Medianwerte)
Insgesamt verlief die TARPSY-Einführung positiv. zu Veränderungen in den organisatorischen Abläufen
Die psychiatrischen Einrichtungen waren gut auf die motivieren und sich möglicherweise auf die Behand-
Umstellung vorbereitet. 2018 traten lediglich kleine lungsprozesse auswirken.
Umstellungsschwierigkeiten zutage. So zeigten sich
Unklarheiten bei der Abrechnung der Urlaubs-/Be- Für die Leistungserbringer bleibt TARPSY auch nach
lastungserprobungen und bei Wiedereintritten. In der dem Einführungsjahr eine Herausforderung hinsichtlich
Einführungsphase 2018/2019 werden solche Abwesen- Dokumentation und Leistungsabbildung. Sie müssen
heiten von Patienten teilweise noch vergütet. Ab 2020 komplexe Behandlungen und die 1:1-Betreuung für
entfällt diese Regelung. Der Tarif dürfte damit verstärkt TARPSY kostengerecht abbilden.
Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018 | 21Rückläufiger Personalkostenanteil Der Personalaufwand als Anteil am Umsatz ging zwi-
schen 2017 und 2018 zurück (-1,5 Prozent). Allerdings
fielen die Personalkosten 2017 im langjährigen Vergleich
hoch aus und waren 2018 nun wieder tiefer. Insgesamt
zeichnet sich über die letzten fünf Jahre ein Trend zu
sinkenden Personalaufwandsquoten ab.
Kostenentwicklung
8,6% 9,7% 10,5% 7,4% 8,2 %
13,2% 13,1% 12,3% 13,9% 14,5 %
2,7% 2,8% 2,6% 2,3% 2,5 %
75,5% 76,4% 74,9 %
74,3% 74,6%
EBITDAR
Übriger Aufwand (exkl. Mieten)
Medizinischer Bedarf
Personalaufwand
2014 2015 2016 2017 2018
Abbildung 16: Kostenentwicklung bei den Schweizer Psychiatrien in Prozent des Gesamtumsatzes (Medianwerte)
Profitabilität auf nachhaltigem
Niveau
Die EBITDAR-Marge der zwölf Psychiatrien in der Studie
erholte sich 2018 leicht und erreichte einen Median-
wert von 8,2 Prozent. Die Minimal-/Maximalwerte lagen Historische EBITDAR- und EBITDA-Margen Historisch
zwischen 4,3 und 13,8 Prozent.
6,2 %
Die EBITDA-Marge blieb mit 6,2 Prozent im Vergleich 2018 2018
8,2 %
zum Vorjahr konstant. Die Mietaufwendungen stiegen im
Median leicht an. Daraus ergeben sich unterschiedliche 6,2 %
2017 2017
Entwicklungen von EBITDA und EBITDAR. Bei der 7,4 %
EBITDA-Marge schwankten die Minimal- und Maximal- 7,4 %
werte zwischen 1,9 und 10,1 Prozent. 2016 2016
10,5 %
Das langfristige EBITDAR-Ziel von 8,0 Prozent liegt für 8,2 %
2015 2015
9,7 %
Psychiatrien etwas tiefer als für Akutspitäler. Psychiatrien
weisen eine geringere Anlagenintensität auf. So sind zum 5,9 % 0
2014 2014
Beispiel weniger installierte Anlagen nötig als in Akut- 8,6 %
spitälern. Als Konsequenz sind die gewichteten Abschrei- Marge in % des Gesamtumsatzes
bungsdauern durch den grösseren Immobilienanteil und
EBITDA EBITDAR
den viel tieferen Bedarf an medizintechnischen Anlagen
höher als in einem Akutspital. In der Summe fallen weniger
Abschreibungen pro Jahr an. Ähnliche Kausalitäten Abbildung 17: EBITDAR- und EBITDA-Entwicklung der Schweizer Psychiatrien
gelten für die Rehabilitation und Pflege. (Medianwerte)
22 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Die EBIT-Historische EBITDAR- und
und Reingewinn-Margen derEBITDA-Margen
untersuchten Historische EBIT- und Reingewinn-Margen
Psychiatrien erhöhten sich 2018 um 0,6 Prozent
beziehungsweise um 0,7 Prozent.6,2
Das%führte zu einem 2,2 %
2018 2018
weiteren Anstieg der Eigenkapitalquoten. 8,2 % 2,1 %
6,2 % 1,5 %
2017 2017
7,4 % 1,5 %
7,4 % 2,0 %
2016 2016
10,5 % 2,6 %
8,2 % 2,2 %
2015 2015
9,7 % 3,2 %
5,9 % 0,9 %
2014 2014
8,6 % 2,8 %
Marge in % des Gesamtumsatzes Marge in % des Gesamtumsatzes
EBITDA EBITDAR Reingewinn EBIT
Abbildung 18: EBIT- und Reingewinn-Entwicklung der Schweizer Psychiatrien
(Medianwerte)
Gesunde Eigenkapitalquoten Im Gegensatz zur Akutsomatik sind bei den Schweizer
Psychiatrien bisher weniger grosse Investitionsprojekte in
Im Jahr 2018 erreichten die Schweizer Psychiatrien im Arbeit oder in Planung. Die Nachfrage nach ambulanten
Median eine Eigenkapitalquote von 59,0 Prozent. Das Angeboten wird den Investitionsbedarf in Zukunft prägen.
entspricht einer stabilen Entwicklung und marginalen Ob dazu einzelne Psychiatrien den Weg zum Kapitalmarkt
Zunahme von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser einschlagen, bleibt abzuwarten. Während der Finanzie-
Wert liegt weiterhin einiges über dem als gut zu bezeich- rungsbedarf dafür vielerorts eher zu gering ist, dürften
nenden Richtwert von 40,0 Prozent. Der Verschuldungs- Psychiatrien bei Investoren aufgrund der stabilen Nach-
grad13 hat sich im selben Zeitraum gleichermassen kaum frage oder wegen fehlender Angebote im ambulanten
verändert und lag bei 38,1 Prozent. Bereich gute Chancen für attraktive Konditionen haben.
Zudem haben die Trägerschaft und implizite Staatsgaran-
tie vermutlich einen ähnlichen Einfluss auf die Risikoein-
schätzung wie bei den Akutspitälern.
Eigenkapitalquote EBITDAR Marge nach Bettenzahl
59,0 % >250 Betten 8,1%
58,8 %
200–249 Betten 9,9 %
150–199 Betten 10,6 %
56,5 %
100–149 Betten 5,2 %
56,0 %
55,8 %
50–99 Betten 11,0 %Psychiatrien mit einer Spezialisierung und solche ohne Insgesamt erwarten wir weiterhin ein Umsatzwachstum
Anbindung an einen somatischen Grund- oder Zentrums- im Psychiatriemarkt von 3,3 Prozent. Bei ambulanten
versoger (psychiatrische Kliniken) zeigten 2018 mit 9,9 Einrichtungen (Praxen) erwarten wir ein Umsatzwachstum
Prozent beziehungsweise 9,5 Prozent die höchsten von circa 4,0 Prozent. Der spitalambulante Bereich dürfte
EBITDAR-Margen. Auch bei der Grösse der Einrichtung mit Abstand am stärksten wachsen (12,1 Prozent Umsatz-
unterscheidet sich die Profitabilität stark. Spezialkliniken wachstum), sollten nicht regulatorische Einschränkungen
und mittelgrosse Psychiatrien mit 50 bis 99 Betten erwirt- oder tarifliche Entwicklungen (z. B. weitere Unterfinanzie-
schafteten 2018 die höchsten Median-EBITDAR-Margen rung der ambulanten Behandlungen) diese Entwicklung
(11,0 Prozent). Hingegen kamen Institutionen mit 100 bis bremsen. Stationäre Umsätze dürften nur in geringerem
149 Betten lediglich auf 5,2 Prozent. Trotzdem lässt Masse wachsen (0,3 Prozent). Auch diese Annahme
sich kein systematischer Zusammenhang zwischen der stützt sich aber nicht unwesentlich auf die weitere Ambu-
Anzahl Betten und der EBITDAR-Marge feststellen. lantisierung, welche durch tarifliche Fehlanreize gebremst
werden könnte.
Ambulante Psychiatrie als Der stationäre Psychiatriemarkt wird künftig stagnieren
Wachstumstreiber oder begrenzt wachsen. Einen der Hauptgründe für die
erwartete Verschiebung der Behandlungsanteile von
In Abbildung 21 stellen wir auf der Grundlage von Daten stationär zu ambulant stellen die Behandlungspräferen-
des Bundesamtes für Statistik eine prognostizierte Markt- zen der Patienten dar. Dadurch wird auch die soziale
entwicklung von 2019 und 2023 dar. Es ergibt sich ein dy- Reintegration gefördert und verbessert. Hinzu kommen
namisches Marktwachstum im ambulanten und stationären ökonomische Aspekte des Gesundheitswesens, etwa
psychiatrischen Bereich von 3,3 Prozent pro Jahr für den Kostenvorteile der ambulanten Behandlungsformen so-
gesamten psychiatrischen Markt. Getrieben wird dieses wie bisher mangelnde Angebote. In der Folge dürfte sich
massgeblich von der gesellschaftlichen Enttabuisierung der Druck auf die Leistungserbringer zur Abbildung der
psychischer Krankheiten und Behandlungsnotwendigkei- ambulanten Leistungen erhöhen.
ten. Mit steigender sozialer Akzeptanz können mehr betrof-
fene Menschen adäquat versorgt werden. Differenziertere
Angebote begünstigen das Wachstum zusätzlich.
Umsatzentwicklung der Psychiatrie nach Leistungsträger
3,3 %
CAGR CAGR
5237 10–16 16–23
4683
4,7 %
4184
Ambulante Behandlungen
2564 durch Praxen (Psychiater 5,9 % 4,0 %
und Psychotherapeuten)
2244
3175
1947
1382 Ambulante Behandlungen
716 18,0 % 12,1 %
487 durch Spitäler
323
119
Stationäre Behandlungen
1914 1952 1957 durch psychiatrische 2,3 % 0,3 %
1674 Kliniken/Spitäler
2010 2016 2019E 2023E
PwC-Schätzung
Abbildung 21: Umsatzentwicklung der Psychiatrie nach Leistungsträger von 2010 bis 202315
24 | Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2018Sie können auch lesen