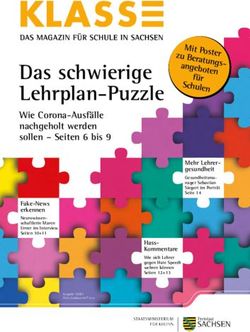Sport und Politik polis aktuell - Our Game
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
polis aktuell Nr. 5 2014 Sport und Politik oo Die Olympischen Spiele und Politik oo Sport und Gesellschaft oo Fußball und Politische Bildung oo Angebote rund um Fußball und die WM 2014 oo Unterrichtsvorschläge und -materialien
p o li s akt ue ll 2014
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Rummel und die Begeisterung rund um die Fußball- Das Heft basiert auf der Ausgabe 4/2008 von polis aktuell,
Weltmeisterschaft bieten Lehrkräften und SchülerInnen welche zur Fußball-Europameisterschaft erschienen ist und
zahlreiche Möglichkeiten, sich kritisch mit Rolle und Funk- nun anlässlich der bevorstehenden Fußball-Weltmeister-
tion des Sports in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. schaft in Brasilien überarbeitet und aktualisiert wurde.
Ein Hauptaugenmerk liegt aus diesem Grunde auf Mate-
Die enge Verbindung zwischen Sport und Politik lässt
rialien und Angeboten für Schulklassen rund um Fußball
sich beispielsweise gut anhand der Olympischen Spiele
und die WM. Diese stellen Zusammenhänge zwischen dem
im Verlauf der Jahrzehnte beobachten. So widmet
Sportereignis und entwicklungs- sowie gesellschafts-
sich der erste Beitrag des Hefts diesen Zusammen-
politischen Fragestellungen her und ermöglichen eine
hängen. Auch die Rolle des Sports für die Gesellschaft
Vertiefung der bearbeiteten Themen im Unterricht.
und gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse wie etwa
zwischen Sport und Medien oder Genderfragen stellen Die Unterrichtsbeispiele regen zu einer Auseinandersetzung
Möglichkeiten der kritischen Auseinandersetzung mit mit SportlerInnen und Nationalität(en) sowie Gewalt und
den Chancen sowie den Schattenseiten des Sports dar. Rassismus im Sport an.
Sport wird inzwischen vielfach als „kulturelle Leitwährung“ Wir wünschen Ihnen eine abwechslungsreiche Umsetzung
betrachtet, als Vehikel für den Transport von gesellschaft- des Themas im Unterricht und freuen uns über Lob, Kritik
lichen Anliegen und Botschaften. Allerdings steht dem und Verbesserungswünsche.
auch jener Bereich des Sports gegenüber, der von Gewalt,
Maria Haupt
Diskriminierung, Dopingskandalen sowie wirtschaft-
für das Team von Zentrum polis
licher und politischer Einflussnahme geprägt ist.
maria.haupt@politik-lernen.at
Beitrag zur Leseförderung SchülerInnenwettbewerb zur Politischen Bildung
Thema „Fußball und Brasilien“
Bené, schneller als das schnellste Huhn
Toledo, Eymard. Basel: Baobab Books, 2013/2014 regte der Wettbewerb u.a. zur Durchfüh-
2013. 32 Seiten. Ab 5 Jahren. rung von Schulprojekten rund um die Themen „Fuß-
Die in Brasilien geborene Autorin erzählt von Benedito ball – eine Lösung für die Ärmsten?“ (5.-8. Schulstufe)
da Silva, der von allen nur Bené genannt wird und für und „Brasilien ist mehr als Fußball!“ (8.-11. Schulstufe)
sein Leben gerne Fußball spielt. Gemeinsam mit seiner an. Die von Lehrkräften ausgearbeiteten Projektanlei-
Mutter und seinem Vater näht er Fußbälle, von deren tungen bieten auch außerhalb des Wettbewerbs eine
Verkauf sie leben. Das Buch erzählt vom Leben und von Möglichkeit, das Thema im Unterricht aufzugreifen.
den Träumen eines brasilianischen Buben. Einzelne www.politik-lernen.at/wettbewerbpb
portugiesische Begriffe werden im Anhang erklärt und
Tipps zur Aussprache angeboten.
Anpfiff für Ella
Dölling, Beate. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag,
2006. 172 Seiten. Ab 10 Jahren. Themenvorschläge für vorwissenschaftliche Arbeiten
Von klein auf kickt Ella begeistert mit ihrem Bruder und Diplomarbeiten
Lino. Damit ist Schluss, seit Lino eine eigene Mann-
••SportlerInnen als BotschafterInnen und Testimonials
schaf t gegründet hat, „die Südtiger“. Mädchen sind
für soziale Anliegen: Pros und Contras
dort nicht erlaubt! Klar, dass Ella sauer ist. Doch dann
bietet sich die Chance, in der neuen Schulmannschaft ••Rassismus und Gewalt im Fußballstadion: Was
– der „MM Victoria“ – mitzuspielen und endlich kann können erfolgreiche Fanarbeit-Projekte in diesem
sie ihr Fußballkönnen beweisen. Das erste Spiel von Zusammenhang leisten?
Victoria gegen die Südtiger lässt nicht lange auf sich
••Der Weg des Frauenfußballs in Österreich und
warten ...
Deutschland: eine vergleichende Analyse
2 www. p olitik-ler ne n .atNr. 5 Spor t u n d Politik
1 Die Olympischen Spiele und Politik
Die Olympische Bewegung verfolgt als wesentliche Ziele, Das Internationale Olympische Komitee (IOC) spielte bei
„zu einer friedlichen und besseren Welt beizutragen der Vergabe der Spiele an Deutschland eine umstrittene
und junge Menschen im Geiste von Freundschaft, Soli- Rolle. Noch wichtiger war in diesem Fall aber der Präsident
darität und Fair Play ohne jegliche Diskriminierung zu des Amerikanischen Nationalen Olympischen Komitees
erziehen“*. Die Olympischen Spiele möchten u.a. einen (USOC) und spätere Präsident des IOC, Avery Brundage.
Beitrag zur internationalen Völkerverständigung leisten; Dieser setzte sich dafür ein, dass die USA die Spiele 1936
in ihrem Regelwerk ist die „politische Neutralität“ fest- nicht boykottierten. Nicht zuletzt trug die Teilnahme der
geschrieben. Trotzdem waren die Spiele immer wieder wichtigsten Sportnation dazu bei, dass die Nationalso-
geprägt durch politische Auseinandersetzungen sowie zialisten in sportlicher Hinsicht erfolgreiche Spiele ver-
die Instrumentalisierung durch politische Mächte. anstalten konnten – das bis dahin größte Sportereignis
überhaupt.
Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin
Der Kalte Krieg
Die ersten Spiele, die als professionelles, durchinsze-
niertes Massenereignis im heutigen Sinne begangen Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die Olympischen
wurden, waren jene von 1932 in Los Angeles. Sie waren Spiele eine öffentliche Bühne dar, auf welcher der Kalte
Vorbild für die Nationalsozialisten, die die Olympischen Krieg symbolisch und relativ gefahrlos ausgefochten wer-
Spiele 1936 in Berlin propagandistisch ausschlachte- den konnte. Die Siege der eigenen Nation bzw. der Sieg in
ten. Zunächst standen die Nationalsozialisten den olym- der Nationenwertung wurde stets auch als Beleg für die
pischen Idealen skeptisch gegenüber. Sie änderten jedoch Überlegenheit des jeweiligen politischen Systems bzw.
ihre Meinung, als das Reichspropagandaministerium der Kultur über den gesellschaftspolitischen Gegenent-
unter Joseph Goebbels begann, die Spiele als geeignetes wurf gedeutet. In der Konsequenz waren die Spiele in
Mittel zur Umsetzung der politischen Zwecke der Natio- der Nachkriegszeit auch von den Rivalitäten Nord- und
nalsozialisten zu sehen. Ziel war zu diesem Zeitpunkt in Südkoreas bzw. der BRD und der DDR geprägt. Im Vorder-
erster Linie, die Welt von der Friedfertigkeit Deutschlands grund standen jedoch die AthletInnen der USA und der
als solides Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu Sowjetunion, die sich allerdings in den 12 Jahren von
überzeugen. 1976 bis 1988 überhaupt nicht messen konnten: Grund
waren die wechselseitigen Boykotte bei den Spielen 1980
Nach innen sollten die Spiele ein Gefühl der Einheit erzeu-
in Moskau bzw. 1984 in Los Angeles, was zur „Opferung
gen und von innenpolitischen Missständen ablenken:
der olympischen Chancen einer ganzen Sportlergenera-
Oppositionelle Sportverbände wurden verboten, viele
tion“**** führte.
ihrer SportlerInnen und FunktionärInnen umgebracht.**
Die Gleichschaltung der Presse wurde intensiviert und zur
Tipp Literatur
Besänftigung ausländischer Kritik zwei jüdische Sport-
lerInnen zugelassen. Während der Spiele selbst beglück- Sport und Politik. Eine Einführung
wünschte Adolf Hitler deutsche SportlerInnen persönlich; Anderson, Uwe (Hg.). Schwalbach:
der überragende Athlet der Spiele, der Afroamerikaner Wochenschau Verlag, 2006. 88 Seiten.
Jesse Owens, wurde jedoch aufgrund seiner Hautfarbe Ein Abriss über die „Olympischen Spiele
bewusst brüskiert, sollten die Spiele doch vor allem zum und Fußballweltmeisterschaften als
„Ruhm“ der „Herrenrasse“ beitragen.*** Mega-Events und ihre Bedeutung für die
Politik“, „aktuelle Herausforderungen
im Spannungsfeld von Sport, Medien
und Wirtschaf t“, „Fankulturen“ u.a.
* Deutscher Olympischer Sportbund: Olympische Spiele und Olympische
Bewegung: www.dosb.de/de/olympia/ziele-aufgaben-konzepte
www.wochenschau-verlag.de/sport-und-politik.html
** vgl. Rösch, Heinz-Egon: Politik und Sport in der Geschichte und Gegen-
wart. Freiburg/Würzburg 1980, S. 41f.
*** vgl. hier und im Folgenden: Filzmaier, Peter: Politische Aspekte der **** Güldenpfennig, Sven: Olympische Spiele und Politik. In: Sportpolitik
Olympischen Spiele. Wien 1993, S. 463. und Olympia. Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 29-30/2008. S. 7.
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 3p o li s akt ue ll 2014
Rassismus und der Nahost-Konflikt Das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter
Beschuss und die Kommerzialisierung Olympias
Der Zweite Weltkrieg warf seinen Schatten auch insofern
noch weit in das 20. Jahrhundert hinein, als Japan und Die Entwicklung, dass die Austragung der Olympischen
Deutschland die Spiele im eigenen Land (1964 Tokio bzw. Spiele auch immer stärker von kommerziellen Erwä-
1972 München) als Chance zur – zumindest symbolischen – gungen bestimmt wurde, erreichte 1984 in Los Angeles
politischen Rehabilitierung sahen und sie entsprechend ihren ersten Höhepunkt, als Unternehmen wie Coca-
anzulegen versuchten. Denn grundsätzlich kann die Aus- Cola, Levis und andere Konzerne Sponsoren der Spiele
tragung der Spiele für das Gastgeberland einen Gewinn wurden. Zum ersten Mal konnte ein Gewinn erwirtschaf-
an Prestige bedeuten, der weit über die sportliche Ebene tet werden; die Fernseheinnahmen wuchsen rapide:
hinausgeht. Die Olympischen Spiele 1972 in München 1980 beliefen sie sich noch auf 110 Millionen Dollar für
wurden jedoch von einem tödlichen Terroranschlag palä- die Sommer- und Winterspiele, bei den Sommerspie-
stinensischer TerroristInnen auf israelische AthletInnen len in Sydney 2000 betrugen diese bereits über 1,3 Mil-
überschattet. Dieses Ereignis hatte zur Folge, dass die fol- liarden Dollar.*** Für den Verkauf der gekoppelten TV-
genden Spiele mit einem stark erhöhten Sicherheitsauf- Rechte für die Winterspiele 2014 und die Sommerspiele
wand durchgeführt wurden.* 2016 nahm das IOC mehr als vier Milliarden Dollar ein.****
Die Olympischen Spiele sind zu einem weltumspannenden
Auch andere politische Konflikte traten während Olym-
Massen- und Medienereignis geworden.
pischer Spiele deutlich zu Tage. Durch den langjährigen
Ausschluss Südafrikas von den Olympischen Spielen aus In der Folge wurde der Sport nicht nur immer mehr zur
Protest gegen die Apartheid-Politik kam das Thema Ras- Ware, er kam auch durch Dopinggerüchte in Verruf. Um
sismus auf die olympische Tagesordnung. Thematisiert den Kalten Krieg auch auf dem Sportplatz zu gewin-
wurde das auch in Mexiko 1968 durch den Black-Power- nen, kamen verstärkt Dopingmittel zur Anwendung,
Gruß der beiden Olympiasieger Tommie Smith und John wie z.B. an den DDR-AthletInnen beobachtet werden
Carlos bei der Siegerehrung. Sie wollten damit auf die konnte. Später wurden auch Dopingfälle systematisch
Diskriminierung von AfroamerikanerInnen in den USA verschleiert, um das Produkt Olympia nicht zu gefährden
aufmerksam machen. Die beiden Sportler wurden darauf- bzw. um sein Image durch neue Rekorde und Höchst-
hin von den Spielen ausgeschlossen, weil sie durch ihre leistungen zu verbessern.***** Seit in den 1980er-Jahren
„politische Demonstration“ gegen den Anspruch „apo- immer höhere Summen umgesetzt wurden, häuften sich
litischer“ Spiele verstoßen hätten.** Die Frage, inwieweit auch die Berichte über unlauteren Wettbewerb im Rah-
SportlerInnen, FunktionärInnen und – die Spiele als men der Vergabe der Spiele.******
Zusehende begleitende – PolitikerInnen nicht im Gegen-
teil sogar dazu verpflichtet wären, bei den Olympischen
Methodentipp „Skandale rund um Olympia“
Spielen Stellung zu politischen Themen zu beziehen,
Lassen Sie die SchülerInnen im Internet die größten
stellte sich auch bei folgenden Spielen immer wieder (z.B.
„Skandale“ rund um die letzten drei Olympischen
Menschenrechtsfragen 2008 in Peking; Diskriminierung
Spiele recherchieren und analysieren:
von homosexuellen SportlerInnen 2014 in Sotschi).
•• Wie lauteten die Vorwürfe? Was waren die vorherr-
schenden Themen? (Doping, Veruntreuung, politi-
Tipp Unterr ichtsmater ial
sche Vereinnahmung etc.)
Sport und (Welt-)Politik •• Was haben diese Ereignisse mit Entwicklungen im
Themenblätter im Unterricht, Nr. 49/2005. Bonn: Bundes- Sport bzw. mit gesamtgesellschaftlichen Entwick-
zentrale für politische Bildung (bpb) (Hg.), 2005. lungen zu tun?
Arbeitsblätter für SchülerInnen zu den Zusammenhängen •• Gab es Unterschiede in der medialen Berichterstat-
und Wechselwirkungen von Sport und Politik: tung der verschiedenen Medien/Zeitungen?
www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36669/
sport-und-welt-politik *** Kistner, Thomas: Der olympische Sumpf. Die Machenschaften des IOC.
München 2000, S. 32.
**** Focus Online: TV-Rechte des IOC erstmals über vier Milliarden:
www.focus.de/sport/olympia-2012/olympia-2014-tv-rechte-des-ioc-
* vgl. u.a. Güldenpfennig, 2008. S. 7. erstmals-ueber-vier-milliarden_aid_643695.html
** vgl. u.a. Heaming, Anne: Die Spiele müssen weitergehen. In: Fluter. ***** Hackforth, Julius: Die Ökonomisierung der olympischen Idee.
Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): www.fluter.de/ In: Der Standard am 13.10.1999.
de/sport/thema/6946/ ****** Kistner, 2000. S. 35.
4 www. p olitik-ler ne n .atNr. 5 Spor t u n d Politik
2 Sport und Gesellschaft
Sport birgt zahlreiche Chancen für die gesellschaftliche Positiv betrachtet erfüllt Sport also oft die Funktion
Entwicklung, wie z.B. die Schulung sozialer Kompetenzen eines gesellschaftlichen „Kitts“ und kann das kollek-
oder das Einüben von Teamarbeit, Fair Play und Gleich- tive Bewusstsein und den gesellschaftlichen Zusam-
berechtigung. Er bietet Möglichkeiten der individuellen menhalt stärken. Anlass für eine kritische Analyse
Sinnstiftung bzw. des Engagements, er dient der Kon- bietet hingegen die Gefahr einer möglichen Instrumen-
taktpflege und kann u.U. auch zur sozialen Integration, talisierung des Sports – beispielsweise zur Stabilisie-
internationalen Verständigung oder Versöhnung beitra- rung bestehender Regierungen oder Herrschaftsformen
gen. Demgegenüber stehen Ausgrenzung, Rassismus, bzw. zur Ablenkung von Missständen in einem Land.****
Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft im Sport, Auch die Ein- und Ausschlussmechanismen, nach wel-
Korruption und Kommerzialisierung von Sportereignis- chen SportlerInnen in Bezug auf ihre Nationalität oder
sen sowie die Gefahr eines übersteigerten Nationalismus, andere Merkmale (Geschlecht, sexuelle Orientierung,
der über den Sport vermittelt wird.* Behinderung) gleichberechtigte Chancen auf Aus-
übung ihres Sports sowie auf Erfolg erhalten – oder eben
Zudem erfüllt Sport in Politik, Wirtschaft und Medien
nicht –, erfordern eine kritische Auseinandersetzung.
wesentliche Funktionen: PolitikerInnen nutzen große
Sportereignisse, um sich als „eine/n vom Volk“ zu präsen-
tieren und ihre Sympathiewerte zu steigern, Unterneh-
Methodentipp „SportlerInnen und Staatsbürgerschaft“
men machen Millionengeschäfte im Zusammenhang mit
Eine Unterrichtseinheit, in welcher sich die Schüle-
Sport und auch die Medien und der Sport finden sich in
rInnen mit dem Thema Sport und Nationalität(en) aus-
einem engen Symbioseverhältnis wieder.
einandersetzen, findet sich auf Seite 13 dieses Hefts.
2.1 S port und „N ation “
Tipp Literatur
In der Vergangenheit gibt es viele Beispiele, in denen
Wer nicht hüpft ... Inklusion und Exklusion im Sport
Sport maßgeblichen Einfluss auf die Politik genommen
stimme – Zeitschrift der Initiative
hat – und umgekehrt. Eines der bekanntesten ist das
Minderheiten, Nr. 88/2013.
sogenannte „Wunder von Bern“**, das 1954 identitäts-
Die Autorinnen und Autoren beschäf-
stiftend für Ost- und Westdeutschland wirkte. Auch in
tigen sich in ihren Beiträgen – ausge-
Bezug auf das österreichische Gemeinschaftsgefühl kam
hend von minorisierten Gruppen – mit
dem Sport als einem „Aspekt nationaler Selbstvergewisse-
Sport als Integrationsmaßnahme und
rung“ nach 1945 eine bedeutende Rolle zu. In den nach-
mit den inkludierenden, aber auch
folgenden Jahren begleitete der Sport die Entwicklung
ausgrenzenden Aspekten des Sports.
von einem Wien-zentrierten zu einem zunehmend auch
Mit Beiträgen u.a. zu den Themen: „Schneeweiße
an den Bundesländern orientierten Österreichverständ-
Alpenrepublik: Warum David Alaba als österreichischer
nis. Die Wandlung „von einer Donau- zu einer Alpen-
Abfahrtsolympiasieger bisher nicht möglich ist“, „Inte-
republik“ war wesentlich durch den Bedeutungszuwachs
grationspolitik neu: Zugehörigkeit zur Sport-Nation
des Skilaufs gegenüber dem Fußball gekennzeichnet.***
durch (körperliche) Leistung“, Sturm der Liebe: Homose-
xualität im Sport“ u.v.m.
* vgl. Jäger, Uli: Sport und (Welt-)Politik. In: Themenblätter im Unter- www.minderheiten.at//index.php?option=com_content&
richt, Nr. 49/2005. Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 2005. S. 1. task=view&id=442&Itemid=147
** Die deutsche Nationalmannschaft gewann unerwartet das Finalspiel
der Fußball-WM 1954 gegen das hoch favorisierte Ungarn. Dies führte zu
einem großen, deutschlandweiten – und nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs auch einigenden – Freudentaumel.
*** Marschik, Matthias: Sport und Medien – Mediensport. Zur Inszenierung
und Konstruktion von Sporthelden. In: medienimpulse – Beiträge zur **** vgl. Filzmaier, Peter: Wie politisch ist Fußball? In: kursiv – Journal für
Medienpädagogik Nr. 62/2007. S. 15. politische Bildung. Nr. 3/2005: Eine Menge Welt. Fußball & Politik. S. 16.
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 5p o li s akt ue ll 2014
2.2 S port und M edien Sport und Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Sport war als einflussreiches gesellschaftliches Phänomen Die Paralympics sowie die Special Olympics – die Olym-
schon früh mit den Medien verbunden – und beide Seiten pischen Spiele für SportlerInnen mit Behinderungen –
ziehen ihren Nutzen daraus. Einerseits brauchen Sport- werden seit den 1960er-Jahren regelmäßig ausgetra-
lerinnen und Sportler die Unterstützung der Medien, um gen. Neben der Begeisterung der AthletInnen und
mit ihrer Sportart möglichst viele Menschen zu errei- ZuschauerInnen gibt es jedoch auch Kritik: Die Forde-
chen und zu begeistern, andererseits sind die Medien auf rung nach Inklusion im Sportbereich geht über diese
Ereignisse, von denen sie berichten können, angewiesen. „segregierten“ Angebote hinaus und bedeutet u.a.,
Von welchen Sportarten berichtet wird, zu welcher Uhr- dass „der Frage nachgegangen werden [muss], wie
zeit eine Übertragung stattfindet etc., hat Einfluss auf Sportangebote auf allen Ebenen (Breiten-, Schul- und
die Popularität einer Sportart. Medien sind somit auch Spitzensport) gestaltet sein müssen, um die Teilhabe
maßgeblich an der Bekanntheit einzelner „Sportstars“ aller Mitglieder einer heterogenen Gesellschaft mit all
beteiligt.* ihren vielfältigen sozialen Merkmalen zu ermöglichen.“
(Sabine Radtke)
Die Medien unterstützen durch die Übertragung von Spor-
tereignissen auch eine der wesentlichen Funktionen des
Lesetipp: Radtke, Sabine: Inklusion von Menschen
Sports, nämlich die Identifikation – sei es mit der eigenen
mit Behinderung im Sport. In: Aus Politik und Zeitge-
Nation oder mit den nationalen Sport-HeldInnen. In den
schichte Nr. 16-19/2011: Sport und Teilhabe. Bonn:
Medien werden diese SportlerInnen immer wieder mit der
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 2011.
Nation gleichgesetzt, quasi für diese vereinnahmt. Dies
drückt sich beispielsweise in Schlagzeilen aus wie: „Holt
unser erstes Gold!“, „Goldene Erlösung – Niki, wir lieben
dich“, „Unser Gold-Mario“, „Wir sind wieder Ski-Nation
Nr. 1“, „Wir sind Weltmeister“**. Spitz- und Beinamen wie 2.3 S port und G eschlecht
„Herminator“, „Niki“, Schöni“, „Meisi“ etc. sollen zu die-
Historisch waren sportliche Wettkampfarten sehr lange
ser Identifikation der ZuschauerInnen mit den Sportstars
mit dem Konstrukt von Männlichkeit verbunden. Eigen-
beitragen, die damit sozusagen selbst ein Stück dieses
schaften wie Ausdauer, Kraft, Leistungswille, Ehre und
Erfolgs für sich beanspruchen können.
Aggression wurden v.a. der männlichen Identität zuge-
Eine negative Entwicklung des Zusammenspiels von schrieben. Nichtsdestotrotz forderten die Frauen bereits
Medien und Sport sieht Matthias Marschik in der zuneh- sehr früh ihre Teilhabe ein, auch wenn ihnen von der
menden – und vielfach medial vermittelten – Über- Gesellschaft dafür lange Zeit schlimmste Folgen (Ver-
nahme sportlicher Normen und Werte in die Gesellschaft. männlichung, körperliche Schäden, Hysterie etc.) ange-
Soziales Denken oder Eintreten für die Schwächeren droht wurden.****
rücken gegenüber „sportlichen“ Werten wie Leistung,
Mit der Entdeckung des Sports durch die ArbeiterInnen-
Disziplin, Jugend und Männlichkeit (es gibt nur wenige
bewegung und dessen massenhafter Verbreitung stieg
Heldinnen im österreichischen Sport) in den Hintergrund:
auch der Frauenanteil im Sport. Während des Ersten Welt-
„Das sind alles Tugenden, die im Sport ebenso gefragt
kriegs ersetzten die Frauen vielfach die im Krieg abwesen-
und nötig sind wie im (neo-)liberalen Arbeitsleben. (...)
den Männer auf dem Fußballfeld und sogar im Stadion.
Wenn sich diese Werte im Sportleben bewähren und die
Nach dem Krieg wurden sie jedoch wieder von den rück-
bewunderten Sportstars nach diesen Prämissen erfolg-
kehrenden Männern „abgelöst“ und an den Herd zurück-
reich sind, ist es nahe liegend, diese Werte auch zur Basis
verwiesen. Und auch wenn Frauen bereits seit den Olym-
unseres eigenen Lebens zu machen, um gleichfalls Erfolge
pischen Spielen im Jahr 1900 zu einzelnen Wettkämpfen
zu erringen.“***
antreten durften, blieben viele der Disziplinen lange den
Männern vorbehalten. Auch die Aufteilung in „typische
Männersportarten“, die mit Körperkraft und Kampf ver-
* vgl. hier und im Folgenden: Marschik, 2007. S. 13f.
** Dimitriou, Minas; Mortsch, Christian: „Wir sind wieder Ski-Nation Nr. 1“.
In: medienimpulse – Beiträge zur Medienpädagogik Nr. 62/2007. S. 37. **** vgl. Zeilinger, Irene: Dabeisein ist nicht alles. Feministische Überlegungen
*** Marschik, 2007. S. 16. zu Frauenquoten im Sport. In: Frauensolidarität Nr. 3/2000: Sport. S. 11.
6 www. p olitik-ler ne n .atNr. 5 Spor t u n d Politik
bunden sind, sowie in „anmutige weibliche Sportarten“ oftmals stärkerer Aufsicht und erlernen seltener, Räume
hielt sich hartnäckig.* zu erobern.**** Neben der Bewusstmachung der bestehen-
den Ungleichheiten kann auch eine geschlechtersensible
Der Sport ist wie andere gesellschaftliche und kultu-
Erziehung zu Veränderungen beitragen.
relle Felder von hierarchischen Geschlechterverhältnis-
sen durchzogen. Diese Ungleichheiten zeigen sich nach
Tipp Film
Johanna Dorer u.a. in den folgenden Bereichen:
Kick it like Beckham
•• „Sportverbände (...) sprechen Zugangsverbote oder
Gurinder Chadha: Großbritannien/
-beschränkungen für Frauen in Bezug auf bestimmte
Deutschland 2002. 112 Minuten.
Sportarten aus.
Ab 12 Jahren.
•• Nationale Sportverbände bestimmen, wie viele Sportler Jess möchte genauso wie ihr großes
und Sportlerinnen bei Olympischen Spielen, Welt- und Vorbild David Beckham nichts
Europameisterschaften antreten dürfen und legen damit Anderes als Fußball spielen. Aber
meist ein Geschlechterverhältnis vor, das zu Ungunsten ihre traditionsbewussten Eltern
der Sportlerinnen ausfällt. haben andere Pläne für sie. Sie soll
studieren und einen netten Mann
•• Sportinstitutionen bestimmen auch die Bekleidungsvor-
heiraten. Doch so leicht gibt Jess nicht auf …
schriften, die Geschlechterunterschiede betonen oder wie
Auszuleihen z.B. über das BAOBAB Medienservice:
etwa beim Beach-Volleyball auf den voyeuristischen Blick
www.baobab.at/filme
eines männlichen Publikums setzen.
Filmheft mit Hintergrundinformationen:
•• Auf der Ebene der Verbands- und Vereinsfunktionäre sind www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34135/
Frauen von Entscheidungsprozessen weitgehend ausge- kick-it-like-beckham
schlossen, sodass ein Gutteil der Entscheidungs- und Defi-
nitionsmacht bei den Männern verbleibt.
Sport und sexuelle Orientierung
•• Staatliche und private Sponsoren (…) machen nicht sel-
ten Unterschiede zwischen Sportlerinnen und Sportlern.“** Eine der Schattenseiten des Sports ist die Diskriminie-
rung von lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen
Unterschiede zeigen sich auch zwischen den reichen,
(LGBTs) SportlerInnen, – die von ungeschriebenen bis
„westlichen“ Ländern und den ärmeren, „südlichen“ Län-
hin zu ausdrücklichen „Verboten“ von Homosexualität
dern. Mangelnde Akzeptanz von Frauensport sowie die
in bestimmten Sportarten reicht und zu welcher auch
frühzeitige Einbindung in die (Haus)Arbeit lässt Mädchen
homophobe Beschimpfungen durch Fans gehören.
wenig Zeit zur Ausübung sportlicher Aktivitäten. Des
Weiteren scheitert die sportliche Teilhabe von Frauen oft Die Ausstellung „Gegen die Regeln – Lesben und
an den fehlenden materiellen Mitteln – und sollten Mit- Schwule im Sport“, die von der European Gay and Les-
tel vorhanden sein, werden diese von Männern genutzt bian Sport Federation (EGLSF) initiiert wurde, greift
und verwaltet.*** Aber auch der „westliche“ Sport kann dieses Thema auf:
noch immer als „männlich dominiert“ bezeichnet werden.
Die Ausstellung versucht aufzuklären sowie über Homo-
Weibliche Teams sind weniger bekannt und weibliche
phobie und die Abwertung von LGBTs im Sport zu infor-
Sportstars verdienen erheblich weniger als ihre Kollegen.
mieren und nach Ursachen und Stereotypen zu fragen.
Einen Beitrag zur ungleichen Repräsentanz von Frauen Gleichzeitig will sie positive Identifikation schaffen:
und Männern im Sport leistet auch die unterschiedliche Neben queeren Sportvereinen und -veranstaltungen
Bewegungssozialisation von Mädchen und Buben in der werden 21 homosexuelle SportlerInnen, von Martina
Kindheit. Während Buben eher zur Erforschung ihres Navratilova bis zum britischen Fußballer Justin Fashanu,
Lebensraums motiviert werden, unterliegen Mädchen portraitiert.
* vgl. ebenda, S. 12. Die Ausstellung ist verfügbar bei VIDC – FairPlay:
** Dorer, Johanna: Mediensport und Geschlecht. In: medienimpulse – Bei- www.fairplay.or.at
träge zur Medienpädagogik Nr. 62/2007. S. 25.
*** vgl. Rosa Diketmüller: Sport Macht Frauen(Bewegung) Raum. Ein femi-
nistischer Streifzug durch die „letzte“ Männerdomäne. In: Frauensolidari-
tät 3/00: Sport. S. 3. **** vgl. ebd. S. 4.
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 7p o li s akt ue ll 2014
3 Politische Bildung und Fussball
3.1 F ussball und G ewalt /R assismus Was kann man also gegen Gewalt im und rund um das
Stadion tun? Rein repressiv, polizei- und ordnungsrecht-
Fußballstadien sind Orte, an denen auch Rechtsextre- lich dagegen vorzugehen ist, so sind sich die meisten
mismus und Rassismus sichtbar werden. Viele Clubs sind ExpertInnen einig, nicht alleine zielführend. Jugendli-
für ihre rechtsradikalen AnhängerInnen bekannt; Spie- che, die in Ausbildung oder Beruf desillusioniert werden
lerInnen „ausländischer“ Herkunft werden immer wie- und sich als „ModernisierungsverliererInnen“ sehen,
der – zum Teil auch von den eigenen Fans – beschimpft. benötigen vor allem Perspektiven für ihre Zukunft.
Auch die Heterogenität der Fangruppen hat zugenommen In der pädagogischen Arbeit mit gewalttätigen Fan-
und zur Gruppe der „erlebnisorientierten“ Fans sind die gruppen hat sich die Zusammenarbeit mit den Vereinen,
sogenannten „Hooligans“ und „Ultras“ hinzugekommen. mit Fanbeauftragten und SozialarbeiterInnen bewährt.
Eine weitere Entwicklung im Bereich der Fanszenen ist, So müssen Selbstregulierungsmechanismen innerhalb
dass sich die Gewalt der Fans vielfach auch vom Spielge- der Gruppe gestärkt und Möglichkeiten einer positiven
schehen gelöst hat.* Fan- und Anfeuerungskultur aufgezeigt werden. Proble-
matische Gruppen sollen dabei nicht von vornherein aus-
Tipp Links und Mater ialien geschlossen, sondern integriert werden.**
Handbuch gegen Rassismus der UEFA
Tipp Methodensammlung
Die UEFA hat zusammen mit dem
gesamteuropäischen Netzwerk gegen Lernort Stadion – Politische Bildung an Lernzentren in
Rassismus im Fußball (FARE) ein Fußballstadien
Handbuch herausgegeben, das darauf Robert Bosch-Stiftung in Zusammen-
abzielt, den populärsten Sport der arbeit mit der Bundesliga-Stiftung,
Welt von Rassismus zu befreien. Das 2013.
Handbuch enthält Hintergrundin- Politische Bildung funktioniert
formationen, stellt Antirassismus- gut über Themen, die an die kon-
Aktionen vor und gibt Anleitungen zum Handeln. krete Lebenswelt der Jugendlichen
http://de.uefa.org/newsfiles/82792.pdf anschließen. Fußball ist ein solches
Thema: Im Fußballstadion werden
Fußball und Rassismus
Werte wie Toleranz, Fair Play und Respekt „spielerisch“
Webdossier der Bundeszentrale für politische Bildung
vorgelebt, sodass sich Anknüpfungspunkte für poli-
zum Schwerpunkt Fußball und Gewalt. Hier finden Sie
tische Diskussionen ergeben. Auszug aus den erprobten
Artikel, Link- und Literaturtipps.
Übungen: „Mannschaftsaufstellung: Teamarbeit &
www.bpb.de/politik/extremismus/
Respekt“, „Datensammlung Doping“, „Fußball, Fans und
rechtsextremismus/41777/fussball-und-rassismus
Vorurteile“, „Berufsorientierung rund um das Stadion“
Sport und Gewaltprävention www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/51619.asp
Auf der Seite des Instituts für Friedenspädagogik Tübin-
gen e.V. / Berghof Foundation finden Sie u.a. Informatio-
nen zu folgenden Themen: Gewaltprävention im Fußball- Methodentipp „Gewalt und Rassismus im Sport“
verein, Gewinnen statt Hassen, Körperliche Betätigung Eine Anregung zur Auseinandersetzung im Unterricht
und Gewaltprävention, Streetballturniere u.v.m. mit diesen Schattenseiten des Sports findet sich auf
www.friedenspaedagogik.de/themen/fair_play/ Seite 15 dieses Hefts.
sport_und_gewaltpraevention__1
* vgl. u.a. Pilz, Gunter: Wandlungen des Zuschauerverhaltens im Profifuß- ** vgl. hier und im Folgenden: Interview mit Michael Gabriel: Politische
ball: Vom Kuttenfan und Hooligan zum postmodernen Ultra und Hooltra. Bildungsarbeit in Fanprojekten – Ansätze. Möglichkeiten. Grenzen.
In: kursiv – Journal für politische Bildung. Nr. 3/2005: Eine Menge Welt. In: kursiv – Journal für politische Bildung. Nr. 3/2005: Eine Menge Welt.
Fußball & Politik. S. 51f. Fußball & Politik. S. 63ff.
8 www. p olitik-ler ne n .atNr. 5 Spor t u n d Politik
Eine wesentliche Maßnahme in diesem Zusammenhang beziehen sich auf die asymmetrischen Beziehungen zwi-
ist die Förderung von Partizipationsmaßnahmen. Fragen schen „Geber“- und „Empfängerländern“, die durch diese
der Stadionmitgestaltung durch die Fans sind eine Mög- „Hilfsprogramme“ zementiert würden.**
lichkeit (z.B. gibt es Vereine, in denen die Stehplätze im
Stadion nach den Vorstellungen der Fans umgebaut wur- Tipp Mater ialien
den). Das Aufgreifen von Diskussionen und Vorfällen in
FairPlay-Workshops: Ein Leitfaden zu Globalem Lernen
der Fankurve ist eine andere wesentliche Voraussetzung
und Inklusion durch Sport
erfolgreicher Fanarbeit. Einige Vereine organisieren
VIDC – Wiener Institut für Internatio-
interkulturelle Jugendbegegnungen bzw. Treffen mit den
nalen Dialog und Zusammenarbeit
Fangruppen anderer Vereine, um zum gegenseitigen Ver-
(Hg.), 2014.
ständnis beizutragen.
Der Leitfaden ist das Ergebnis zahl-
Wichtig ist es auch, Fanprojekte weit in die Gesellschaft reicher durchgeführter FairPlay-
hineinreichen zu lassen, um eine übergroße Identifika- Workshops im Bereich Sport und Ent-
tion mit der Fankultur zu durchbrechen. Für die gewalt- wicklung sowie Sport und Inklusion.
tätigen Fans müssen Möglichkeiten geschaffen werden,
Fußball für Entwicklung
Erfolgserlebnisse auf anderen Gebieten zu sammeln. Und
VIDC – Wiener Institut für Internatio-
die Vereine sind durchaus in der Pflicht, sich der Proble-
nalen Dialog und Zusammenarbeit und
matik gewaltbereiter Fans anzunehmen und „ihren“ Fans
INEX-SDA (Hg.), 2011.
entsprechende Angebote zu machen.
Handbuch für Lehrkräfte und
JugendarbeiterInnen zur entwick-
3.2 F ussball und E nt wicklung lungspolitischen Bildung durch
Fußball mit praktischen Übungen für
Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen wird Jugendliche von 12 bis 19 Jahren.
von vielen auch das Potential, soziale Entwicklung vor- Beide Materialien als kostenloser Download unter:
anzutreiben, zugeschrieben. So unterstützten die Ver- www.nossojogo.at/materialien/info-materialien/
einten Nationen den Gedanken „Sport für Entwicklung“
u.a. durch die Verabschiedung einer UN-Resolution
sowie durch das Jahr des Sports 2005. 2013 erklärte
3.3 F ussball und F air P lay
die Generalversammlung der Vereinten Nationen den
In den letzten Jahren wird im Sport auch verstärktes
6. April zum „Internationaler Tag des Spor ts im Dienste
Augenmerk auf „Fair Play“ gelegt. Vereine und Organi-
von Entwicklung und Frieden“. Organisationen der Ent-
sationen wie die FIFA achten zunehmend darauf, Aktio-
wicklungszusammenarbeit nutzen Programme in Zusam-
nen zu Fair Play zu initiieren bzw. zu unterstützen. Mög-
menhang mit Sport, um dabei auch Themen wie Bildung,
lichkeiten dazu bietet wie bereits erwähnt v.a. die Fan-
Gleichstellung, Versöhnung und Gesundheit – z.B. HIV/
arbeit. Aber auch Image-Kampagnen mit namhaften
AIDS-Aufklärung – (mit) zu transportieren. Zahlreiche
SportlerInnen als UnterstützerInnen wurden ins Leben
Sportverbände und Organisationen engagieren sich auch
gerufen, um den Fair Play-Gedanken breit bekannt zu
sozial und unterstützen Projekte wie „Football for Hope“
machen.
oder „Football for Development“.*
3.3.1 Doping
Diesem Anspruch stehen KritikerInnen gegenüber, die die
Wirksamkeit bzw. die messbaren Ergebnisse dieser Pro- Zur Auseinandersetzung mit Fair Play gehört auch der
gramme und Initiativen in Frage stellen und zudem vor Bereich Sport und Doping. Durch Dopingskandale bei der
der Aufladung des Sports als allumfassendem „Heilsbrin- Tour de France oder den Olympischen Spielen ist das Pro-
ger“ warnen. Auch der Gedanke, dass Sport als „Instru- blem, welches in den vergangenen Jahren an Bedeutung
ment der Disziplin und Disziplinierung“ eingesetzt wird, gewonnen hat, noch stärker in den Mittelpunkt gerückt.
steht zur Diskussion. Weitere kritische Überlegungen
** Mehr zu diesen Überlegungen findet sich z.B. bei: Wachter, Kurt: Spor t
für soziale Entwicklung – Neue soziale Bewegung oder neo-koloniales
* vgl. Hudelist, David u.a. In: FairPlay-Workshops: Ein Leitfaden zu Globa- Entwicklungsmodell? In: Wer nicht hüpft ... Inklusion und Exklusion im
lem Lernen und Inklusion durch Sport VIDC – Wiener Institut für Interna- Sport. stimme – Zeitschrif t der Initiative Minderheiten, Nr. 88/2013.
tionalen Dialog und Zusammenarbeit (Hg.), 2014. S. 6. S. 17f f sowie Hudelist u.a., 2014. S. 6.
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 9p o li s a kt ue ll 2014
Sind Siege ohne Doping überhaupt noch möglich? Gewin- 3.3.2 Straßenfußball für Toleranz
nen nicht die Talentiertesten, diejenigen, die am här-
Das in Kolumbien entwickelte Konzept „Straßenfußball
testen trainiert haben, sondern jene, die im Hintergrund
für Toleranz“ enhält Elemente aus der Gewaltpräven-
die „besten“ Pharmafirmen, „SpezialärztInnen“ und
tion und Friedenspädagogik. Spezielle Maßnahmen wie
„Test(vermeidungs)labors“ besitzen?* Gründe für diese
gemischtgeschlechtliche Teams, eine Spielbegleitung
Entwicklung liegen u.a. in der zunehmenden wirtschaft-
durch sogenannte Teamer anstatt SchiedsrichterInnen,
lichen Bedeutung des Sports. Die SpitzensportlerInnen
welche das Spiel im Falle von Auseinandersetzungen ver-
als WerbeträgerInnen werben für Produkte, welche im
mittelnd begleiten, sowie die Gleichwertigkeit von Fair
Breitensport gekauft werden sollen. Um erfolgreiche Wer-
Play-Punkten und Toren wirken „Macho-Verhalten“ und
beträgerInnen zu sein, müssen sie siegen. Unter diesem
Gewaltbereitschaft entgegen. Mit Hilfe des Spiels soll ein
Druck, der auf den SportlerInnen lastet, gewinnen auch
anderer Umgang mit Konfliktsituationen erlernt werden.
Doping und andere Betrügereien an Einfluss.**
Tipp Handreichung
Tipp Links und Mater ialien
Straßenfußball für Toleranz. Handreichung für Jugend-
FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel.
arbeit, Schule und Verein
Die Initiative FairPlay
Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. (Hg.), 2006
führt mit Verbänden,
Die Spielregeln sowie weitere Informationen zum Einsatz
Vereinen, Fanclubs,
des Konzepts finden Sie unter:
MigrantInnen- und Jugendorganisationen Aktivitäten
www.friedenspaedagogik.de/themen/fair_play/
gegen Diskriminierung im österreichischen Fußball und
strassenfussball_fuer_toleranz
Sport durch und bietet neben Beratung und Monitoring
u.a. auch Workshops für Jugendliche an.
http://fairplay.vidc.org 3.3.3 Fair produzierte/gehandelte Fußbälle
Unterrichtsmaterial zu Fair Play Auch fairer Handel und gerechte Bezahlung sowie sozia-
Arbeitsblätter, Bildmaterial, ausgearbeitete Unterrichts- le Absicherung für diejenigen, die in der Sportartikel-
einheiten, Fair Play-Geschichten, sportpraktische Tipps, industrie arbeiten, gehören zum Fair Play. So möchte
Cartoons, vertiefende wissenschaftliche Texte, Stellung- beispielsweise „Jugend Eine Welt“ über fair gehandelte
nahmen von SportlerInnen zum Fair Play-Gedanken, etc. Fußbälle die Arbeitsbedingungen der NäherInnen in Län-
Die Seite eignet sich gut für die selbständige Onlinearbeit dern wie Pakistan verbessern. Die ArbeiterInnen, welche
von SchülerInnen. die Fußbälle herstellen, werden gerecht entlohnt und
www.sportunterricht.de/fairplay sind sozial abgesichert. Ein Teil des Verkaufspreises geht
an Projekte zur Unterstützung von Kindern in Afrika,
Unterrichtsmaterial zu Doping
Asien, Lateinamerika und Osteuropa.
Hintergrundinformationen, Unterrichtsideen und zahl-
reiche Materialien für die Oberstufe.
Tipp Link
www.sportunterricht.de/lksport/doping.html
Der EINE Welt-Fußball aus fairer Produktion
Sport ohne Doping
Eine Aktion von Jugend Eine Welt,
Die Arbeitsmedienmappe – herausgegeben vom deut-
EZA/Weltläden und GEA.
schen Olympischen Sportbund, der deutschen Sportju-
Der in Pakistan produzierte „Welt-
gend und dem Zentrum für Dopingprävention der Päda-
ball“ wird unter fairen Arbeitsbedin-
gogischen Hochschule Heidelberg – enthält Wissen und
gungen hergestellt. Der Mehrpreis
Fakten zu Anti-Doping sowie Arbeitsblätter und Metho-
garantiert, dass die NäherInnen ihre
dentipps, die sich auch für den Einsatz im Unterricht eig-
Familien ernähren können. Ihre Kinder können zur Schule
nen. Empfohlen u.a. durch den ePilot von schule.at:
gehen und müssen nicht arbeiten, um zum Familienein-
http://epilot.schule.at/?p=12923#more-12923
kommen beizutragen. Außerdem werden durch die Fair-
* vgl. Schubert, Franz: Die fünf dopaminen Ringe. Die Kehrseite des trade-Prämien Gesundheitsversorgung, Sozialleistungen
Jubels: Der Fluch des Dopings. In: medienimpulse – Beiträge zur Medien-
pädagogik Nr. 62/2007. S. 32. und ein Kleinkreditprogramm ermöglicht.
** vgl. Zeilinger, Irene: Dabeisein ist nicht alles. Feministische Überlegun- www.jugendeinewelt.at/3915.0.html
gen zu Frauenquoten im Sport. In: Frauensolidarität Nr. 3/00: Sport. S. 13.
10 www. politik-ler n en .atNr. 5 Spor t u n d Politik
4 Arund
ngebote und U nterrichtsmaterialien
um F ussball und die WM 2014
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 findet von 12. Juni Fußball-Workshop „Fair Pay: Fair Play“
bis 13. Juli in Brasilien statt. Zahlreiche Organisationen Südwind Agentur, österreichweit, Termine nach Vereinbarung,
bieten Veranstaltungen und Unterrichtsmaterialien zur für 8-11 Jahre, 11-15 Jahre sowie Jugendliche und Erwachsene
lustvollen sowie kritischen Auseinandersetzung mit der Der Workshop widmet sich dem wichtigsten Teilnehmer im
WM und ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen an. Spiel: dem Ball! Wo wird er hergestellt? Wie wird in Grön-
land, Nepal oder Brasilien Fußball gespielt? Wer verdient
4.1 W orkshops für S chulklassen am Fußballsport? Die Antworten auf diese Fragen vermit-
teln ein Verständnis für die kulturellen, ökonomischen
und sozialen Strukturen des Fußballsports.
NOSSO JOGO – Initiative für globales Fair Play
www.suedwind-agentur.at/start.asp?ID=239911&b=264
Rund um die Fußball-
Weltmeisterschaft will die Kann ein Fußball fair sein?
entwicklungspolitische Ini- Südwind Niederösterreich Süd, Termine nach Vereinbarung,
tiative „NOSSO JOGO“ alter- für Kinder und Jugendliche von 8-14 Jahren
native Sichtweisen auf das Gastgeberland Brasilien eröff- Wer hat eine Ahnung, wo und unter welchen Bedingungen
nen. Hauptorganisatoren der von der Österreichischen Fußbälle genäht werden? Und wie funktioniert das
Entwicklungszusammenarbeit geförderten Initiative sind eigentlich mit der letzten Naht? In kleinen Teams werden
das Lateinamerikainstitut, Jugend Eine Welt, Südwind, Bälle selbst genäht, Produktionsländer auf der Weltkarte
Frauensolidarität, Globalista und FairPlay/vidc. Neben gesucht etc. und so den TeilnehmerInnen die Zusammen-
Informationen zu Brasilien und der WM bietet die Initia- hänge zwischen Sport, Mode und Konsumverhalten in
tive Workshops für unterschiedliche Altersgruppen, z.B.: Europa mit den Arbeitsbedingungen in Pakistan, Indien
oder China nähergebracht.
• Workshops zur Fußball-WM für die 1. bis 6. Schulstufe
www.suedwind-noesued.at/index.php?article_id=14
Themen: Unsere Rechte – unser Spiel, Mehr Platz –
hier spielen wir, Meu mundo – Kinderalltag in Brasi-
lien, Anpfiff für Kinderrechte 4.2 U nterrichtsmaterialien
• FairPlay
Die Welt ist rund: Fußballträume – Fußballrealitäten
Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen
Filme für eine Welt (CH), BAOBAB (A),
können zur Förderung der Entwicklung, Teilhabe
EZEF (D) (Hg.), 2005, 5 Dokumentar-
und Gleichstellung von jungen Menschen beitragen.
filme, 120 Min., ab 10 Jahren
Darauf aufbauend bietet FairPlay/VIDC Workshops zu
Fünf Filme schaffen Begegnungen mit
den Themen globales Lernen und soziale Inklusion an.
Kindern und Jugendlichen über eine
• Arbeits- und Frauenrechte der populärsten Sportarten der Welt.
Zur Kritik im Vorfeld der WM gehören vor allem die Unterschiedliche Themen wie Fairer
enormen Kosten des Projekts und mit dem Ereignis Handel, Menschenrechte oder Begeg-
zusammenhängende Menschenrechtsverletzungen. nungen über soziale Grenzen hinweg werden aufgegrif-
Der Workshop beleuchtet diese Missstände und fen. Die Filme bieten einen Einblick in den Alltag von
nimmt dabei die Frage der Arbeits- und Frauenrechte Buben und Mädchen in Afrika, Asien und Lateinamerika
besonders in den Fokus. und erzählen von ihren Wünschen und Perspektiven.
Zusätzlich zu den Filmen bietet die DVD umfangreiche
Informationen zu allen drei Workshops unter:
Begleitmaterialien und didaktische Impulse.
www.nossojogo.at/workshops
Zu beziehen über BAOBAB: www.baobab.at
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 11p o li s a kt ue ll 2014
Brasilien: Land im Wandel „Fußball im Unterricht“ auf lehrer-online.de
Politik & Unterricht, Heft 1/2014, Unterrichtseinheiten für die
Landeszentrale für politische Bildung unterschiedlichsten Fächer
Baden-Württemberg (Hg.), 2014 (Geografie, Mathematik, Fremd-
Das Heft thematisiert die politischen sprachenunterricht etc.) und
und gesellschaftlichen Bedingungen verschiedene Schulstufen widmen sich dem Thema „Fuß-
in der heute siebtgrößten Wirtschafts- ball“ und seiner sozialen, politischen und gesellschaft-
nation der Welt. Es beleuchtet die Aus- lichen Bedeutung; darunter eine „Internetrallye zur WM
wirkungen der fortschreitenden Glo- 2014“, die die SchülerInnen u.a. dazu anregt, sich auch
balisierung und die Chancen und Risiken des von großen mit den Schattenseiten der WM auseinanderzusetzen
Kontrasten und sozialer Ungleichheit geprägten Landes. oder eine Einheit „WM 2014: Event und Proteste“ zu den
Als kostenloser Download unter: www.lpb-bw.de/index. Argumenten von WM-GegnerInnen.
php?id=995&backPID=3127&tt_products=3086 www.lehrer-online.de/fussball.php
Der Bürger im Staat: Brasilien Onlinespiel: GLOBO – Welt-Quiz zur Fußball WM
Der Bürger im Staat Heft 1/2-2013, Landeszentrale für politische Bildung
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hg.), 2014
Baden-Württemberg (Hg.), 2013 Es gilt, die Teilnehmerländer des
Eine umfassende Bestandsaufnahme Turniers auf der Weltkarte ausfindig
des größten lateinamerikanischen zu machen. Wer noch mehr als die
Landes – vom politischen System über geografische Lage kennen möchte,
die weltwirtschaftliche Rolle Brasili- kann Hauptstädte, Einwohnerzahlen,
ens bis hin zu den sozialen und ökolo- Flächen, Währungen und mehr abfragen. Alle diese Län-
gischen Herausforderungen. derporträts können auch ausgedruckt werden.
Als kostenloser Download unter: www.lpb-bw.de/index. www.lpb-bw.de/onlinespiele/brasil2014
php?id=995&backPID=2456&tt_products=3038
„Fußball – und was geht noch?“ und „Erfolgsstory Brasi-
lien?!“ SchülerInnen-LehrerInnen-Materialien Fußball-WM und Brasilien
MISEREOR u.a. (Hg.), 2014 Informationen für die Volksschule
Das Materialset für die schulische
Demokratiewebstatt: Fußball und Politik
(Sek. I) und außerschulische Bildungs-
www.demokratiewebstatt.at/thema/fussball/
arbeit spricht u. a. folgende Themen
was-haben-fussball-politik-miteinander-zu-tun/
an: die Auswirkungen sportlicher Gro-
ßereignisse auf die Bevölkerung des Fußball in der Volksschule auf schule.at
Gastgeberlandes, die wirtschaftliche www.schule.at/portale/volksschule/wochenthemen/
Entwicklung und soziale Ungleichheit detail/fussball-in-der-volksschule.html
im Schwellenland, Bedrohung durch Gewalt, Landvertei-
Fußball-Spezial im Kidsweb
lung und Landvertreibung, Futtermittel- und Energie-
www.kidsweb.at/sport-freizeit/freizeit/fussball-wm/
pflanzenanbau, Regenwaldzerstörung, Initiativen zur
www.kidsweb.de/schule/fussball_spezial/fussball_
Armutsbekämpfung und Jugendbildung.
spezial.html
www.misereor.de/service/lehrer/mittelstufe.html
Landesporträt Brasilien auf Hanisauland
ZiS aktuell: Thema Fußball
www.hanisauland.de/spezial/laenderdossier/
ZiS aktuell Nr. 2/2014, Zeitung
laenderdossier-alphabetisch/laender-az/0102
in der Schule (Hg.), 2014
Ausgewählte Zeitungsartikel Brasilien-Quiz der Kindernothilfe
mit Arbeitsaufgaben für den Einsatz ab der 7. Schulstufe www.robinson-im-netz.de/Info/Land+und+Leute/Bra-
– geeignet für die wirtschaftlichen Fächer, Geschichte/ silien/Brasilien_Quiz.html
Politische Bildung, Geografie und Mathematik.
www.zis.at
12 www.politik-ler ne n .atNr. 5 Spor t u n d Politik
5 Unterrichtsbeispiele
5.1 S portler I nnen und S taatsbürgerschaft
Dauer mindestens 2 Stunden bzw. auch als Projekt über einen längeren Zeitraum geeignet
Schulstufe 11.-13. Schulstufe
Methoden Diskussion, Rechercheaufgabe, Präsentation
Materialien Flipchartpapier, Internetzugang
Kompetenzen Methodenkompetenz, Urteilskompetenz
Zielsetzungen Die SchülerInnen sollen für die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Sport und Politik sen-
sibilisiert werden sowie ihre Einstellung zum Thema Sport und Staatsbürgerschaft hinterfragen.
Lehrplanbezug Politische Bildung, Deutsch, Religion/Ethik
Ablauf Diskussionseinstieg
Als der in Kroatien geborene österreichische Nationalspieler Ivica Vastić im Spiel gegen Chile bei der
Fußballweltmeisterschaft 1998 in letzter Minute das Ausgleichstor für Österreich erzielte, titelte die
Kronenzeitung am nächsten Tag: „Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher!“.
1. Nach einer kurzen Bedenkzeit sollen die SchülerInnen zu dieser Schlagzeile eine erste Stellung-
nahme abgeben.
2. Stellen Sie anschließend Impulsfragen und lassen Sie die SchülerInnen ihre Überlegungen auf
Plakaten festgehalten.
Beispiele für Impulsfragen
• Was ist ein „echter“ Österreicher?
• Wäre Vastić kein echter Österreicher, hätte er den Ball neben das Tor gesetzt?
• Sind nicht alle österreichischen StaatsbürgerInnen gleich?
• Bedarf es besonderer Leistungen, damit ein im Ausland geborener Mensch als ÖsterreicherIn
akzeptiert wird?
• Hat eine Zeitung das Recht, ein solches Urteil zu fällen?
• Wie stellt sich die Thematik vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Europas dar?
• Erhöht auch bei ausländischen NichtsportlerInnen ein beruflich erfolgreiches Leben deren
Akzeptanz?
3. Lassen Sie die SchülerInnen auch alle Überlegungen festhalten, die über das konkrete Beispiel
hinausgehen und von diesen Fragen berührt werden: z.B. SportlerInnen, die für Österreich
Erfolge errungen haben, aber im Ausland geboren sind; Sportarten, in denen Nationalmann-
schaften oder Vereine mit einer besonders hohen Zahl an „AusländerInnen“ oder eingebürger-
ten ÖsterreicherInnen bei Wettkämpfen antreten; örtliche Vereine, in denen „AusländerInnen“
zum sportlichen Erfolg beitragen sollen etc.
Internetrecherche
Paarweise oder maximal zu dritt versuchen die SchülerInnen mittels Internetrecherche zu den
gesammelten Fragen und Themenbereichen Näheres in Erfahrung zu bringen (Beispiele für Arbeits-
aufträge finden Sie in der Kopiervorlage auf Seite 14 dieses Hefts).
tw i tte r. c o m/ Z e ntr um _poli s 13p o li s a kt ue ll 2014
Weitere Recherchemöglichkeiten
Im Zuge einer ersten Besprechung ihrer Ergebnisse mit der Lehrkraft sollen die SchülerInnen fest-
stellen, wo noch zusätzliche Informationen hilfreich wären. In einem Arbeitsauftrag (Zeit ca. eine
Woche) können die SchülerInnen beispielsweise Folgendes tun:
• Fragen vorbereiten und Straßeninterviews durchführen. Fragen könnten z.B. lauten: „Einbür-
gerung von SportlerInnen vs. Aufnahmestopp für AusländerInnen – was halten Sie davon?“,
„Spielt es für Sie ein Rolle, wenn SportlerInnen aus dem Ausland für Österreich Erfolge errin-
gen?“, „Was halten Sie von der Krone-Schlagzeile 'Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher!',
nachdem er ein wichtiges Tor für Österreich erzielt hat?“
• Selbstständig E-Mails formulieren und an NGOs oder öffentliche Stellen (Ministerien, Landes-
regierung, Parteien) senden, um nähere Informationen zu erbitten bzw. telefonische Anfragen
an ebendiese richten.
• Anfragen direkt an SportlerInnen oder Vereine richten bzw. direkt in örtlichen Sportvereinen
Recherchen anstellen.
• Sammeln von Berichten in Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendungen.
Präsentation
Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse und nimmt dazu Stellung. Auch die Schwierigkeiten bei der
Recherche sollen thematisiert werden. Das gesammelte Material soll anschaulich strukturiert sein.
Bei entsprechenden technischen Möglichkeiten können die Ergebnisse in einem Webprojekt zusam-
mengefasst und online zugänglich gemacht werden; oder es entwickelt sich eine Schulausstellung
daraus.
Link- und • Barbara Liegl, Georg Spitaler: Legionäre am Ball. Migration im österreichischen Fußball nach
Literaturtipps 1945. Wien: Braumüller, 2008.
• Das FARE-Netzwerk will den Rassismus aus dem Fußball vertreiben, in dem es die Ressourcen
von sich engagierenden Fußball-Organisationen in ganz Europa vereint: www.farenet.org
Autor Christoph Wagner
Kopier vorlage Arbeitsauf träge
1. Sammle zu drei SportlerInnen, die im Ausland gebo- 3. Welche Nationalmannschaften setzen sich vor
ren sind und heute die österreichische Staatsbürger- allem aus im Ausland geborenen ÖsterreicherInnen
schaft besitzen, Informationen zu ihrem Lebenslauf zusammen? Was sagen die nationalen/internationa-
und ihren sportlichen Erfolgen. Warum leben sie in len Bestimmungen in der jeweiligen Sportart bezüg-
Österreich? Was sind die Gründe für ihre Einbürge- lich des Einsatzes von eingebürgerten SpielerInnen?
rung? Wird in Zeitungsberichten auf ihre nationale Aus welchen Ländern stammen die SpielerInnen?
Herkunft eingegangen? Gibt es bestimmte Gründe für die Einbürgerungen?
Macht es im Erfolgsfall für die Öffentlichkeit einen
2. Finde Beispiele für österreichische Vereinsmann- Unterschied, wo SportlerInnen geboren sind?
schaften, die vor allem auf ausländische SpielerIn- Wie sieht die Meinung bei Misserfolgen aus?
nen setzen, um national oder international erfolg-
reich zu sein. Woher kommen die SpielerInnen? 4. Was sagt das österreichische Recht zur Vergabe der
Wann werden sogenannte „LegionärInnen“ österrei- Staatsbürgerschaft? Warum können Berufssportle-
chischen SpielerInnen vorgezogen? Wie reagieren rInnen oft rascher eingebürgert werden? Wie sehen
die Zeitungen auf Erfolge bzw. Misserfolge solcher diese Bestimmungen für andere BewerberInnen aus?
„Legionärsmannschaften“?
14 www.politik-ler n en .atSie können auch lesen