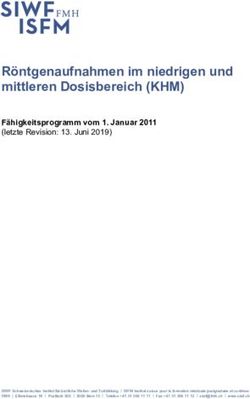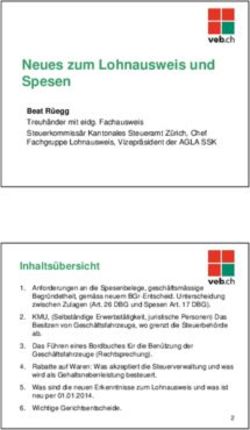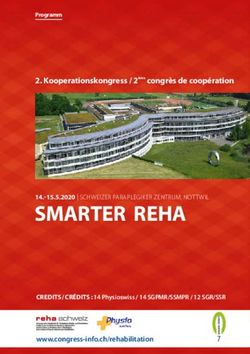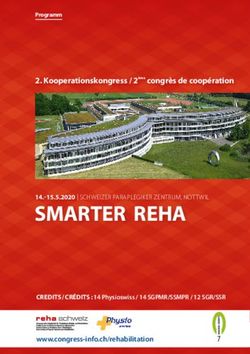STELLUNGNAHME DER REGIERUNG AN DEN LANDTAG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN ZU DEN ANLÄSSLICH DER ERSTEN LESUNG BETREFFEND DIE ABÄNDERUNG DES ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
STELLUNGNAHME DER REGIERUNG AN DEN LANDTAG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN ZU DEN ANLÄSSLICH DER ERSTEN LESUNG BETREFFEND DIE ABÄNDERUNG DES UMWELTSCHUTZGESETZES (MOBILFUNKSTANDARD 5G) AUFGEWORFENEN FRAGEN Behandlung im Landtag Datum 1. Lesung 11.06.2021 2. Lesung Schlussabstimmung Nr. 78/2021
3 INHALTSVERZEICHNIS Seite Zusammenfassung .................................................................................................. 4 Zuständiges Ministerium......................................................................................... 4 Betroffene Stellen ................................................................................................... 4 I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG ......................................................... 5 1. Allgemeines ................................................................................................... 5 2. Grundsätzliche Fragen ................................................................................... 6 2.1 Erhöhung der Grenzwerte und zusätzliche Standorte ......................... 6 2.2 Ausreichende Kapazität bei der Standortkoordination ....................... 7 2.3 Berücksichtigung der zeitlichen Komponente ..................................... 7 2.4 Technische Umsetzung und Finanzierung neuer Standorte ................ 8 2.5 Gesamtstrahlenbelastung in Liechtenstein bei 5G-Einführung ........... 9 2.6 Konsequenzen bei Beibehaltung der heutigen Bestimmungen ........ 10 2.7 Grenzwerte auf Verordnungsebene und weitere Regelungsunterschiede zwischen Liechtenstein und der Schweiz .... 10 2.8 Zentrales Mobilfunknetz .................................................................... 12 2.9 Grenzwerte und betriebswirtschaftliche Führung eines 5G- Netzes ................................................................................................. 13 2.10 Vollzugshilfe ....................................................................................... 13 3. Fragen zu einzelnen Artikeln ....................................................................... 14 II. ANTRAG DER REGIERUNG ..................................................................... 16 III. REGIERUNGSVORLAGE .......................................................................... 17
4 ZUSAMMENFASSUNG In der Sitzung vom 11. Juni 2021 hat der Landtag die Regierungsvorlage betref- fend die Abänderung des Umweltschutzgesetzes (Mobilfunkstandard 5G) in erster Lesung beraten. Das Eintreten auf die Gesetzesvorlage war unbestritten und die Vorlage wurde grundsätzlich begrüsst. Anlässlich der ersten Lesung wurden verschiedene grundsätzliche Fragen gestellt, so insbesondere zu den Grenzwerten, zu zusätzlichen Standorten, deren Kosten und zur Standortkoordination. Ausserdem wurden Präzisierungen zum Inhalt der Vollzugshilfe zu adaptiven Antennen gewünscht. Des Weiteren wurde ein Vor- schlag zu Art. 35 eingebracht. Dieser wurde geprüft und in die Vorlage aufge- nommen. Mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie vom zuständigen Regierungs- mitglied nicht bereits während der Landtagsdebatte beantwortet wurden. ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt BETROFFENE STELLEN Amt für Umwelt Amt für Kommunikation
5 Vaduz, 5. Oktober 2021 LNR 2021-1373 P Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung der Regierungsvorlage betreffend die Abän- derung des Umweltschutzgesetzes (BuA Nr. 45/2021) aufgeworfenen Fragen zu unterbreiten. I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 1. ALLGEMEINES In der Landtagssitzung vom 11. Juni 2021 hat der Landtag den Bericht und An‐ trag betreffend die Abänderung des Umweltschutzgesetzes (BuA Nr. 45/2021) in erster Lesung beraten. Das Eintreten war unbestritten und erfolgte einhellig. Anlässlich der Eintretensdebatte sowie im Zuge der ersten Lesung gab es einige grundsätzliche Fragen zur Thematik sowie eine Frage zu einem Artikel der Geset- zesvorlage. Diese Fragen werden im Folgenden in den Kapiteln 2 und 3 beant- wortet.
6 2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 2.1 Erhöhung der Grenzwerte und zusätzliche Standorte Es wurde die Frage gestellt, ob die Grenzwerte erhöht werden müssen, damit 5G eingeführt werden kann, oder ob dazu eine Erweiterung der 23 Sendeanlagen bei Einhaltung der Grenzwerte für nichtionisierende Strahlung (NIS) nötig sei. Dies- bezüglich wurde gefragt, wie viele zusätzliche Standorte dann theoretisch nötig wären, falls erweitert werden müsste. Diese Fragen wurden bereits im Rahmen der ersten Lesung durch das zuständige Regierungsmitglied weitestgehend beantwortet. Zusammenfassend und ergän- zend kann hierzu ausgeführt werden, dass mit der vorliegenden Anpassung des Umweltschutzgesetzes (USG) und der Anwendung der Vollzugshilfe von Februar 2021 des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt (BAFU) analog zur Schweiz die Grundlagen zur Verfügung stehen, um 5G unter Beibehaltung der Grenzwerte einführen zu können. Aufgrund des weitgehend ausgeschöpften Leistungsbudgets ist mit dem Bau von neuen Standorten zu rechnen. In der Interpellationsbeant- wortung Nr. 51/2020 betreffend die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards in Liechtenstein, welche der Landtag im Juni 2020 behandelt hat, wurde von einer Verdreifachung von 23 auf künftig rund 60 Anlagen ausgegangen. Diese Abschät- zung basierte auf dem Bericht „Mobilfunk und Strahlung“ des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK-Bericht) vom November 2019. Mit der im Februar 2021 veröffentlichten Vollzugshilfe des BAFU, konkret mit der Einführung eines Korrekturfaktors für adaptive Antennen, kann davon ausgegangen werden, dass dadurch weniger neue Antennen erfor- derlich sein werden als ursprünglich geschätzt. Wie viele neue Antennen es effek- tiv braucht, ist eine Frage der betreiberseitigen Netzgestaltung.
7 2.2 Ausreichende Kapazität bei der Standortkoordination Unter Bezugnahme auf die NIS-Verordnung (NISV) wurde gefragt, wie der Begriff „ausreichend Kapazität“ im Zusammenhang mit der Standortkoordination (Art. 12 NISV) ausgelegt wird und, ob es in der Vergangenheit schon Fälle gab, die zu einem Verzicht dieser Koordination geführt haben. Gemäss Art. 12 NISV sind die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, Standorte unterei- nander zu koordinieren und gemeinsam zu nutzen, sofern ausreichend Kapazität zur Verfügung steht und keine anderen Gründe dies verunmöglichen. Seit dem Erlass der Verordnung gab es keine Fälle, die zu einem Verzicht der Koordination geführt haben. „Ausreichende Kapazität“ bedeutet, dass die Koordination kein Hindernis hin- sichtlich der zur Mobilfunkversorgung benötigten Sendeleistung sein darf. Vorbe- halten bleibt die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte. Können die Mobil- funkbetreiber darstellen, dass die zur Mobilfunkversorgung erforderliche Sende- leistung aufgrund der Koordination nicht bereitgestellt werden kann, wären die Mobilfunkbetreiber berechtigt, einen zusätzlichen Standort zu suchen. 2.3 Berücksichtigung der zeitlichen Komponente Ein Landtagsabgeordneter wollte wissen, ob bei der Beurteilung der Einhaltung des Anlagegrenzwertes die zeitliche Komponente in der Abstrahlcharakteristik adaptiver Antennen berücksichtigt werden kann, wenn diese Komponente nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt wird. Es werde davon ausgegangen, dass diese Komponente auf Verordnungsebene geregelt werde. Die massgebende rechtliche Bestimmung soll aus der schweizerischen NISV gleichlautend ins liechtensteinische USG (Art. 34 Abs. 3) übernommen werden. Konkret soll im Gesetz festgehalten werden, dass bei adaptiven Antennen die
8 Variabilität der Senderichtungen und der Antennendiagramme zu berücksichtigen ist. Mit dieser neuen Regelung besteht die Pflicht, adaptive Antennen entspre- chend ihrer besonderen Eigenschaften zu beurteilen, insbesondere ihrer Fähig- keit, automatisch in kurzen zeitlichen Abständen ihre Senderichtung anzupassen. Diese zeitliche Komponente ist im Begriff der Variabilität impliziert und wird in der Vollzugshilfe des BAFU zu adaptiven Antennen beschrieben. Diese Vollzugshil- fe soll, wie auch in anderen Umweltbereichen zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe üblich, auch in Liechtenstein angewendet werden. Eine Regelung auf Verordnungsebene ist rechtlich nicht erforderlich. 2.4 Technische Umsetzung und Finanzierung neuer Standorte Bezüglich der Umsetzung und Finanzierung neuer Standorte wurde die Frage gestellt, wie – sofern die Regierung tatsächlich die restriktiven, gesetzlichen Re- gelungen der Schweiz weiterhin verfolgen wolle und diese Haltung auch für Liechtenstein weiterhin als zielführend angesehen werde – die 5G-Technologie für Liechtenstein implementiert werden könnte, ohne dass der technologische Anschluss aufgrund der vorhandenen Gesetzgebung dafür verloren ginge. Insbe- sondere interessierte, wer für die aufgrund der Gesetzgebung benötigte grössere Anzahl neuer Basisstationen schlussendlich bezahle. Wie unter 2.1 ausgeführt, stehen mit der gegenständlichen Anpassung des USG die Grundlagen zur Verfügung, um 5G unter Beibehaltung der Grenzwerte einfüh- ren zu können. Die Kosten für den Netzaufbau und den Betrieb der Mobilfunknet- ze sind von den Betreibern zu tragen. Die Entscheidung über die technische Aus- gestaltung der Netze, die Anzahl der Sendeanlagen und den Einsatz der einzelnen Mobilfunktechnologien liegen bei den Betreibern. Die den Betreibern vom Amt für Kommunikation zugeteilten Frequenzen können unabhängig davon technologie- neutral verwendet werden.
9 Der Regierung ist es wichtig, den Wirtschaftsstandort Liechtenstein so attraktiv als möglich zu gestalten und die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit modernsten Technologien sicherzustellen. Gleichzeitig sind auch Fragen der Belastung durch Mobilfunkstrahlung und die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes durch neue zusätzliche Antennenanlagen zu berücksichtigen. 2.5 Gesamtstrahlenbelastung in Liechtenstein bei 5G-Einführung Ein Abgeordneter stellte die Frage, ob 5G nun wirklich eine Reduktion der Mobil- funkstrahlung bringe, wie es von Seiten der Mobilfunkbetreiber dank der adapti- ven Antennentechnik versprochen werde. Die Regierung wurde gebeten, detail- lierte Informationen zur Gesamtstrahlenbelastung zu geben. Aufgrund dessen, dass adaptive Antennen ihr Signal (tendenziell) in die Richtung des Nutzers bündeln und es in andere Richtungen reduzieren, ergibt sich eine an- dere Verteilung der elektrischen Feldstärke im Raum als bei konventionellen An- tennen, welche zudem über die Zeit veränderlich ist. Da adaptive Antennen noch nicht lange eingesetzt werden, liegen laut den der Vollzugshilfe beigeordneten Erläuterungen erst vereinzelte Studien zur Exposition durch die neue Antennengeneration vor. Die gemittelten abgestrahlten Sendeleis- tungen von adaptiven Antennen (mit unterschiedlicher Anzahl Antennenelemen- te) liegen gemäss diesen Studien je nach Szenario in einem Bereich zwischen rund 1% (0.01 bzw. -20 dB) und 50% (0.5 bzw. -3 dB) der theoretischen Maximalleis- tung. Ob daraus jedoch auf eine geringere künftige Gesamtbelastung geschlossen werden kann, kann aktuell nicht abgeschätzt werden, hierzu gilt es die weiteren Entwicklungen und Ergebnisse abzuwarten. Bezüglich der bestehenden allgemeinen Gesamtbelastung von Mobilfunkstrah- lung kann auf die Interpellationsbeantwortung sowie den darin zitierten UVEK- Bericht verwiesen werden. Die Regierung verweist zudem auf das bereits lancier-
10 te NIS-Monitoring des BAFU. Das NIS-Monitoring soll Auskunft über die Belastung der Bevölkerung in der ganzen Schweiz mit Mobilfunkstrahlung geben. Liechten- stein beabsichtigt, sich an diesem Monitoring zu beteiligen und ist diesbezüglich mit dem BAFU im Gespräch. 2.6 Konsequenzen bei Beibehaltung der heutigen Bestimmungen Ein Landtagsabgeordneter erkundigte sich danach, was es für den 5G- Mobilfunkausbau in Liechtenstein bedeuten würde, wenn Abs. 3 von Art. 34 in seiner heutigen Form belassen würde, sprich die Messung der nichtionisierten Strahlung weiterhin nach den heutigen Standards erfolgen würde, die Anbieter aber den Wechsel auf 5G dennoch vollziehen würden. Des Weiteren wurde ge- fragt, welche Mehrkosten hier anfallen würden. Hierzu kann grundsätzlich auf die Ausführungen im BuA zur ersten Lesung ver- wiesen werden. Die Beurteilung von adaptiven Antennen erfolgt dann so, als würden sie gleichzeitig und in alle Richtungen mit der maximal bewilligten Leis- tung senden. In der Realität kann die maximale Sendeleistung nur in eine Rich- tung abgestrahlt werden. Die Beurteilung kann deshalb als eine Überschätzung der tatsächlich möglichen Strahlung angesehen werden und führt dazu, dass adaptive Antennen ihr Potential, wie z.B. eine effizientere Datenübertragung, nicht ausschöpfen können. Aussagen zu den Auswirkungen auf den 5G- Mobilfunkausbau sowie zu den Mehrkosten in diesem hypothetischen Fall sind abhängig von der Netzplanung und können nur durch die Mobilfunkbetreiber getroffen werden. 2.7 Grenzwerte auf Verordnungsebene und weitere Regelungsunterschiede zwischen Liechtenstein und der Schweiz Im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Weg mit der Schweiz bezüglich der Grenzwerte hat ein Abgeordneter festgehalten, dass die Grenzwerte in Liechten-
11 stein analog der Schweiz auf Verordnungsebene und nicht auf Gesetzesebene geregelt werden sollten. Konkret wurde gefragt, ob zum jetzigen Zeitpunkt wei- tere Unterschiede zur Schweiz bekannt seien oder dies der einzige, kleine Unter- schied im Bereich der Verordnung sei. Zur Gewährleistung eines vollumfängli- chen Schutzes auf Gesetzesebene wurde vom Abgeordneten zudem empfohlen, die EU-Grenzwerte in Liechtenstein im Umweltschutzgesetz festzulegen. Hinsichtlich der Regelung von Mobilfunksendeanlagen gibt es zwischen der Schweiz und Liechtenstein nur wenige Unterschiede. Wie vom Abgeordneten festgehalten, sind die Grenzwerte, welche den Mobilfunk betreffen, in der Schweiz auf Verordnungsebene in der NISV festgehalten, in Liechtenstein jedoch auf Gesetzesebene im USG. Dies wurde vom Landtag bei der Schaffung des USG im Jahre 2008 so beschlossen. Ein weiterer Unterschied betrifft die unter 2.2 er- läuterte Standortkoordination in Art. 12 NISV sowie das Informationsrecht in Art. 36 USG. Weitere kleine Unterschiede sind redaktioneller Natur. Zur Anregung, die von der EU empfohlenen Grenzwerte in Liechtenstein auf Ge- setzesebene einzuführen, sei erwähnt, dass die in vielen Staaten der EU verbreite- ten Grenzwerte von den Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzkom- mission (ICNIRP) abgeleitet sind. Die Immissionsgrenzwerte (IGW) in der Schweiz und in Liechtenstein stützen sich ebenfalls auf die Empfehlungen der ICNIRP und sind im USG unter Art. 35 festgehalten. Neben dem Schutz der Menschen vor wis- senschaftlich nachgewiesenen Gesundheitsauswirkungen (thermische Effekte), welcher durch die IGW gewährleistet wird, fordert das USG zusätzlich die Umset- zung des in der Umweltschutzgesetzgebung zentralen Elements des Vorsorge- prinzips, welches im Mobilfunkbereich durch die Anlagegrenzwerte konkretisiert wird.
12 2.8 Zentrales Mobilfunknetz Ein Abgeordneter würde es begrüssen, wenn analog zum Bericht und Antrag Nr. 80/2009 erneut die Bereitstellung eines zentralen Mobilfunknetzes für den Netz- betreiber geprüft würde. Die konkrete Frage lautet, wie die technischen, die un- ternehmerischen oder auch die umwelttechnischen Auswirkungen eines solch betriebenen Netzes wären. Der damalige Auftrag des Landtages vom Mai 2009 betraf im Wesentlichen die Frage, ob ein zentrales Mobilfunknetz betrieben und den Betreibern diskriminie- rungsfrei zur Verfügung gestellt werden könnte, und ob Anordnungen für ent- sprechende Tests möglich wären. Der Betrieb dieses Netzes sollte unter der Vor- gabe der Einhaltung eines aus gesundheitlichen Überlegungen festgelegten Anla- gegrenzwertes von 0.6 V/m erfolgen (Anmerkung: um den Faktor 10 tiefer als der heutige Anlagegrenzwert). Dem BuA Nr. 80/2009 waren die erstellten Studien und Stellungnahmen der Betreiber beigelegt. Diese mit grossem Aufwand ver- bundene und umfassende Abklärung lief unter dem Titel «Kleinzellen Mobilfunk Konzept 2013 für Liechtenstein» und sah neben der Grenzwertabsenkung auf 0.6 V/m auch die Neuerrichtung von rund 140 zusätzlichen Funkzellen mit Frequen- zen aus dem Bereich 900 MHz und 1800 MHz vor. Es kann festgehalten werden, dass es im Nachgang weder zu einer Testanordnung noch zu einer Grenzwertab- senkung gekommen ist oder die Idee eines zentralen Kleinzellennetzes weiterver- folgt wurde. Nach Kenntnisstand der Regierung haben sich flächendeckende Kleinzellenkon- zepte in Form eines „stand alone“ Netzes in den letzten Jahren international nicht durchgesetzt. Kleinzellen kommen typischerweise an Orten mit einem sehr hohen Datenverkehr, z.B. in Einkaufsstrassen oder Stadien ergänzend und punktuell zum Einsatz. Die kombinierte Netzstruktur bestehend aus Makrozellen (freistehende Masten oder Dachantennen) und kleineren Zellen (Micro, Pico, Femto) hat sich
13 international als Standard durchgesetzt, so auch in Liechtenstein. Die Regierung ist daher der Ansicht, dass die Bereitstellung eines zentralen Mobilfunknetzes nicht zielführend ist und eine Prüfung dementsprechend keinen Sinn machen würde. 2.9 Grenzwerte und betriebswirtschaftliche Führung eines 5G-Netzes Ein Abgeordneter stellte die Frage, ob die Grenzwerte überhaupt ausreichend seien, um ein 5G-Netz betriebswirtschaftlich führen zu können. Die Regierung ist der Ansicht, dass insbesondere mit der gegenständlichen Geset- zesänderung der Ausbau des 5G-Netzes mit adaptiven Antennen unter Einhaltung der heutigen Grenzwerte technisch möglich ist. Betriebswirtschaftliche Fragen können nur die Netzbetreiber beantworten. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die zusätzlichen Netzkosten für die jeweiligen Senderstandorte sowie die Frage, ob und in welchem Umfang zusätzliche Einnahmen generiert werden könnten. Darüber hinaus spielen Fragen der generellen Netzstrategie und die Positionierung der Netzbetreiber am Marktplatz eine Rolle. Weitere Einflussfakto- ren sind der Aufwand für die Realisierung neuer Standorte und damit zusammen- hängend die Zeitdauer für einen landesweiten Ausbau des 5G-Netzes. Wie oben ausgeführt, ist im Falle der Beibehaltung der heutigen Grenzwerte mit neuen zusätzlichen Standorten zu rechnen. Dieses Szenario setzt auch die An- nahme voraus, dass die Mobilfunkbetreiber das volle Potential von 5G aus- schöpfen möchten und es daher eine Verdichtung des Sendernetzes benötigt. 2.10 Vollzugshilfe In Bezug auf die im Bericht und Antrag erwähnte Vollzugshilfe des BAFU wurden von einem Abgeordneten genauere Ausführungen gewünscht. Des Weiteren wurde nach der rechtlichen Einordnung der Vollzugshilfe gefragt.
14 Die Vollzugshilfe des schweizerischen Bundesamts für Umwelt (BAFU) vom 23. Februar 2021 beschreibt, wie adaptive Antennen zu beurteilen sind, so dass die Berücksichtigung der Variabilität von adaptiven Antennen den rechtlichen Vorgaben entspricht. Konkret kann bei adaptiven Antennen ein Korrekturfaktor angewendet werden, der abhängig von der Anzahl in der Antenne verbauten Sub- Arrays (Teilantennen) ist. Der Korrekturfaktor beträgt bei mehr als 64 Sub-Arrays minimal 0.1. Dies entspricht einem Faktor 3.2 in der elektrischen Feldstärke. Wenn ein Korrekturfaktor angewendet wird, muss die Antenne mit einer automa- tischen, softwarebasierten Leistungsbegrenzung ausgestattet sein, welche die Sendeleistung so beschränkt, dass im Mittel über 6 Minuten die massgebende Sendeleistung eingehalten wird. Das bedeutet, dass punktuell beim Nutzer kurz- zeitige Feldspitzen auftreten können. Die Leistung muss nach einer Leistungsspit- ze jedoch soweit gedrosselt werden, dass die über 6 Minuten gemittelte Sende- leistung die massgebende Sendeleistung nicht überschreitet. Somit wird gewähr- leistet, dass der Anlagegrenzwert, welcher sich auf den massgebenden Betriebs- zustand adaptiver Antennen bezieht, jederzeit eingehalten wird. Die Frage zur rechtlichen Einordnung der Vollzugshilfe wurde bereits während der ersten Lesung beantwortet. Verwiesen werden kann auch auf die Ausführungen unter Punkt 2.3. 3. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN Zu Art. 35 Die Regierung wurde gebeten zu prüfen, ob Art. 35 mit einem Abs. 3 in der Wei- se ergänzt werden müsste, dass die Regierung das Nähere mit Verordnung re- gelt, analog Art. 34 Abs. 5. Es scheine unklar zu sein, wie die Immissionsgrenz- werte bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Frequenzen festgelegt seien.
15 Die Regierung erachtet diesen Vorschlag als sinnvoll. Aufgrund von Art. 94 USG besteht zwar eine umfassende Verordnungskompetenz der Regierung. Diese ist jedoch im Sinne des Legalitätsprinzip, analog Art. 34 Abs. 5 und den weiteren Bestimmungen im Kapitel „Besondere Vorschriften für den Schutz vor nichtioni- sierender Strahlung“ sowie um den Anforderungen an die genügende Bestimmt- heit einer Delegationsnorm zu entsprechen, durch einen Absatz 3 zu Art. 35 zu ergänzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass in der NISV neue Bestimmungen für Grenzwerte für mehrere Frequenzen erlassen werden. Die NISV enthält diesbe- züglich seit deren Erlass im Jahre 2008 Regelungen, welche so bestehen bleiben sollen. Im Zusammenhang mit der Prüfung dieses Vorschlages fiel zudem auf, dass die Regelung der Immissionsgrenzwerte in Absatz 2 sachgerechter erscheint als in einer Tabelle im Anhang. Dies entspräche sodann der Regelung der Anlagegrenz- werte in Art. 34. Anhang Die oben angeführte Anpassung von Art. 35 Abs. 2 erlaubt, die im Rahmen der 1. Lesung vorgesehene IGW-Regelung im Anhang wieder zu entfernen. Der Anhang des bestehenden USG ist aufzuheben, da gemäss den aktuellen legistischen Vor- schriften die EWR-Rechtsakte im Zweckartikel (Art. 1) anzuführen sind.
16 II. ANTRAG DER REGIERUNG Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land- tag den Antrag, der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die bei- liegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN gez. Dr. Daniel Risch
17 III. REGIERUNGSVORLAGE Gesetz vom … über die Abänderung des Umweltschutzgesetzes Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung: I. Abänderung bisherigen Rechts Das Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, LGBl. 2008 Nr. 199, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: Art. 1 Abs. 3 3) Dieses Gesetz dient zudem der Umsetzung folgender EWR- Rechtsvorschriften: a) Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 1; b) Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien 2; 1 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpa- ckungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10)
18 c) Richtlinie 1999/94/EG über die Bereitstellung von Verbraucherinformatio- nen über den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue Personenkraftwagen 3; d) Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen für be- stimmte Luftschadstoffe 4; e) Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umge- bungslärm 5; f) Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 6; g) Richtlinie 2004/107/EG über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und po- lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft 7; h) Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa 8; i) Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 9; k) Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendi- oxid 10; 2 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1) 3 Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16) 4 Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22) 5 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12) 6 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaf- tung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56) 7 Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft (ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3) 8 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1) 9 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3)
19 l) Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 11; m) Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen 12; n) Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 13. Art. 1a Verweis auf EWR-Rechtsvorschriften 1) Wird in diesem Gesetz auf EWR-Rechtsvorschriften verwiesen, auf die im EWR-Abkommen Bezug genommen wird, so beziehen sich diese Verweise auf deren jeweils gültige Fassung, einschliesslich deren Abänderungen und Ergän- zungen durch das EWR-Abkommen, sowie auf die damit zusammenhängenden Durchführungsrechtsakte. 2) Die Bestimmungen der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Ge- setz verwiesen wird, sind unmittelbar anwendbar und allgemein verbindlich. 3) Die gültige Fassung der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 10 Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologi- sche Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parla- ments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114) 11Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Indust- rieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) 12 Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschliessenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) 13Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38)
20 im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 Bst. k des Kundmachungs- gesetzes. Art. 6 Abs. 2 2) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der in Art. 1 Abs. 3 aufge- führten EWR-Rechtsvorschriften ergänzend Anwendung. Art. 13a Abs. 1 1) Anlagen und Tätigkeiten nach Anhang 1 Spalte 1 Ziff. 1.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.14, 4.2 bis 4.7, 4.12, 5.1 bis 5.6, 6.1, 7.3, 7.6, 7.8, 8.1 bis 8.3, 11.2 bis 11.4, 11.7 bis 11.9, 11.15 bis 11.17 und 11.19 des Gesetzes über die Umweltverträglich- keitsprüfung (UVPG) bedürfen einer Betriebsbewilligung des Amtes für Umwelt. Davon ausgenommen sind Forschungstätigkeiten, Entwicklungsmassnahmen oder die Erprobung von neuen Produkten und Verfahren. Art. 34 Abs. 2 Bst. c sowie Abs. 3 und 4 2) Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt: c) für alle anderen Anlagen: 5,0 V/m. 3) Als massgebender Betriebszustand gilt der maximale Gesprächs- und Da- tenverkehr bei maximaler Sendeleistung; bei adaptiven Antennen wird die Varia- bilität der Senderichtungen und der Antennendiagramme berücksichtigt. 4) Sendeantennen gelten als adaptiv, wenn ihre Senderichtung oder ihr An- tennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abständen angepasst wird.
21 Art. 35 Abs. 2 und 3 2) Der Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstär- ke beträgt: a) für Anlagen, die im Frequenzbereich 10 bis 400 MHz senden: 28 V/m; b) für Anlagen, die im Frequenzbereich 400 bis 2000 MHz senden: 1,375 · √ V/m, wobei f die Frequenz in MHz bezeichnet; c) für Anlagen, die im Frequenzbereich 2 bis 300 GHz senden: 61 V/m. 3) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere den Immissionsgrenz- wert für mehrere Frequenzen, mit Verordnung. Art. 37 Abs. 1 Bst. d 1) Die Massnahmen der Abfallbewirtschaftung sind nach Massgabe der fol- genden Prioritätenfolge festzusetzen: d) sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung; Anhang Aufgehoben II. Inkrafttreten Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen- dumsfrist am 1. Februar 2022 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma- chung.
Sie können auch lesen