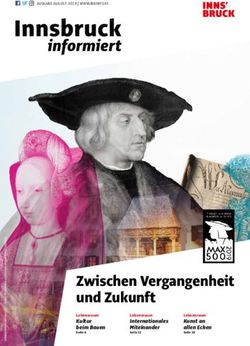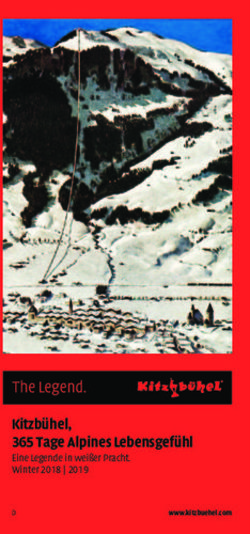Tag der mechatronik. Tagungsband 2013 - Mo, 23.09.2013 | MCI Management Center Innsbruck
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum Veranstaltung: Tag der Mechatronik 2013 23. September 2013 Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Mechatronik Plattform MCI Studiengang Mechatronik Veranstaltungsort: MCI – Management Center Innsbruck Maximilianstraße 2, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0)512/2070-3900 E-Mail: info@mci.edu Internet: www.mci.edu Organisationskomitee: Wolfgang Haindl Günther Hendorfer Viktorio Malisa Andreas Mehrle Udo Traussnigg Johannes Steinschaden Herausgeber: DI Dr. Andreas Mehrle Studiengangsleiter Bachelor Mechatronik und Master Mechatronik – Maschinenbau Umschlaggestaltung: Pia Daum, Management Center Innsbruck, 6020 Innsbruck Bildnachweis: © MCI; © MCI-Spiluttini Verlag: STUDIA Universitätsverlag, Herzog Sigmund Ufer 15, 6020 Innsbruck 1. Auflage – Deutsche Erstveröffentlichung September 2013 Copyright: MCI – Management Center Innsbruck, Internationale Hochschule GmbH, 2013 Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, der Verbreitung, der Bearbeitung und Übersetzung, sowie jeder Form von gewerblicher Nutzung, vorbehalten. Alle in diesem Tagungsband enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt kontrolliert. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Tagungsband enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Herausgeber und Department übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entstehen, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten, die daraus resultieren können. ISBN 978-3-902652-86-7
inhaltsverzeichnis. Vorwort 5 Mechatronik Plattform Österreich 7 Programm Tag der Mechatronik 2013 23 Vorträge Themenschwerpunkt Automatisieren und Regeln 25 Nominierungen Bachelorarbeiten 37 Nominierungen Diplom-/ Masterarbeiten 53 Sponsoren 77
wort Vorw Liebe Ko olleginnen und u Kollegen, liebe Stu dierende, lie ebe Teilnehmerinnen u und Teilnehm mer! Der Heerbst überrflutet uns mit Vera anstaltungen aller Art.A Konfereenzen, Kolloquien, Podiumsdiskussion nen und Foren F erlau uben uns kaum me ehr unsererr täglichen n Arbeit gehen. Und genau we nachzug enn der Bettrieb nach der Urlaubs ssaison lan ngsam wiedder Fahrt aufnimm mt, ist da no och der Tag der Mechattronik – wofü ür eigentlich h? Zum 8. MMal treffen sich die österreichische en Mechatroonik Studien ngänge um ssich auszuta auschen. Ein ganzzes Jahr lan ng unterrichten, studierren und fors schen wir in der festen Überzeugun ng unser Bestes zzu geben. Einmal im Ja ahr nehmen n wir uns da ann Zeit um zu sehen w wie wir im Vergleich V zu den aanderen Bundesländern n stehen, w wohin sich die Zukunft der d Mechatrronik entwic ckelt und wer dabbei die Nasee vorn hat. Aber A kann d dies der Sinn sein? Gib bt es hierfür nicht Publikationen und Rannkings? Der eiggentliche Sinn des Trreffens ist das Treffe en selbst. Eine E der LLehren im tertiären Ausbildungssektor der letzten Jahrzehnte war, das wirw nur gemeinsam starrk sind. In einer e Zeit wo man n per Interneet aus den entlegenste e n Winkeln der d Erde an einer Eliteuuniversität studieren s kann, trrifft dies me ehr denn je e zu. Aber g gleich wie das Studierren geht au uch das Tre effen am besten vvor Ort. Aus die esem Grun nd ist der Tag der Mechatron nik nicht nur n eine LLeistungssch hau der teilnehm menden Studiengänge, sondern D IE Möglichk keit mit den einschlägig gen Hochsc chulen in Kontakt zu treten. Die Mechatronik Plattfo orm koordin niert seit einem knapppen Jahrzehnt deren Aktivitätten und biietet die einmalige MMöglichkeit sich mit Lehrenden, L den und Studierend Experten gleichzeitiig auszutaus schen. Schon d das Vortragssprogramm wird von d diesen drei Gruppen G zu selben Teileen bestritten, wobei die Pro ojekte selbst auch meistm in mmehrere Ka ategorien fallen: f Forsschungsprojjekt mit Studiereendenbeteiligung, Abs schlussarbeeit in Koop peration mit m einem Unternehm men und Produktentwicklung g gemeinsam m mit der HHochschule. Da dies nur mit verein ten Kräften möglich ist, möcchte ich mich h für die zah hlreichen Ei nreichungen zu den Pre eisen, der B Bereitschaft Vorträge V zu halteen aber vorr allem bei unseren Pa artnern aus der Wirtschaft, welchee die Veran nstaltung auch fin nanziell unte erstützen, beedanken. Ich wün nsche ihnen n einen spannenden T ag der Mec chatronik un nd da es n ach den Wünschen W Brüsselss auch gleichzeitig der autofreie a Ta ag ist, eine entspannte e Anreise A mit der Bahn. DI Dr. Andreas A Mehrrle Studienngangsleiter M Mechatronik MCI Ma anagement C enter Innsbru uck – Internattionale Hochsschule GmbH H
Mechatronik Plattform P m Österre eich www.mechatronik-plattform.att Die Arrbeitsgemeinschaft „M Mechatronikk Plattformm“ wurde am 1.122.2005 durch die Studiengangsleiter von Mechatronik Studiiengängen einzelner e Fachhochschu ulen gegrün ndet. Sie sieht sich als strategische Verbindung V und jederze eit offene Plattform für eine Koope eration in den Bereichen Ausb bildung sow wie Forschun ng und Entwwicklung, au uf dem Gebi et der Mech hatronik. e der Mecha Die Ziele atronik Platttform sind d die Sicherung des Produktionssta andortes Ös sterreich durch innovattive mechatronische Produkte Erhöhung des d Frauenanteils in den n mechatron nischen Beruufen Förderung der Kooperation und Austausch von Studiierenden, A AbsolventInnnen und Lehrenden kontinuierlicche Verbess serung der Q Qualität in der d Ausbildu ung Förderung der d wissenschaftlichen Zusammenarbeit Die Mecchatronik Pla attform Öste erreich wird d unterstütztt von Der Arbeitsgemeinsschaft „Mec chatronik Pla attform“ gehören derze eit folgende Studiengän nge an: FH CAMP PUS 02, Grazz Automattisierungstechhnik FH-Prof. DI Dr. Udo Traussnigg www.cam mpus02.at FH Kärntten System EEngineering/S Systems Design DI Dr. Wo olfgang Wertth http://ww ww.fh-kaernte en.at/ MCI Man nagement Center Innsbruc ck Mechatroonik DI Dr. An ndreas Mehrle e www.mcci.edu FH Oberö österreich Automattisierungstech hnik Prof. (FH) Univ. Doz. Mag. M Dr. Gün nther Hendorffer www.fh-ooe.at FH Vorarrlberg Mechatro onik DI Dr. Johannes Stein nschaden www.fhv v.at FH Wiene er Neustadt Mechatro onik/Mikrosysstemtechnik Prof. (FH) DI Wolfgang Haindl www.fhw wn.ac.at
Verrein zur z Förrderung deer Auttomattion & Rob botik k – Öffe entlichkeits tsarbeit zu ur Förderun ng und Verrbreitung des d mechattronischen n Denkannsatzes in den Ingennieurwissen nschaften – Förd derung derr interdiszip plinären Fo ng und akaademische orschung, Entwicklun en Bildun ng – Förd derung dess Wissens stransfers zwischen Hochschulen und Inddustrie im Bereich h der Mech hatronik, Automation A und Robootik anisation von – Orga staltungen , wie den Ball v Verans B der Mechatroni M ik Förderung der Automation A und Robootik „F-AR“, Schweizeertalstr. 5/11/1, A-1130 0 Wien I: ww ww.f-ar.at,, Email: vorstand@f-a ar.at
karriere? Vollautomatisch! Bachelorstudiengang automatisierungstechnik masterstudiengang automatisierungstechnik-Wirtschaft Die Arbeit An Der SchnittStelle Die Automatisierungstechnik verbindet Elektronik, Informa- Organisationsform: Berufsbegleitend tik, Maschinenbau und Wirtschaft. Die Herausforderung bei Studienbetrieb: Freitag Nachmittag und Samstag der Automa- tion technischer Prozesse liegt Zwei in einem: darin, zwischen Studienort: Graz den meist ge- studium und Beruf genläufigen As- Kosten: Studienbeitrag pro Semester pekten von Zeit, Kosten, Qualität, Ressourcen und Umwelt ein € 363,36 Optimum herzustellen. zuzüglich ÖH-Beitrag (dzt: € 16,50) Das Bachelorstudium ist stark interdisziplinär auf technisch Zahl der Studienplätze Bachelorstudiengang: 38 pro Jahrgang operative Tätigkeiten ausgerichtet. Zusätzlich eröffnet der pro Studienjahr: Masterstudiengang: 33 pro Jahrgang hohe Anteil an Wahlfächern im Studium Möglichkeiten in Studiendauer: Bachelorstudiengang: 6 Semester hoch spezialisierten Berufsfeldern. Masterstudiengang: 3 Semester Das Masterstudium bildet Führungskräfte für die Wirtschaft (17 Wochen/Semester, Semesterstart aus. Ziel ist es, Management- und/oder Entwicklungstätigkei- ten in bzw. für Unternehmen im In- und Ausland in hohem Mitte September bzw. Ende Februar) Maße eigenverantwortlich auszuführen. Abschluss: Bachelorstudiengang: Die AbsolventInnen sind sowohl für große Industrieunter- Bachelor of Science in Engineering, BSc nehmen, als auch für die vielen Mittelbetriebe mit spezialisier- Masterstudiengang: ten Produkten hoher technologischer Reife interessant. DiplomingenieurIn, Dipl.-Ing., DI Den Studierenden wird ermöglicht, das Studium parallel zur ECTS: Bachelorstudiengang: 180 Credits beruflichen Tätigkeit zu absolvieren. Berufserfahrung und be- Masterstudiengang: 90 Credits rufliche Tätigkeit ist aber nicht zwingend erforderlich. ForSchung & entwicklung Studierende bearbeiten Aufgabenstellungen im Rahmen von Projekt-, Bachelor- und Diplomarbeiten. Darüber hinaus wer- den für Unternehmen einerseits die klassische Auftragsfor- Alle Termine und schung und -entwicklung, andererseits Projekte im Rahmen von Förderungen, maßgeblich von LektorInnen, abgewickelt. deTAilinformATionen finden sie Auf: Forschungsschwerpunkte: • Industrielle Messtechnik und Messplatzautomatisierung • Virtuelle Methoden und Simulation in der Entwicklung • RFID (Radio Frequency Identification) • Energietechnische Optimierung • Entwicklung von Prototypen und Demonstratoren fh camPus 02: Körblergasse 126, 8021 Graz, Tel. (0316) 6002-726, Fax (0316) 6002-1258, at@campus02.at www.campus02.at/at
SYSTEMS ENGINEERING BACHELOR STUDIENGANG SYSTEMS DESIGN MASTER DEGREE PROGRAM Sie wollten schon immer wissen, wie ein Roboter funktioniert, an der SySTEMS ENGINEERING IM ÜBERBLICK Entwicklung der neuesten Flugzeugsysteme mitwirken oder ein voll- LEHRVERANSTALTUNGSSPRACHE: Deutsch automatisch gesteuertes Automobil konzipieren? Smartphones und Tablets sind Geräte, die Sie neugierig machen? Die Fähigkeit, DAUER: 6 Semester (180 ECTS) komplexe Systeme zu verstehen, zu entwickeln und zu fertigen setzt AKADEMISCHER ABSCHLUSS: eine neue Generation von TechnikerInnen voraus. Die Studiengänge Bachelor of Science in Engineering (BSc) Systems Engineering und Systems Design bieten das ideale Studium STUDIENPLÄTZE: 50 dazu an. ORGANISATIONSFORM: Vollzeit und Berufsbegleitend STUDIENINHALTE Systems Engineering kombiniert die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informationsverarbeitung. Der Fokus liegt sowohl in der Behandlung der Einzelkomponenten integrierter mechanisch-elektronischer Systeme als SySTEMS DESIGN KEy FACTS auch in der Analyse des Gesamtsystems. Daher bietet das Studium zunächst eine umfassende technische Grundausbildung mit an- LANGUAGE OF INSTRUCTION: English schließender Spezialisierung in einer der drei Studienzweige Mecha- tronik/Robotik, Prozess- und Automatisierungstechnik und Elektronik. DURATION: 4 semesters (120 ECTS) DEGREE : Master of Science in Neben der technischen Ausbildung fördern Lehrveranstaltungen aus Engineering (MSc) den Bereichen Wirtschaft, Management und Sprachen die Persönli- STUDY PLACES: 25 chkeitsbildung. Der ständige Bezug zur Praxis ist ein wesentlicher Be- standteil des Studiums und wird konsequent in den Lehrveranstaltungen, STUDY MODE: full-time Laborübungen, besonders aber im sogenannten „Projektjahr“ herges- tellt. Dieses „project based learning“ stellt einen zentralen Teil Ihres Studiums dar. Erworbene praktische Fähigkeiten und theoretische Kenntnisse werden in Form eines eigenständigen Projektes vertieft. Im abschließenden Berufspraktikum wird das bisher Erlernte in einem betrieblichen Umfeld angewendet. BERUF & KARRIERE Als AbsolventInnen des Studiengangs Systems Engineering sind Sie durch die angebotenen Studienzweige SpezialistInnen in Ihrem Auf- gabenbereich. Andererseits verfügen Sie auf- grund Ihrer Ausbildung über die Fähigkeit, in- terdisziplinäre Problemstellungen zu lösen und Projekte fachübergreifend zu koordinieren. Damit eröffnet sich Ihnen ein weites Berufsfeld, das sich von der Automatisierungstechnik über die Halbleiter-, Medizin- und Umwelttechnik bis hin zur Automobil- sowie Unterhaltungselek- tronik erstreckt. WEITERE INFORMATIONEN E-Mail: se@fh-kaernten.at h-kaern t e n . at / S e www.fh-kaernten.at/se w w w. f
Mechatronik Mit der Einrichtung des Studiengangs Mechatronik ist es dem MCI gelungen, ein Vakuum im Westen Österreichs zu füllen. Ziel ist es gerade in der Ausbildung einen mechatronischen Mehrwert über die Summe der Komponenten Maschinenbau, Elektronik und Informatik hinaus zu generieren. Die Integration dieser drei Grundpfeiler führt zu Technologien wie elektronische Bildverarbeitung, Smart Robotics, elektromechanische Simulation und Rapid Manufacturing. Mit ergänzenden Lehrveranstaltungen zu Themen wie Leadership, strategisches Management, Marketing und Unternehmensführung eröffnet dieses Studium die Möglichkeit zu wissens- basierten Karrieren in Industrie und Dienstleistungswirtschaft in aller Welt. Dauer 6 bzw. 4 Semester inklusive Abschlussarbeit und Abschlussprüfung Positionierung Hoher Praxisbezug, internationale Ausrichtung, enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft Studienzweig Maschinenbau Studienzweig Elektrotechnik schwerP unkte Industrielle Steuer- & Regelungstechnik Optische Messtechnik & elektronische Bildverarbeitung Handhabungstechnik & Robotik Fertigungstechnik & Materialwissenschaften Elektromechanische Modellierung & Simulation semesterzeiten Vollzeitstudium: Berufsbegleitendes Studium: Wintersemester: Oktober bis Ende Jänner Wintersemester: September bis Ende Jänner Sommersemester: März bis Ende Juni Sommersemester: Mitte Februar bis Mitte Juli organisationsform Vollzeitstudium: Berufsbegleitendes Studium: Präsenzzeiten: Montag–Freitag, tagsüber Präsenzzeiten: Freitag 13:30–22:00 Uhr Samstag 08:30–17:00 Uhr; Präsenzwoche mögl. Bilder: © Stubaier Gletscher, © Kai Dieterich, © MCI-Spiluttini, © Getty Images sPrache Deutsch, Englisch (darüber hinaus umfassendes Fremdsprachenangebot) akaDemischer graD Bachelor bzw. Master of Science in Engineering B ewerB ung Online unter www.mci.edu/bewerbung. Bitte angegebenen Fristen der auf der Website beachten kontakt DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE ® MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK 6020 Innsbruck / Austria, Universitätsstraße 15 +43 512 2070-3900, office-mech@mci.edu www.mci.edu/master-studium-mechatronik-maschinenbau
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Mechatronik an der FH Vorarlberg studieren Täglich nutzen wir Produkte, die neben mechanischen Teilen auch Elektronik beinhalten und von Software gesteuert werden (z. B. Digitalkamera, DVD-Player, Kaffeemaschine). Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie diese Produkte entstehen, wer sie entwickelt und konstruiert? Im globalen Wettbewerb ist es enorm wichtig, laufend innovative Produkte zu entwickeln und hoch flexibel zu produzieren. Hier setzt das interdisziplinäre Studium Mechatronik der FH Vorarlberg an. Wenn Sie den Dingen gerne auf den Grund gehen und technisches Interesse haben, dann ist Mechatronik ein interessantes Gebiet für Sie. Es umfasst die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik und verknüpft diese Disziplinen mit dem Ziel, technische Produkte zu optimieren. Berufliche Tätigkeitsfelder bacHelor- und Master- Als Mechatronik-AbsolventIn der FHV sind Sie gefragt am Arbeitsmarkt. Denn Sie setzen in Ihrer Arbeit wissen- studiuM an der FHV schaftliche und mathematische Prinzipien, Erfahrungen, Augenmaß und Hausverstand gut ein, um Dinge für Akademischer Grad Menschen besser zu machen. In der Produktentstehung Bachelor of Science in Engineering (BSc) bzw. bieten sich interessante Berufsfelder, etwa: Master of Science in Engineering (MSc) Mechatronik u◆ Organisationsform Maschinenbau u◆ Vollzeit für Bachelor und Master Robotik u◆ Elektronik u◆ Studiendauer Automatisierungstechnik u◆ 6 Semester im Bachelorstudium, Mikrotechnik u◆ 4 Semester im Masterstudium Fahrzeugtechnik u◆ Vorlesungssprache Medizintechnik u◆ Deutsch, 5. Semester in Englisch im Bachelor- studium; Englisch im Masterstudium Bewerbung Schriftlich mit Anmeldeformular, Motivationsschreiben, Berufspraktikum Lebenslauf, Zeugnis- und Passkopie sowie einem Pass- 4 Monate im 3. Studienjahr des Bachelorstudiums foto bis 15. Mai. Mehr zur Bewerbung und den Zugangs- Auslandssemester voraussetzungen unter http://www.fhv.at/studium/technik 5. Semester (optional) im Bachelorstudium Kontakt für weitere Informationen Abschlussprüfung FH Vorarlberg 2 Bachelor-Arbeiten, mündliche Bachelor- Hochschulstraße 1 Prüfung bzw. Master Thesis und mündliche 6850 Dornbirn, Vorarlberg Master-Prüfung Kosten Jeannette Bohnes keine Studiengebühren mechatronik@bachelorstudium.at bzw. ÖH-Beitrag € 18,00/Semester mechatronics@masterstudium.at T +43 (0) 5572 792 5000 Studiengangsleitung Johannes Steinschaden www.fhv.at
Fachhochschule Technikum Wien Mit bisher rund 6.800 AbsolventInnen und etwa 3.300 Studierenden ist die Fachhochschule Technikum Wien Österreichs größte rein technische FH. Das Studienangebot umfasst aktuell 12 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, die in Vollzeit, berufsbegleitend und/oder als Fernstudium angeboten werden. Acht Studiengänge werden in englischer Sprache abgehalten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird an der FH Technikum Wien auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen Studierenden und AbsolventInnen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle. Der Bereich Forschung & Entwicklung an der FH Technikum Wien ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich aktuell auf vier Schwerpunkte: eHealth, Embedded Systems, Erneuerbare Energie und Tissue Engineering. Die FH Technikum Wien wurde 1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 aller erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Seit 2012 ist sie Mitglied der European University Association. Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. Mechatronik/Robotik an der FH Technikum Wien studieren Die FH Technikum Wien war die erste Fachhochschule Osterreichs, die 2003/04 ihr Studienangebot zur Gänze auf die europaweit einheitliche Bachelor-Master-Studienarchitektur umstellte. Im selben Jahr startete auch der Studiengang Mechatronik/Robotik – zuerst als Diplom- und dann ab 2005/06 als Bachelor-Studiengang (Vollzeit). Seit 2007/08 gibt es ein Master-Studium Mechatronik/Robotik, das in Vollzeit- oder berufsbegleitender Form absolviert werden kann. Der Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik integriert die klassischen Ingenieurdisziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik und Informatik und verbindet sie durch einen Systemgedanken. Schon sehr früh werden Studierende in praxisorientierte Projekte mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden. Hightech-Labore mit umfangreicher Hard- und Software bieten dabei optimale Rahmenbedingungen. Neben der technisch- fachlichen Spezialisierung wird im Rahmen des Studiums auch Wert auf übergeordnete Zusammenhänge und Kompetenzen in Wirtschaft, Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im Bachelor-Studium, das sechs Semester dauert, stehen 60 Anfängerstudienplätze zur Verfügung. Im Master-Studium können AbsolventInnen eines Mechatronik/Robotik-Studiums oder anderer technischer Studien, wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik oder Informatik, ihr bereits erworbenes Wissen vertiefen und erweitern. Know-how im Bereich Unternehmensführung und komplexe Anwendungsbeispiele stehen ebenso auf dem Studienplan wie englischsprachige Lehrveranstaltungen. AbsolventInnen werden damit u.a. bestens auf eine Führungsposition – auch international – vorbereitet. Das Master-Studium dauert vier Semester und es gibt 45 Anfängerplätze. www.technikum-wien.at
Mechatronik|Mikrosystemtechnik Technisches Management oder Forschung & Entwicklung. Das Studium für alle, die auf Innovation setzen. » Spezialisierung in innovativen, interdisziplinären Fachgebieten » Ausbildungskooperationen mit internationalen Forschungszentren und Unternehmen » Einbindung in aktuelle Industrie- & Forschungs- projekte (EU-Projekte: COTECH, Improve, SEAL) » Exzellente Infrastruktur (Hard- und Software) » Top Referenten aus Industrie & Forschung » Individuell & effizient studieren in Kleingruppen » Management- & Führungsausbildung » Exzellente Jobaussichten »Computational Engineering »Mechatronic Systems »Surface Engineering & Tribology Ziel des Studiums ist die Vermittlung einer vertieften fachlichen Ausbildung zur Entwicklung von mechatronischen Produk- ten und Systemen unter besonderer Short Facts BACHELOR Berücksichtigung von » Studiendauer: 6 Semester > funktionale Oberflächen » Organisationsform: Vollzeit > dem Einsatz computergestützter » Abschluss: Bachelor of Science in Methoden zur Produkt- und Systement- Engineering wicklung (Modellierung, Simulation, Analyse und Optimierung) sowie > ökonomischen und ökologischen Effekten in der Auslegung und Short Facts MASTER Umsetzung » Studiendauer: 4 Semester » Organisationsform: berufsermöglichend Forschungs- & Ausbildungspartner/ » Abschluss: Master of Science in zukünftige Arbeitgeber sind u.a. Engineering AIT, Attophotonics Biosciences, Audi, austriamicrosystems, CERN, Infineon, MAGNA, OMV, Oregano Systems, Otto Bock, RUAG Aerospace, Siemens, TFZ Wiener Neustadt, TU-Wien, XTribology Excellence Centre,… Durch die enge Kooperation der FH Wiener Neustadt mit den Forschungs- FH Wiener Neustadt einrichtungen des TFZ Wiener Neustadt Prof(FH) Dipl.-Ing. Wolfgang Haindl können für AbsolventInnen auch T 02622 / 89084-222 Dissertationsstellen angeboten werden. M wolfgang.haindl@fhwn.ac.at
8. ta g d e r mechatronik. Mo, 23.09.2013 | MCI Management Center Innsbruck Programm 13:00 Uhr Registrierung 13:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung Prof. Dr. Andreas Altmann, Rektor, Management Center Innsbruck DI Dr. Andreas Mehrle, Studiengangsleiter, Management Center Innsbruck 13:45 Uhr Objektorientierte Modellierung der Steuereinheit eines Hybridelektrofahrzeuges Markus Öttl, MSc, Fachhochschule Vorarlberg 14:10 Uhr Die Integration von Matlab®/Simulink® in die Automatisierungsplattform Twincat® 3 von Beckhoff Automation Clemens Maier, Beckhoff Automation GmbH 14:30 Uhr Next Generation HMI mit mobilen Devices FH-Prof. DI Dieter Lutzmayr, Fachhochschule Campus 02 Graz 14:50 Uhr Automatisierungsschritte beim Regler Design für mechatronische Systeme FH-Prof. DI Dr. Wolfgang Werth, Fachhochschule Kärnten 15:15 Uhr Kaffeepause 15:45 Uhr 3D Stereo Vision in der Automatisierungstechnik und für autonome Systeme DI Dr. Manfred Gruber, Austrian Institute of Technology 16:10 Uhr Schaltruckunterdrückung in hybriden Antriebssträngen für Funfahrzeuge Simon Mayr, BSc, MSc, Fachhochschule Oberösterreich Campus Wels 16:30 Uhr Key Note: Embracing Complexity Dr. Joachim Schlosser, MathWorks Prämierungen 17:00 Uhr Prämierung beste Bachelorarbeit 17:20 Uhr Prämierung beste Masterarbeit 17:40 Uhr Prämierung beste AbsolventInnenkarriere 18:00 Uhr Schlussworte DI Dr. Andreas Mehrle, Management Center Innsbruck Ausklang
fachvorträge automatisieren & regeln.
ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM Tag der Mechatronik MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013 FH VORARLBERG: OBJEKTORIENTIERTE MODELLIERUNG DER STEUEREINHEIT EINES HYBRIDELEKTROFAHRZEUGES Markus Öttl Kurzfassung: Modellbildung und Simulation spielen eine wich- 3. MATERIALIEN UND METHODEN tige Rolle in frühen Entwicklungsstadien einer Fahrzeugent- wicklung und sollen dabei helfen, grundlegende strategische Die in der Library enthaltenen Komponenten und Entscheidungen zu treffen. Bei Hybridfahrzeugen kommt der Betriebsstrategien orientieren sich am Stand der Technik HCU (hybrid control unit) besondere Bedeutung zu. Sie ist aktueller Hybridelektrofahrzeuge. Für ein besseres Verständnis nicht nur eine bloße Schnittstelle die Fahrer und Antrieb ver- des technischen Umfeldes sei der Leser auf (Hofmann 2010) bindet, sondern sollte auch über ein intelligentes Energiemana- und (Ehsani et al. 2005) verwiesen wo die nötigen Grundlagen gementsystem (EMS) verfügen. Nur so kann sich das volle übersichtlich zusammengefasst sind. Formeln für Fahrdynamik, Potential zur Verbrauchsreduzierung eines hybriden Antriebs- können (Jazar 2008) entnommen werden. Die Arbeits- strangs entfalten. Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung umgebung ist Dymola Version 2012 FD01 in Verbindung mit einer Programmbibliothek in der kommerziellen Simulation- der der Modelica Standard Library, der State Graph Library und sumgebung Dymola, mit der die HCU eines Hybridfahrzeuges der Design Library. modelliert und hinsichtlich des Verbrauchseinsparungs- potentials in dynamischen Fahrzyklen untersucht werden kann. 4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG Neben dem Beschreiben des Aufbaus der Library an sich wird ihr Einsatz anhand eines Beispiels erläutert. 4.1 Warum Dymola? Schlüsselwörter: Hybridfahrzeuge, Modellbildung, Simulation, Verbrauchsoptimierung Dymola basiert auf der objektorientierten Modellierungs- sprache Modelica und entfaltet seine Vorteile besonders beim 1. EINLEITUNG Abbilden komplexer Systeme. Bei der Modellierungen von Fahrzeugen, wo verschiede physikalische Domänen (Mechanik, Das EU-Emissionsgesetz schreibt vor, bis 2020 die Thermodynamik, Elektronik, …) aufeinander treffen, sind der Flottenemission für alle Automobilhersteller schrittweise auf hierarchische Modellaufbau, die Kapselung und die akausalen 95g CO2/km zu begrenzen. Da die Ziele mit konventionellen Konnektoren besonders von Vorteil. Modelle bleiben Fahrzeugen zusehends schwieriger zu erreichen sind, wird übersichtlich, gut lesbar und einfach erweiterbar bzw. Fahrzeugen mit alternativen Antriebssträngen in den nächsten veränderbar. Das Verbinden einzelner Modelle zu einer Jahren eine erhöhte Bedeutung zukommen. Eine dieser größeren Struktur (z.B. Motoren und mechanischer Elemente Alternativen stellen Hybridelektrofahrzeuge dar, welche neben zu einem Antriebsstrang) erfolgt so, wie diese auch in der verbrauchbarem Treibstoff eine wiederaufladbare Batterie als Realität verbunden sind, ohne dass sich der Benutzer Gedanken Energiequelle zum Antrieb nutzen können. Da diese Fahrzeuge über eine Signalflussrichtung oder die Definition von Ein- und in der Regel komplexer in ihrem Steuerungs- und Ausgangsgrößen machen muss. (Richert et al. 2003) Ist ein Regelungsaufwand sind, ist der Einsatz von Simulations- Gesamtmodell, wie in Abb. 1 zu sehen, fertig erstellt, programmen unerlässlich. Besonders beim Suchen nach einer übernimmt Dymola das Umformen der Modellgleichungen in bestmöglichen Energiemanagementstrategie können Zeit und eine Form, die ein numerischer Solver lösen kann. Kosten gespart werden, wenn Testfahrten zur Verbrauchs- bestimmung virtuell absolviert werden können. Die hier vorgestellte Programmbibliothek hat die Aufgabe, Ingenieure bei eben dieser Suche zu unterstützen. 2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG Die Firma Modelon (www.modelon.com), Auftraggeber dieser Arbeit, stellt ihren Kunden Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Systeme oder Prozesse in Simulationen untersucht wer- den können. Die konkrete Aufgabe hier ist die Entwicklung einer objektorientierte Library (Programmbibliothek) für die Simulationssoftware Dymola, mit der die Längsdynamik eines Hybridfahrzeuges simuliert und verschiedene Betriebsstrategien in Bezug auf ihren Kraftstoffverbrauch untersucht werden können. Der Aufbau sollte möglichst modular sein, sodass ohne Abb. 1: Fahrzeugmodell in Dymola Probleme auch neue Funktionen oder Antriebskonzepte imple- mentiert werden können, d.h. Erweiterbarkeit sollte gegeben 4.2 Modellieren des Antriebsstrangs sein. Um auch für iterative Optimierungsvorgänge brauchbar zu sein, ist der Detailgrad der Modelle so zu wählen, dass Rechen- Mathematische Modelle der Fahrzeugkomponenten wie Elekt- zeiten in einem vernünftigen Bereich bleiben. Dauert ein Fahr- romotor, Verbrennungsmotor, Hochvoltbatterie oder Reifen zyklus etwa real 20 Minuten, sollten diese in etwa 2 Minuten wurden entweder, sofern verfügbar, von Modelon übernommen simuliert werden können. Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
oder eigens für die Library erstellt. Diese Modelle dienen als brennungsmotors so geregelt, dass er sich immer auf der Linie Grundlage um beliebige Antriebsstränge aufzubauen. Abbil- des optimalen Verbrauchs durch das Motorkennfeld bewegt. dung 1 zeigt beispielsweise den Aufbau eines leistungsver- Der Batterieladezustand ist dadurch zwar größeren Schwan- zweigten Hybridfahrzeuges. Der Antriebsstrang dient in weite- kungen ausgesetzt, doch der Gesamtverbrauch kann dadurch, rer Folge als Regelstrecke in einem geschlossenen Regelkreis, wie in diesem Beispiel sichtbar, minimal reduziert werden. in dem der Regler den menschlichen Fahrer repräsentiert, der mittels Gas- und Bremssignalen einem Fahrzyklus folgt. 4.3 Modellieren der HCU Der Betrieb eines Hybridfahrzeuges kann in einzelne Fahrzu- stände mitsamt ihrer Übergangsbedingungen zerlegt werden. Ist das Fahrzeug zum Beispiel rein elektrisch unterwegs, ist ein niedriger Ladezustand der Batterie eine Übergangsbedingung für das Wechseln in einen Fahrzustand, in dem die Batterie wieder aufgeladen wird. Das gesamte übergeordnete Verhalten ist daher in Form einer Zustandsmaschine modelliert. In jedem Fahrzustand selbst arbeiten separate Regler, die die eigentlichen Aufgaben zur Kraftstoffeinsparung übernehmen. Dazu zählen unter anderem: Halten des Batterieladezustandes (state of char- ge, SOC) innerhalb eines bestimmten Bereiches, Lastpunktre- gelung des Verbrennungsmotors oder verschiedene Methoden für regeneratives Bremsen. Um dem Anspruch einer objektori- entierten Library zu genügen, besteht sie auf unterer Ebene aus möglichst wiederverwendbaren, parametrisierten Logikblöcken. Abb. 3: Simulationsergebnis für Regelung mit Lastpunkver- 5. ERGEBNISSE schiebung Die HCU Library wird hier verwendet um verschiedene 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK Betriebsstrategien miteinander zu vergleichen. Abb. 2 zeigt beispielsweise das Verhalten einer Betriebsstrategie, bei der der Die gezeigte HCU Library stellt ein Grundgerüst zum Simulie- Verbrennungsmotor (internal combustion engine, ICE) so ren von hybriden Antriebssträngen dar und erfüllt die ge- geregelt wird, dass der Ladezustand der Batterie möglichst wünschten Anforderungen. Das Testen der Erweiterbarkeit konstant bleibt, d.h. unnötiges Laden/Entladen vermieden wird. kann letztendlich nur durch den praktischen Einsatz der Library über einen längeren Zeitraum erfolgen. Ein wichtiger Punkt für zukünftige Arbeiten an der Library ist die Validierung der Modelle der Fahrzeugkomponenten durch geeignete Testauf- bauten auf einem Prüfstand. Dies ist die Grundvoraussetzung für aussagekräftige Ergebnisse zu Verbrauchsvorteilen unter- schiedlicher Betriebsstrategien. Es gibt bereits einen Industrie- partner, mit dem dies in Zusammenarbeit erfolgen wird. Um auch thermische Strategien zu simulieren, wie etwa das Vor- wärmen des Verbrennungsmotors durch die Abwärme der elektrischen Komponenten, werden einige Komponenten noch mit einem thermischen Modell erweitert. 7. LITERATURVERZEICHNIS Ehsani M.; Gao Y. & Emadi A., 2005, Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, CRC Press LLC, ISBN 978-1420053982 Hofmann P., 2010, Hybridfahrzeuge, Springer Verlag Wien, ISBN 978-3211891902 Jazar R., 2008, Vehicle Dynamics – Theory and Application, Abb. 2: Simulationsergebnisse einer SOC Regelung Springer Science + Business Media, ISBN 978-0387742434 Richert F. et al., 2003, Simulationswerkzeuge im Vergleich: Abb. 3 zeigt im Vergleich wie sich eine Strategie mit Last- Modellbildung eines Dieselmotors mit Dymola und Matlab, punktverschiebung auswirkt. Hier wird der Lastpunkt des Ver- RWTH Aachen AUTOR Markus Öttl, MSc FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1, +43/5572/7923519, markusoettl@fhv.at Markus Öttl, geboren 1986 in Innsbruck, schloss 2012 sein Studium in Mechatronik an der FH Vorarlberg ab und ist dort seit 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Mechatronik tätig. Seine Beschäftigungs- schwerpunkte sind Fahrzeugsimulation sowie Regler Design und Programmierung im Automotive Bereich. Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM Tag der Mechatronik MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013 DIE INTEGRATION VON MATLAB®/SIMULINK® IN DIE AUTOMATISIERUNGSPLATTFORM TWINCAT® 3 VON BECKHOFF AUTOMATION Maier, C. Dieser Artikel gibt einen groben Einblick in die Architektur des Nachfolgende Abb. 1 zeigt die grundlegende Architektur TwinCAT 3 Systems und dessen Integration von des TwinCAT 3 Systems mit dessen Entwicklungs- und Matlab/Simulink, mit dem Beispiel „balancierende Kugel“. Laufzeitkomponente. 1. EINLEITUNG Das Unternehmen Beckhoff Automation setzt seit dem Jahre 1986 auf PC-basierte Steuerungstechnik. Mit der Einführung der Software TwinCAT legte das Unternehmen bereits 1996 einen wichtigen Meilenstein in der Welt der Automatisierungstechnologie. Die Einführung der TwinCAT Version 3 brachte nicht nur Erneuerungen rund um Bewährtem, mit ihr wurde auch die Grundlage zur Anbindung von extern generiertem Code aus anderen Programmen und Systemen geschaffen. 2. TWINCAT Die Automatisierungsplattform „The Windows Control and Automation Technologie“ (TwinCAT) von Beckhoff verwandelt nahezu jeden kompatiblen PC in eine multitaskingfähige Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen. Dessen konsequente Weiterentwicklung führte zur richtungsweisenden Kombination folgender Eigenschaften in TwinCAT Version 3: - nur eine Software für Programmierung und Konfiguration Abb. 1: Systemarchitektur von TwinCAT 3 (Beckhoff Automation GmbH, 2012) - Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3 3. MATLAB/SIMULINK - Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Das Unternehmen The Mathworks bietet mit Echtzeitanwendungen Matlab/Simulink eine bewährte Software zur Modellierung und - Anbindung an Matlab/Simulink Simulation von komplexen mechanischen und - offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit und Anpassung regelungstechnischen Systemen. Der integrierte Code- an bestehende Tool-Landschaft Generator (früher Realtime-Workshop) ermöglicht die direkte - flexible Laufzeitumgebung Codegenerierung in der Simulationsumgebung. - aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit- Betriebssystemen 3. DIE INTEGRATION VON MATLAB/SIMULINK IN - Unterstützung aller wichtigen Feldbusse DAS TWINCAT 3 SYSTEM - Integration von Motion Control und Robotik Mit dem TwinCAT Target für Simulink, hat das - Unterstützung von Messtechnik sowie Condition Unternehmen Beckhoff eine Lösung geschaffen, in Simulink Monitoring generierten Code, dirket in dessen Entwicklungsumgebung - Noch engere Verschmelzung mit IT durch die Integration einzubinden und in seiner Echtzeitumgebung auszuführen. Diese Erweiterung des TwinCAT 3 Systems ermöglicht parallel in Microsoft Visual Studio® zu dieser Integration, weitreichende Möglichkeiten der Parametierung und Ablaufkontolle direkt in der Umgebung von Durch die Möglichkeit der Anbindung und Entwicklung von TwinCAT 3. Die vollständige Unterstüzung des External- C/C++ Code sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Modes ermöglicht daüberhinaus das Bedienen, Beobachten und Laufzeitumgebung, wurde ein wesentlicher Schritt in Richtung Parametrieren währtend der Laufzeit direkt aus Simulink Zusammenführung von IT und Automatisierungstechnologie heraus. Die unten angeführte Abb. 2 zeigt ein in Simulink unternommen. Während die Entwicklungsumgebung von entwickeltes System und dessen Implementierung in der TwinCAT 3 die Möglichkeit bietet Automatisierungscode in Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3. den Sprachen der IEC 61131-3 und C/C++ zu entwerfen, sorgt dessen Laufzeitumgebung für die Abarbeitung dieses Codes in harter Echtzeit. Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
Signalerfassung direkt, d. h. ohne Touch-Controller, über XFC- Technologie Klemmen von Beckhoff. Die XFC-Technologie ermöglicht die diskrete Abtastung von Sensoren im µs-Bereich. Darüber hinaus können mit der Kombination von XFC und TwinCAT, Reaktionszeiten von wenigen µs erreicht werden. 4.3 DIE APPLIKATION IN TWINCAT 3 Die Applikation gliedert sich in vier Module. Das messtechnische Modul steuert den Touchscreen an und bereitet dessen Signale für den Regler auf. Der eigentliche Regler wurde in Simulink entworfen und über das TwinCAT Target für Simunik in die Applikation implementiert. Die Ansteuerung der Achsen erfolgt über die in TwinCAT integrierte NC. Die Abb. 2: Ein Simulink Modell und dessen Implementierung Sollwertvorgabe erfolgt dabei über die kinematische in der TwinCAT Umgebung Transformation in der SPS. 4. BEISPIEL „BALANCIERENDE KUGEL“ 5. FAZIT UND AUSBLICK Die Kombination einer Hexapodeplattform mit einem Der Demonstrationsaufbau „balancierende Kugel“ zeigt in darauf befestigten Touchscreen bildet die Basis für ein einfacher Weise die beeindruckende Anbindung von Simulink Demonstrationsaufbau, mit dem der Funktionsumfang von an die Automatisierungsplattform TwinCAT 3. Durch die TwinCAT 3 veranschaulicht werden kann. Neben den Integration der Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3 in das bewährten SPS- und NC Funktionalitäten zeigt dieser Aubau Microsoft Visual Studio ist eine Basis geschaffen worden, die die weitreichende Integration von Simulink in das TwinCAT es erlauben würde, weitere Systeme aus der Hand von System von Beckhoff auf. Drittanbietern zu integrieren. 4.1 MECHANISCHER AUFBAU Der mechanische Aufbau wurde in Anlehnung an eine WEITERFÜHRENDE LINKS UND LITERATUR: Stewart-Plattform entworfen. Die Plattform besitzt 6 www.beckhoff.at/twincat3 Freiheitsgrade und wird mittels einer Kaskade von jeweils zwei Hebeln und einem Schrittmotor pro Achse angetrieben. Das www.beckhoff.at/xfc Erfassen der Kugelpositoin erfolgt mit einem Touchscreen. www.ethercat.org Abb. 3 zeigt das realisierten Modell. Beckhoff Automation GmbH (2010): „TwinCAT 3 – eXtended Automation (XA)“ In: PC Control, Nr. 1, 2010 (Verfügbar unter: http://www.pc-control.net) Beckhoff Automation GmbH (2011): „XFC: EtherCAT-PLC mit 12,5 μs Zykluszeit“ In: PC Control, Nr. 1, 2011 (Verfügbar unter: http://www.pc-control.net) Abb. 3: Der realisierte mechanische Aufbau 4.2 EINGESETZTE HARDWARE KOMPONENTEN Die Anbindung von Sensorik und Aktorik ist im Aufbau mit EtherCAT-Komponenten realisiert worden. Um den regelungstechnischen Anforderungen gerecht zu werden, erfolgt die Ansteuerung des Touchscreen sowie dessen Clemens Maier Beckhoff Automation GmbH, Key Account Management Hauptstraße 4, 6706 Bürs, +43 (5552) 68813 23, c.maier@beckhoff.com 1999-2003: Ausbildung zum Maschinenschlosser, Vorarlberger Illwerke 2005-2007: Aufbaukolleg, Automatisierungstechnik, HTL-Bregenz 2007-2013: Supportingenieur, Beckhoff Automation GmbH 2010-2013: Bachelorstudium, FH-Vorarlberg, Wirtschaftsingenieurwesen 2013- : Key Account Management, Beckhoff Automation GmbH 2013- : Masterstudium, FH-Vorarlberg, Accounting, Controlling and Finance Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
ARBEITSGEMEINSCHAFT MECHATRONIK PLATTFORM Tag der Mechatronik MCI, INNSBRUCK, 23. September 2013 FH CAMPUS 02: NEXT GENERATION HMI MIT MOBILEN DEVICES Lutzmayr, D. Kurzfassung: Mobile Devices (Smartphones und Tablets) multifunktionalen Personal Computern). Da der letzte Ansatz haben sich im Consumer-Bereich als ohnedies direkt in die IT-Welt überleitet, sind insbesondere die Kommunikationsendgeräte durchgesetzt und werden durch ersten beiden Arten für eine Anbindung von mobilen Devices zahlreiche Funktionalitäten bei niedrigen Kosten und robuster untersuchungsrelevant. oder einfach ersetzbarer Hardware auch für Industrieanwendungen interessant. Kernaspekt dabei ist die 4. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG Kommunikation mit den Industriesystemen. An der FH CAMPUS 02 werden Referenzanwendungen als 4.1. Technologien Demonstratoren entwickelt, um Chancen, Möglichkeiten und Problemfelder im praktischen Einsatz testen zu können. Speicherprogrammierbare Steuerungen verfügen heutzutage meist über eine Anbindung an IP-basiertes Ethernet. 1. EINLEITUNG Damit liegt ein Zugriff über diesen Mechanismus nahe, unterstützt durch einen WLAN-Router, da die mobilen Devices Die Komplexität von automatisierten Maschinen und üblicherweise über WLAN mit dem Internet verbunden sind, Geräten nimmt beständig zu. Die meisten Vorgänge müssen eine Anbindung von SPSen an das Internet aber ein erhebliches dennoch von Bedienern beeinflusst werden können. Um die Sicherheitsrisiko darstellen kann. Untersucht werden daher Komplexität verständlich zu machen, werden als HMI (Human- einerseits der Zugriff auf tiefer Ebene (TCP/IP-Sockets) als Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen) auch auf Protokollebene, wobei sich hier aufgrund der grafische Bediengeräte eingesetzt. Diese sowie die Verbreitung Modbus over TCP anbietet. notwendigen Entwicklungswerkzeuge sind meist proprietär, Mikrocontroller als Herz von Embedded Systems bieten d.h. herstellergebunden und vergleichsweise kostenintensiv. vermehrt ebenfalls Ethernet-Schnittstellen an, hier kann auf die Hauptkritikpunkte sind aber die eingeschränkte Grafikleistung Erkenntnisse der SPS-Anbindung zurückgegriffen werden. und wenig attraktive Bedienung sowie die eingeschränkten Notwendig ist jedoch eine entsprechende Prozessorleistung, die Kommunikationsmöglichkeiten in Bezug auf die Anbindung gerade bei kleineren Systemen nicht gegeben ist. Hier kommt von weiteren Geräten, Datenbanken und zur direkten Kommunikation meist ein serielles Protokoll auf Dokumentationsarchiven. Zudem müssen die Geräte fest an der Basis von RS-232 zum Einsatz, mit wenig Aufwand können Maschine verbaut werden, eine Bedienung und Inbetriebnahme hier auch alternativ USB-Treiberchips und Bluetooth-Module ist damit nur von einem zentralen Platz aus möglich. angebunden werden, mit denen dann mit den mobilen Devices kommuniziert werden kann, wobei für USB meist ein Adapter 2. PROBLEM- UND AUFGABENSTELLUNG oder ein USB-OTG-Kabel (Universal Serial Bus On-The-Go) notwendig ist. Da die Benutzungs- und Bedienungsmöglichkeiten sowie die Grafikfähigkeiten von modernen Smartphones und Tablets 4.2 Auswahl der Endgeräte und Gegenstellen aufgrund der hohen Verbreitung bereits zur Alltagserfahrung gehören, sollen insbesondere die technischen Aspekte in Bezug Die Auswahl der mobilen Devices richtet sich nach der auf die Kommunikation mit Industrieanlagen bzw. deren Verbreitung und den technischen Möglichkeiten. Das Google- Steuerungen untersucht werden. Interessant sind dabei sowohl Betriebssystem Android kommt nach einer aktuellen Studie die Kommunikation selbst als auch die zusätzlichen (IDC 2013) auf einen Marktanteil von knapp 80 %, Apples iOS Möglichkeiten, die aufgrund der zahlreichen Features aktueller auf etwas über 13 %. Microsofts Windows Phone liegt weit mobiler Devices überhaupt erst möglich werden. abgeschlagen bei knapp unter 4 %. Dies alleine würde schon den Fokus auf Android rechtfertigen, hinzu kommt aber noch, 3. MATERIALIEN UND METHODEN dass Apple einen nichtlizensierten Zugriff auf iOS-Geräte unterbindet. So findet sich weder eine USB-Schnittstelle an den Im Sinne von angewandter Forschung sollen sämtliche Geräten noch können die notwendigen Bluetooth-Profile wie Erkenntnisse durch real aufgebaute Demonstratoren bestätigt SPP (Serial Port Profile) eingesetzt werden, soferne die Geräte werden, die gleichzeitig als erste Referenzimplementationen für nicht über den neuen wenig verbreiteten Standard Bluetooth 4.0 weitere Projekte mit der Industrie dienen können. Zunächst inkl. Low Energy verfügen (Bluegiga 2013). werden in einem ersten Schritt die Möglichkeiten theoretisch Für die praktische Umsetzung werden daher die aktuellen analysiert und deren Nutzenpotential erarbeitet. Dadurch erfolgt Referenzgeräte von Google eingesetzt: Google Galaxy Nexus eine Verdichtung auf einzelne Technologien, die dann auf ihre (Hersteller Samsung), Google Nexus 4 (Hersteller LG), Google Relevanz und Einsetzbarkeit geprüft werden. Mit diesen Nexus 7 (Hersteller Acer). Weiters wird mit dem Samsung Erkenntnissen werden für jeden Bereich Beispielanwendungen Galaxy Tab 2 7.0 ein besonders preisgünstiges 7“-Tablet gesucht, um entsprechend fokussierte Demonstratoren zu (Prämisse: Wenn es kaputt wird, wird ein neues angeschafft) planen, entwickeln und zu programmieren. ausgewählt. Ergänzt wird die Liste mit einem staub- und Dafür werden drei grundlegende Ansätze zur Steuerung in wasserdichten Motorola Defy, das mit aufgespieltem der Automatisierungstechnik identifiziert: Der Einsatz von Cyanogen-Mod die Generation der 2.x-Devices repräsentiert. Speicherprogrammierbaren Steuerungen, Embedded Systems Auf der Steuerungsseite kommen mit einer Siemens S7- mit Mikrocontrollern sowie PC-Systeme (der Einsatz von 315DP/PN eine ProfiNET-fähige Steuerung des Marktführers Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
bei Speicherprogrammierbaren Steuerungen zum Einsatz, Dieses wird über GPIOs (General Purpose I/Os) direkt weiters repräsentiert eine X20CP1484 das Unternehmen B&R seriell abgefragt, um aus der Ferne die angebrachten als größten österreichischen Hersteller. Leuchtdioden und das Display steuern zu können. Als Mikrocontroller-Gegenstück kommt ein an der FH CAMPUS 02 entwickeltes Lehr- und Forschungsboard zum 3. Ein Testaufbau mit der B&R-SPS, wo zur Eingabe und Einsatz, das mit einem 80C51-kompatiblen NXP-Prozessor Signalisierung zunächst Taster, Leuchtdioden und P89LPC938 stark auf Low-Cost getrimmt ist. Aufgrund der Temperatursensoren angebunden wurden, über weitere I/O- stark eingeschränkten Rechenleistung repräsentiert dieses Baugruppen können in Projekten beliebige Funktionen System die unterste Leistungsklasse – wenn die gesteuert werden (Abb. 3). Kommunikationsfunktionalität mit diesem Prozessor hergestellt werden kann, lässt sich das auf jede aktuelle Controllerplattform übertragen. 4.3 Aufbau der Demonstratoren und Abbildungen Für den Beweis der praktischen Umsetzbarkeit sowie für weitere Experimente wurden drei Demonstratoren aufgebaut: 1. Ein Parallelkinematik-Demonstrator, der mittels zweier Linearmotoren zweidimensionale Bewegungen abfährt. Zur Visualisierung wurde eine Zeichenfläche integriert, auf der die Bahn nachvollzogen werden kann (Abb. 1), gesteuert von der bereits erwähnten Siemens-SPS. Dazu wurde mit Eclipse eine passende Android-Applikation entwickelt, die auch im Google Play Store verfügbar ist. Abb. 3: Testaufbau mit B&R-SPS 5. ERGEBNISSE Sämtliche geplanten Kommunikationsvarianten konnten erfolgreich umgesetzt und getestet werden, die Erkenntnisse über Aufbau der Kommunikationsstrecke, Datenübertragung sowie die Randbedingungen und möglichen Probleme fließen direkt in aktuelle Projekte ein. 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK Die technische Machbarkeit der Kommunikation ist der wichtigste Meilenstein für die weitere Forschung auf diesem Gebiet. Mit den entwickelten Systemen sowie ersten Abb. 1: Parallelkinematik-Demonstrator mit Android-Eingabe Industrieprojekten werden auch zusätzliche Features wie das Einlesen von ein- und zweidimensionalen Barcodes mit der 2. Auf das FH CAMPUS 02 51er-Board wurde ein Kamera sowie NFC (Near Field Communication) getestet. Der Bluetooth-Modul aufgesteckt (Abb. 2): nächste Schritt werden dann Analysen zu Safety und Security sein, parallel dazu das Ausreizen der grafischen Fähigkeiten der Geräte (insbesondere auch in Richtung 3D-Darstellungen). 7. LITERATURVERZEICHNIS IDC 2013. Apple Cedes Market Share in Smartphone Operating System Market as Android Surges and Windows Phone Gains (Press Release), http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24257413 Bluegiga 2013: Bluetooth 4.0 Solutions for Apple iOS Devices, http://www.bluegiga.com/files/bluegiga/Presentations/BT4 _0_for_Apple.pdf Abb. 2: FH CAMPUS 02 51er-Board mit Bluetooth-Modul AUTOR FH-Prof. Dipl.-Ing. Dieter Lutzmayr CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft, 8010 Graz, Körblergasse 126 +43 316 6002 742, dieter.lutzmayr@campus02.at 2000 – 2004 Software-Entwickler, Produktmanager und Technischer Leiter für Business-Software 2005 – 2009 Key-Account-Manager für Engineering und Software Seit 2009 F&E-Manager und Fachbereichskoordinator Informatik in der Studienrichtung Automatisierungstechnik an der FH CAMPUS 02 Tag der Mechatronik 2013 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®, Innsbruck, 23. September 2013
ARBEITSG GEMEINSCH HAFT MECH HATRONIK K PLATTFORM Tag der Mecchatronik MCI, INNSB BRUCK, 23. September S 201 13 AUTO OMATISIER RUNGSSCH HRITTE BE EIM REGLE ER DESIGN N FÜR MEC CHATRONIISCHE SYSTEME E Werth, W. Kurzfassung: Ein möglichhst automatisiierter geradlin iniger Prozess beim Entwurf von Reglerrn für kompplexe mechatronischhe Systeme isst eine legitim me Forderungg des Anwenders. D Diese wird heuttzutage durch geeignete g Softw ware- Pakete wie MATLAB/SIM MULINK zumiindest in einnigen Bereichen guut ermöglicht. Im Rahmen n einer modeernen Ausbildung ssollen Studiereende daher nichtn nur mit den mathematischeen Methoden soondern auch mitm dem zeitgem mäßen Einsatz der T Tools vertraut gemacht werd den. Anhand zw weier Abb b. 1: Blockschallt einer Regelunngsaufgabe Beispiele werdrden die Möglichkeiten einer „Automatisierrung“ beim Reglerdeesign gezeigt. Die Größe r stellt hierbei die Füührungsgröße dar d – also z.B.. Schlüsselwörtter: Automatisieerter Reglerenttwurf, Modellierrung, eine Referenztrajek ktorie. Identifikation, PID-Regler, Formalismus F von n Lagrange. Ziel ist es nun n, in automatisieerter Weise für das betrachtetee Systtem einen Regler zu bestimm men, so dass dasd System derr 1. EINLEITU UNG Refeerenztrajektoriee gut folgen kann. Bei deer Lösung derr Regelungsaufgabe sind prinzip ipiell folgende Teilschrittee Die gezieelte Beeinflussuung von dynam mischen System men – durcchzuführen: insbesondere von mechatroonischen Systeemen – stellt eine Modellierung M bzw. b Identifikatition des System ms herausforderndde Aufgabe eiines Mechatron nikers dar. Zenntrale Schritte sind dabei das Beerechnen und das d Implementtieren Festlegung F des gewünschten SSystemverhalten ns eines geeigneeten Regelgesetzes. Im Laufe fe der letzten Jahre Auswahl A der Reeglerstruktur wurden nichht nur viele neue Reglerentwurfsverfa fahren Berechnung B ein nes Regelgesetzzes entwickelt, auuch die zur Verfügung V steh henden technisschen Simulation des Regelkreises Hilfsmittel zuum Reglerdesiggn unterstützen n den Ingenieuur in Implementierun I ng des Reglers zunehmendem m Maße. Damitt ist es nun beiinahe möglich,, eine Testen T des realeen Regelkreisveerhaltens Regelungsaufggabe automatisiiert zu lösen. Heutzutagge ist es leichht möglich, die Lösung zuminndest dlich ist es nichht möglich, allle aufgezähltenn Selbstverständ einzelner Schrritte der beschrriebenen Aufgaabe – zum Beiispiel Schrritte vollkommmen automatisieert, also ohne Eingriff bzw.. das Berechnenn eines Reglers – mit Hilfe geeigneter g Soft ftware Entsscheidung dess angehendenn Ingenieurs, auszuführen.. wie MATLAB B/SIMULINK oder o LabVIEW W per Knopfdrucck zu Dennnoch sind jee nach Wisseensstand der Studierenden,, erhalten. Zusäätzlich sind die d benötigten Rechenschrittee bei zum mindest Teilschrritte mittels geeeigneter Software bequem zuu komplexen Syystemen kaum per p Hand durch hzuführen. Diess liegt lösenn. auch an dder mathemattischen Komp plexität modderner Reglerentwurffsverfahren. War W es bisher oft nötig, fürr die 2. ID DENTIFIKAT TION UND EIN NFACHER PID D- verschiedenenn Teilaufgaben unterschiedlich he Programmp akete REGLERENT R TWURF zu verwendenn, kann man nun n weitgehennd alle Schrittee mit einem Tool abhandeln unnd damit zum mindest von einer Um einen Reegler überhauptt entwerfen zu u können, sindd schrittweisen A Automatisierunng sprechen. Ken nntnisse über die Regelstrecke nötig. Diese können k in Form m Selbstverrständlich ist es e Aufgabe ein ner Hochschulee, die von physikalischen n Zusammenhä hängen oder du urch geeignetee Studierenden sowohl mit denn theoretischen n Methoden als auch Messsdaten (z.B. in Form einer Sprrungantwort) vo orliegen. mit den zur Verfügung steehenden Werkzeugen vertrauut zu machen, um ddiese bestmögliich auf ihre beeruflichen Aufggaben vorzubereiten.. Daher sind an der FH Kärnten K sowohhl im Bachelorprogrramm Systems Engineeering als auch Masterprogram mm Systems Design rechnerun nterstützte Übuungen bzw. Laboorübungen zentraler Bestandteil B aller Lehrveranstalttungen im Beereich der Regelungstechnikk. Im Folgenden weerden beispielhhaft zwei in deer Lehre eingessetzte Vorgehensweiisen gezeigt, died Methoden und u Softwareeiinsatz miteinander veerbinden. Abb. 1 zeigt exemplaarisch das Blockschaltbild einer Regelungsaufggabe. Als möögliche Regelstrecke werdee ein Roboter mit dder Eingangsgrröße u und deer Ausgangsgrööße y betrachtet. Abb. 2: Defin nition der Summ menzeitkonstantte Tag der Mecha atronik 2013 MCI MANAGE EMENT CENTER R INNSBRUCK K DIE UNTERNE EHMERISCHE HOCHSCHULE E®, Innsbruck, 223. September 2013 2
Sie können auch lesen