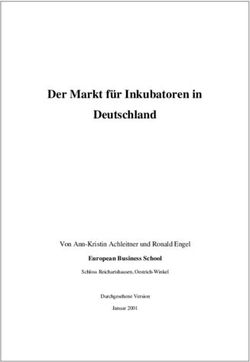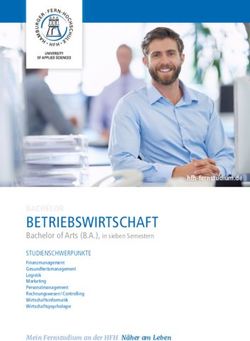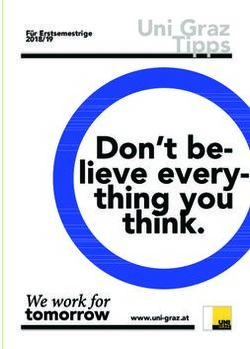Technische Universität Berlin
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Technische Universität Berlin
Fakultät III
Prozesswissenschaften
__________________________________________
Referat für Lehre und Studium
__________________________________________
OWL-Projekt
Studienabbruch
OWL – „Offensive Wissen durch Lernen“
Abschlussbericht
zum OWL-Projekt
Studienabbruch 2.-4. Semester:
Statistische Erhebung, sozialwissenschaftliche Untersuchung und
Maßnahmen in zentralen Großveranstaltungen
Projekt-Nr. 9935/33/50Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 2 Projekt-Team Leitung Silke Müllers, Helmut Schubert Studentische Mitarbeit Christian Bockisch, Sirkka Jacobsen, Susann Klemcke, Maria Norkus, Julia Schaufler Das Projektteam bedankt sich für die freundliche und hilfreiche Unterstützung seitens der zentralen Universitätsverwaltung Horst Henrici, Sabine Kinzel, Karin Lech, Erhard Zorn sowie für die wissenschaftliche Beratung Nina Baur Redaktion Christian Bockisch, Silke Müllers, Maria Norkus, Helmut Schubert
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 3
Inhaltverzeichnis
1 Vorstellung des Projekts „Studienabbruch“ 5
1.1 Ziel des Projekts 5
1.2 Problemdarstellung 5
1.3 Methodisches Vorgehen 6
2 Forschungsfeld und Begriffsdefinition „Studienabbruch“ 8
2.1 Begriffsdefinition 8
2.2 Forschungsstand und aktuelle Erklärungsansätze 8
3 Projektdurchführung 10
3.1 Statistische Untersuchungen 10
3.1.1 Abbruchanalyse 10
3.1.1.1 Anteile der Abbrecher/innen an Erst- und Neuimmatrikulierten 10
3.1.1.2 Verteilung der Abbrecher/innen über die Fachsemester 12
3.1.2 Studiengangswechsel 13
3.1.3 Analyse der Moses-Daten aus dem Bereich Mathematik 15
3.1.3.1 Notenspiegel aller Studiengänge zusammengefasst 16
3.1.3.2 Gesamt-Durchfallqoute nach Studiengang und Fach 17
3.1.3.3 Gesamt-Durchfallqoute nach Geschlecht und Fach 17
3.1.3.4 Anmeldung und „nicht erschienen“ zum Prüfungstermin 17
3.1.3.5 Überprüfung von Mathematik als möglichem Abbruchgrund 18
3.2 Gruppendiskussion 20
3.2.1 Durchführung 20
3.2.2 Ergebnisse 20
3.3 Fragebogen zum Studienabbruch 23
3.3.1 Grundlage und Durchführung 23
3.3.2 Ergebnisse der Analyse des Fragebogens 24
3.3.2.1 Soziale Integration 24
3.3.2.2 Leistungsdefizite 26
3.3.2.3 Überforderung 26
3.3.2.4 Erwerbstätigkeit 27
3.3.2.5 Falsche Studienfachentscheidung 28
3.3.2.6 Interessenwechsel 29
3.3.2.7 Ausstattung an der Universität 29
3.3.2.8 Studienorganisation 30
3.3.2.9 Lehre und Lehrende 31
3.3.2.10 Persönliche und familiäre Probleme 33
3.3.2.11 Soziale Herkunft 34
3.3.2.12 Finanzielle Probleme 34
3.3.2.13 Zusammenfassung 35
4 Projektergebnisse 38
4.1 Zusammenfassung der Einzelergebnisse 38
4.2 Handlungsfelder 44
4.3 Selbsteinschätzung zu diesem OWL-Projekt 47
5 Anhang 48Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 4
5.1 Abbildungsverzeichnis 48
5.2 Literaturhinweise 49
5.3 Merkblatt zur Gruppendiskussion 50
5.4 Leitfaden zur Gruppendiskussion 51
5.5 Zusammenfassung der Gruppendiskussionen 52
5.6 Interview mit der Psychologischen Studienberatung 56
5.7 Fragebogen 57Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 5
1 Vorstellung des Projekts „Studienabbruch“
1.1 Ziel des Projekts
Das OWL – „Offensive durch Lernen“ – Projekt hat zur Aufgabe, das Studienabbruchverhal-
ten der Studierenden der Fakultät III Prozesswirtschaften in den letzten vier Jahren zu unter-
suchen. Ziel des Projekts ist eine Analyse des Abbruchverhaltens als Basis für die Qualitäts-
verbesserung von Lehre und Studium sowie begleitender Maßnahmen und damit die Erhö-
hung der Erfolgsquote der einzelnen Studiengänge.
Die Fakultät III „Prozesswissenschaften“ bietet die Bachelorstudiengänge Energie- und Pro-
zesstechnik, Technischer Umweltschutz und Werkstoffwissenschaften an, außerdem den
Studiengang Lebensmittelchemie (Abschluss Staatsexamen oder Diplom) sowie die Diplom-
studiengänge Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie, Energie- und Verfahrenstechnik,
Gebäudetechnik und Werkstoffwissenschaften.
Der Studienabbruch im 2. bis 4. Semester steht im Fokus der Untersuchungen.
1.2 Problemdarstellung
Aufbauend auf mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen beinhalten die Studienkon-
zepte der Fakultät III einen gemeinsamen ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Viele Pro-
bleme - angefangen von Standortwechsel, ungewohntem Zwang zur Selbstorganisation,
Stressfähigkeit, Zweifel am Studienziel, begrenzte oder mangelnde Ausstattung der Praktika,
didaktische Probleme der Großveranstaltungen bis hin zu Orientierungsproblemen in einem
neuen sozialen Umfeld - kommen hier zusammen. Es ist anzunehmen, dass dies die zen-
tralen Gründe für den Studienabbruch sind. Genaue Ursachen, Anteile oder Zusammen-
hänge sind jedoch nicht bekannt.
Als Arbeitshypothese wird das Abbruchverhalten in verschiedene Fallgruppen gegliedert, die
auf unterschiedlichen Gründen basieren und verschiedene Gegenmaßnahmen ermöglichen:
• externe Gründe wie Familie, Ortwechsel, Krankheit etc.
(nicht durch die TU Berlin zu beeinflussen)
• Qualität der Serviceveranstaltungen
(darauf hat die Fakultät III nur begrenzten Einfluss)
• Geplanter Studiengangswechsel aufgrund von Zulassungsbeschränkungen in einem
anderen Studiengang (typische Wechselkonstellationen innerhalb der Fakultät)
• „Fehlpassung“ zwischen Studierverhalten und Studienangebot
Die so genannte „Fehlpassung“ ist das Hauptfeld der Untersuchung, zumal die Fakultät da-
rauf den größten Einfluss hat. Hier spielen Faktoren wie Finanzmangel, fehlende personelle
Ausstattung und Räumlichkeiten, didaktische Unzulänglichkeiten und eine Vielzahl admini-
strativer Regularien einerseits und Orientierungsschwierigkeiten, ungeschicktes Zeitmana-Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 6
gement, mangelnde Gruppenbildung und soziale Vernetzung, falsche Einschätzung des
Schwierigkeitsgrades bzw. der eigenen Leistungsfähigkeit, mangelnde Motivation und Hin-
wendung zu anderen Lebensinhalten andererseits eine Rolle.
1.3 Methodisches Vorgehen
Es stehen keine sozialwissenschaftlichen Methoden zur Verfügung, die zielgenau zu den
oben genannten Fällen passen. Letztlich lässt sich nur eine Untersuchung durchführen, die
ein möglichst bereites Spektrum an Gründen erfasst, um diese in einer anschließenden
Auswertung zu sichten. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:
• Welche Faktoren behindern den Studienfortschritt und was sind Gefahren in den
ersten Semestern?
Zielgruppe: Studierende der ersten Semester.
• Wer wechselt innerhalb der Studiengänge der Fakultät III, aus diesen heraus oder in
diese hinein und zu welchem Zeitpunkt?
Zielgruppe: 1. - 7. Semester
• Wenn abgebrochen wurde, was sind die Gründe?
Zielgruppe: Studienabbrecher/innen
Die Wahl der Methoden der Abbruchanalyse wurde mit Frau Prof. Nina Baur vom Fachgebiet
Methodenlehre der Fakultät VI diskutiert. Demnach erfolgte die Analyse des Studienab-
bruchverhaltens an der Fakultät III methodisch durch die Verknüpfung qualitativer und quan-
titativer Verfahren:
• Erhebung und Auswertung statistischer Daten:
- zum Studienabbruch
- zum Studiengangswechsel
- zu Prüfungsergebnissen im Fach Mathematik
• Gruppendiskussionen mit Studierenden der Fakultät III
• Fragebogen zum Studienabbruch
Die Akteure dieser Analyse sollten über ein Mindestmaß an methodischen soziologischen
Grundkenntnissen verfügen.
Frau Sirkka Jacobsen, Studentin der Energie und Verfahrenstechnik, hat Vorlesungen zur
Sozialforschung belegt, die sie in die Lage versetzten, strukturierte Gruppendiskussionen
vorzubereiten, durchzuführen und auch auszuwerten, gemeinsam mit Frau Müllers vom Re-
ferat für Lehre und Studium und Frau Richter, Mitarbeiterin im OWL-Projekt GiNUT (Gender
in Natur-, Umwelt- und Technikwissenschaften) und für die Berücksichtigung von Gender-
aspekten in allen Evaluationen der Fakultät III zuständig.
Für eine Analyse des Studiengangwechsels sollte die Zahl der Studierenden ermittelt wer-Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 7 den, die die Studiengänge der Fakultät III verlassen, außerdem wohin sie wechseln. Hier war der Zugriff auf Daten der Abt CD hilfreich. Diesbezüglich wurde in Absprache mit Herrn Dr. Thurian (SC3), Frau Dr. Kinzel (CD) sowie der Datenschutzbeauftragten Frau Röthig eine Datenanalyse ausgeführt. Für diesen Bereich wurde Herr Bockisch, Student der Biotechno- logie, eingestellt, der bei Frau Dr. Kinzel die Handhabung des Statistikprogramms SPSS ver- tiefte. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass dies unter Einhaltung der Datenschutzrichtli- nien erfolgte und die Fakultät III zu keinem Zeitpunkt direkten Zugriff auf personenbezogene Daten oder Adressen hatte. Letztlich sollte erfasst werden, welche Gründe von Abbrecher/innen angegeben werden. Hierzu wurde mit Herrn Dr. Henrici (I A) vereinbart, die entsprechenden Personen in der Adressdatenbank zu identifizieren und ihnen einen eigens entwickelten Fragebogen zu schicken, dessen Beantwortung auch online ermöglicht wurde. Für die Entwicklung und Auswertung des Fragebogens wurden drei Studentinnen der Soziologie, Frau Maria Norkus, Frau Julia Schaufler und Frau Susann Klemcke, eingestellt. Im Folgenden sind diese drei Einzelmaßnahmen als Berichte zu finden. Es schließt sich eine Bewertung an, aus der die Projektmitarbeiter/innen Handlungsempfehlungen ableiten.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 8 2 Forschungsfeld und Begriffsdefinition „Studienabbruch“ 2.1 Begriffsdefinition Als Studienabbrecherinnen oder Studienabbrecher werden Personen bezeichnet, die das Studium an der Fakultät III Prozesswissenschaften der TU Berlin beginnen und ohne Ab- schluss beenden. Als Abbrecher/innen gelten in diesem Fall auch Studierende, die nach dem Abbruch ein anderes Studienfach an einer anderen Fakultät der TU oder einer anderen Uni- versität beginnen oder aber das gleiche Studienfach an einer anderen Universität fortsetzen. Die Untersuchung umfasst Studierende der Fakultät III, die ihr Studium innerhalb der letzten sieben Jahre abgebrochen oder innerhalb der Fakultät gewechselt haben. 2.2 Forschungsstand und aktuelle Erklärungsansätze Der aktuelle Forschungsstand ist breit gefächert und schwer überschaubar. Die Forschungs- ergebnisse sind ebenso unterschiedlich wie die Forschungsfragen, die den Studienabbruch behandeln, und die Methoden, die zur Datengenerierung genutzt werden. Die Erklärungsansätze, die aus den verschiedenen Theorien zum Studienabbruch extrahier- bar sind, sind vielfältig. Es wird besonderes Augenmerk auf folgende Problematiken gelegt, die im Folgenden kurz dargelegt werden sollen. Genderaspekte Eine nicht unbedeutende Zahl der Untersuchungen zum Thema Studienabbruch beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Geschlecht eine Kategorie ist, an der sich unterschiedliches Studienabbruchverhalten ausmachen lässt. Es gibt zwar kaum Unterschiede in den Zahlen, dafür aber Studienabbruchgründe, die viel deutlicher bei Frauen auftreten. Dazu zählen familiäre Probleme. Besonders Kindererziehung ist ein wichtiger und sehr ausschlaggeben- der Grund für Frauen, ihr Studium zu beenden. Ein Motiv, das bei Männern eine weit weniger große Rolle spielt. Frauen sind immer noch hauptverantwortlich für die Kindererziehung und auch viel häufiger allein erziehend. Offensichtlich ist die Vereinbarkeit von Familie und Stu- dium für Frauen sehr viel schwerer zu bewerkstelligen. Auch das Berufsfeld, auf das die uni- versitäre Ausbildung vorbereiten soll, ist stark männlich geprägt. Gründe für einen Studien- abbruch könnten demnach schlechte Berufsaussichten für Frauen sein. Soziale Herkunft Besonders die soziale Herkunft ist ein Feld, mit dem sich viele Studien beschäftigen. Die Zu- gehörigkeit zu einer bestimmten, sozialen Schicht bedingt den Bildungszugang, dementspre- chend die Hochschulvoraussetzungen sowie den Verbleib an der Hochschule und die Karrie- reaussichten. Die Hürden, einen Studienplatz an der Universität zu bekommen, sind für Menschen aus sozial schwächer gestellten Gruppen schwerer zu überwinden, da soziale Selektionsmechanismen bereits in der Schulzeit wirken. Laut HIS-Studie 2003 kommen nur
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 9 11% der Studierenden aus einer niedrigen sozialen Herkunftsgruppe, 81% aus gehobenen Schichten1. Studierende aus unteren sozialen Herkunftsgruppen haben häufig finanzielle Probleme, da der Finanzierungsrahmen bei ihnen enger gestrickt und durch kleine Schwan- kungen aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Aber auch kulturelle Probleme spielen eine Rolle. Unterstützung und Hilfe sind unerlässlich, um die Motivation zu erhalten und Krisen zu bewältigen. Dies ist in bildungsferneren Schichten seltener gegeben, da hier das Studium eher als Risiko betrachtet wird und von der eigenen Lebensrealität weit entfernt ist. Studie- rende aus bildungsferneren Schichten fällt es schwerer, sich an Hochschule und ihr soziales System zu gewöhnen und möglicherweise auftretende Studienprobleme zu bewältigen. Studienbedingungen Schlechte Studienbedingungen sind oft Kristallisationspunkt der Kritik. Sowohl von Seiten Studierender und Studienabbecher/innen wie auch der Öffentlichkeit wird immer wieder Kritik an den Studienbedingungen laut. Obwohl stark bemängelt, führen schlechte Studienbedin- gungen nicht zwangsläufig zu einem Studienabbruch. Allerdings entstehen im Zuge schlechter Studienbedingungen oft Motivationsverluste, welche den Studienabbruch begün- stigen. Schlechte Betreuung an der Universität, mangelnde technische Ausstattung, unüber- sichtliche Studienorganisation, veraltete Lehrmethoden, schlechte Didaktik, Massenveran- staltungen, fehlende Lern- und Pausenräume werden von Studierenden seit Jahren bemän- gelt und können dazu führen, dass sie sich nicht in das System Hochschule integrieren kön- nen und an institutionellen Rahmenbedingungen scheitern, obwohl sie kognitiv gut aufge- stellt sind. Besonders deutlich wird die Kritik, wenn es um die Ausstattung der Hochschule geht. Die Ausstattung der Labore, aber auch ungenügende Pausen und Aufenthaltsräume sowie überfüllte Hörsäle sind nur einige der Kritikpunkte, die immer wieder von Studierenden und Studienabbrecher/innen genannt werden. Persönliche Gründe Besonders in den Naturwissenschaften und den technischen Fächern werden eigene Lei- stungsdefizite und Prüfungsversagen als Hauptgründe für den vorzeitigen Austritt aus der Universität angeführt. Viele Studierende scheitern an persönlichen Problemen, die sich dem universitären Einflussbereich fast gänzlich entziehen. Zu persönlichen Problemen gehören beispielsweise eigene Krankheit, Konflikte innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis. Die Aufnahme eines Studiums ist verbunden mit einer Neugestaltung der Lebenssituation. Verbunden ist die Aufnahme des Studiums zumeist mit einem Ortswechsel, dem Verlust von Freunden und Familie und den komplexen Anforderungen der Organisation des Studienall- tags. Gerade junge Menschen, die frisch aus der Schule kommen, finden sich in dieser Situ- ation nur schwer zurecht. 1 Heublein, Ulrich/Sommer, Dieter, Spangenberg, Heike: Ursachen des Studienabbruchs. Analyse 2003. URL: http://www.bmbf.de/pub/ursachen_des_studienabbruchs.pdf (abgerufen am 06.09.08)
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 10 3 Projektdurchführung 3.1 Statistische Untersuchungen 3.1.1 Abbruchanalyse Die Abbruchanalyse umfasst aufgrund der zum Zeitpunkt der Untersuchung vorhandenen Daten nur die Semester WiSe 00/01 bis SoSe 07. Der Begriff Abbrecher/in kann verschieden definiert werden. Hier wird ein/e Abbrecher/in als Studierende/r definiert, die/der ohne be- standene Hauptdiplomprüfung abbricht. Dabei gilt als Abbrecher/in, wer ohne Vordiplom oder Hauptdiplom abgebrochen hat, unabhängig davon, ob eine Prüfung endgültig nicht bestan- den worden ist und aus welchen Gründen das Studium abgebrochen wurde. Im Gegensatz dazu gilt jemand nicht als Abbrecher/in, wenn ein Wechsel innerhalb der Fakultät III stattfin- det. Da die Prüfungsdatenbank als Ausgang genutzt wird, liegt mindestens eine Prüfungsanmel- dung vor. Damit ist ausgeschlossen, dass sich jemand nur eingeschrieben und keinerlei Ak- tivitäten vorgenommen hat. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass Studierende sich zwar zur Prüfung anmelden, aber auch wieder abmelden. Zur Analyse wurden die Daten aus der Prüfungs-, Studienverlaufs- und Stammdatenbank herangezogen, um die notwendigen Daten zu generieren. Es sind Fehler in den Datenbanken bekannt, und mögliche geringe Fehler wurden einkalkuliert. Daher muss man auch davon ausgehen, dass nur eine Stich- probe und nicht die Grundgesamtheit untersucht wurde, da es durchaus sein kann, dass we- gen Fehleinträgen nicht alle Fälle oder Prüfungen untersucht wurden konnten. Leider hat sich im Verlauf des Projektes gezeigt, dass aus den Daten kein direkter Exmatrikulations- grund, wie z. B. ein bestimmtes Fach, herzuleiten ist. 3.1.1.1 Anteile der Abbrecher/innen an Erst- und Neuimmatrikulierten Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, waren der Frauen- und Männeranteil im WiSe 2000/01 na- hezu gleich. Danach ging die Frauenquote der Neuimmatrikulierten deutlich zurück, gefolgt von einem erneuten Anstieg bis zum SoSe 07, in dem wieder fast gleich viele Männer wie Frauen immatrikuliert wurden. Um Verfälschungen durch Schwankungen der absoluten Neuimmatrikulationszahlen bzw. Abbrecherzahlen in der Zeitreihe zu vermeiden, wurde in der Analyse (Abbildung 2) der An- teil der Abbrecher von den Neuimmatrikulierten anhand des Startsemesters (Verbindungs- merkmal) untersucht. Deshalb ist auch nur ein kleinerer Zeitraum (WiSe 00/01 bis WiSe 03/04) dargestellt. Außerdem wurde nur das Wintersemester berücksichtigt. Zu erwähnen ist, dass Fehleinträge in der Datenbank zur Neuimmatrikulation (rückgemeldet statt neu immatri- kuliert) bei einem Studiengangwechsel nicht berücksichtigt werden können.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 11
Abbildung 1: Prozente nach Geschlecht und Nationalität von gesamt Neuimmatrikulierten
Abbildung 2 macht deutlich, dass die Abbruchquoten nicht steigen, im Gegenteil, sie fallen
sogar. Erklärung: Es sind die Anteile der Abbrecherfraktionen (m, w, d, n. d.) an den Neuim-
matrikuliertenfraktionen (m, w, d, n. d.) dargestellt, d. h. 34% der männlichen Erst- und
Neuimmatrikulierten über alle Studiengänge der Fakultät III im WiSe 00/01 haben innerhalb
des Untersuchungszeitraumes nach Definition abgebrochen.
Abbildung 2: Veränderung des Anteils von Abbrecher/inne/n (nach Geschlecht und Nationalität) an den
entsprechenden Erst‐ und Neuimmatrikulierten über die Zeit (Startsemester)
Die Abbildung zeigt, dass die Frauen deutlich geringere Abbruchquoten aufweisen als dieAbschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 12 Männer. Die Abbruchquote der deutschen Studierenden ist höher als die der nicht deutschen Studierenden. Das allgemeine Zurückgehen der Abbruchquoten darf nicht fehlbeurteilt wer- den, da nicht alle Abbrecher bereits nach dem ersten Semester abbrechen. Jedoch wurde festgestellt, dass im Durchschnitt nach dem 3. FS bereits 50% der absoluten Abbrüche er- reicht sind (siehe Abbildung 3). Aus den genannten Gründen kann die Darstellung auch nur bis zum WS03/04 erfolgen. 3.1.1.2 Verteilung der Abbrecher/innen über die Fachsemester Abbildung 3 zeigt deutlich, dass bis zum Fachsemester 3 bereits über 50 % der Abbrüche geschehen. Die Analyse hat ergeben, dass dieses Verhältnis über die Jahre innerhalb der Semesterarten (WiSe, SoSe) relativ konstant bleibt. Lediglich ab dem WiSe 04/05 zeigt sich eine Verschiebung zu späteren Fachsemestern, d. h die Studierenden brechen nicht schon in FS1 und 2 ab, sondern bleiben etwas länger. Wie sich die Abbruchquote in der Zeitreihe verhält, ist schwer zu sagen, da in den „neueren“ untersuchten Semestern noch nicht alle potentiellen Abbrecher/innen erfasst sind. Abbildung 3: Anteil der Abbrecher/innen je Fachsemester (WS00/01 SS07); gestapelt Anmerkung: Die Stapelung ergibt keine 100 Prozent, da sich der Rest der Abbrecher/innen bis zum 46. Fachsemester zieht. Wie in Abbildung 4 noch einmal deutlich zu sehen ist, findet nach dem 2. Fachsemester über ein Viertel und damit der größte Teil der Abbrüche statt.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 13 Abbildung 4: Anteil der Abbrecher/innen je Fachsemester (WS00/01 SS07) 3.1.2 Studiengangswechsel Die Auswertung beruht ausschließlich auf den Studierendendaten, da korrekte Prüfungsda- ten zum Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung standen. Der untersuchte Zeitraum liegt zwi- schen WiSe 99/00 und WiSe 07/08 mit Stand vom 10.02.2008. Insgesamt fanden 367 Studiengangswechsel innerhalb der Fakultät III statt. Aus der Fakultät III wechselten 363 Studierende in andere Fakultäten der TU, während 373 Studierende aus anderen Fakultäten in die Fakultät III wechselten. Fakultät III ist also ein leichter Wande- rungsgewinner. Abbildung 5 zeigt, dass Lebensmittelchemie (Staatsexam.), Energie- und Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie die „Spenderstudiengänge“ mit den größten Häufigkeiten sind. Abbildung 6 zeigt, dass Lebensmittelchemie (Ergänzung/Aufbaustudium), Biotechnologie und Chemie die „Empfängerstudiengänge“ mit den größten Häufigkeiten sind. Die Beziehung zwischen Lebensmittelchemie (Staatsexam.) und Lebensmittelchemie (Erg.) ist darin zu sehen, dass viele Studierende die Möglichkeit nutzen, zwei Abschlüsse zu be- kommen. Während sie auf einen Prüfungstermin für das Staatsexamen bei der zuständigen Behörde warten, nutzen sie die Zeit, um ein Aufbaustudium in Lebensmittelchemie zu absol- vieren. Daher sind diese Wechsel nicht als problematisch anzusehen. Die Analyse zeigt weiterhin, dass rund 50% der Wechsel innerhalb der Fakultät III stattfin- den. Der Anteil an Studierenden, die von einem Diplom-Studiengang zu einem anderen
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 14 Diplom-Studiengang wechseln, beträgt 77,5%. Drei Viertel der Diplom-Studierenden bleiben also dem Abschluss treu. Die meisten Wechsel finden nach dem 2. Fachsemester (FS) statt, gefolgt vom 1. FS (siehe Abbildung 7). Studiengänge, aus denen sehr früh (Median der FS=2) gewechselt wird, sind Energie- und Verfahrenstechnik, Gebäudetechnik und Werk- stoffwissenschaften, gefolgt von Lebensmitteltechnologie mit Median (FS)=3. Auffällig ist der hohe Median (FS)=9,5 bei Lebensmittelchemie(Staatsexamen). Der erneute Anstieg der Wechsel in FS 9-11 ist wieder auf die Wechsel von Lebensmittelchemie (Staatsexamen) zu Lebensmittelchemie (Erg.) zurückzuführen, da meistens in diesen Semestern die Anmeldung zum Staatsexamen vollzogen wird. Der Studiengang Energie- und Verfahrenstechnik gibt vor allem an die Studiengänge Tech- nischen Umweltschutz, Chemie, Physikalische Ingenieurwissenschaften und Gebäudetech- nik ab. Lebensmitteltechnologie gibt überwiegend an die Biotechnologie ab und Technischer Umweltschutz gibt überwiegend an Energie- und Verfahrenstechnik ab. Die Vermutung, dass LMT als „Parkstudium“ für BT genutzt wird, ist damit bestätigt; jedoch muss man beachten, dass 63 Wechsler/innen in 16 Semestern nur knapp 4 Wechsel pro Semester sind. Die Ver- mutung, dass viele von EVT zu TUS wechseln, ist hingegen nicht bestätigt. In dem unter- suchten Zeitraum wechselten 19 Studierende von EVT zu TUS und 35 von TUS zu EVT. Abbildung 5: Spenderstudiengänge ‐ Studiengangwechsel (WS99‐WS07) nach Geschlecht und Nationalität
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 15 Abbildung 6: Empfängerstudiengänge ‐ Studiengangwechsel (WS99‐WS07) nach Geschlecht und Nationalität Abbildung 7: Kennwerte der Fachsemesteranzahl beim Studiengangwechsel (WS99‐WS07) Eine geschlechterspezifische Untersuchung bzw. Auswertung ist hier leider nicht möglich, da die zur Verfügung gestellten Daten lediglich die absoluten Zahlen der Wechsler/innen bein- halteten, welche nicht die Frauen/Männer-Verteilung in den einzelnen Studiengängen und Semestern berücksichtigen. Gleiches trifft für das Merkmal Nationalität zu. 3.1.3 Analyse der Moses-Daten aus dem Bereich Mathematik MOSES stellte freundlicherweise Häufigkeitstabellen von einigen erfassten Prüfungsdaten der Fächer Analysis I für Ingenieure (ANA I), Analysis II für Ingenieure (ANA II) und Lineare Algebra für Ingenieure (LinA) zur Analyse zur Verfügung. ANA I und LinA finden laut Stu- dienverlaufsplan im 1. Semester statt und ANA II im 2. Semester. Eigentlich sollten diese
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 16 Daten mit anderen „Nicht-Mathe-Fächern“ verglichen werden, was aber nicht möglich war, da die Datenerfassung anderer Fächer bei MOSES erst ab einem späteren Zeitpunkt erfolgte. Die erhaltenen Daten beinhalten das Fach, das Prüfungsdatum, den Studiengang, das Ge- schlecht und den Notenspiegel. Untersuchungszeitraum war 2003 - 2008. Dabei konnten aus zeitlicher Verschiebung in der geschlechterspezifischen Analyse noch zusätzliche Prüfungs- termine mit einbezogen werden. Das Merkmal Nationalität wird bei MOSES nicht erfasst und kann daher nicht untersucht werden. Die analysierten Studiengänge waren: Dipl.-Ing. Bio- technologie (Dipl-BT), Dipl-Ing. Energie- und Verfahrenstechnik (Dipl-EVT), Dipl.-Ing. Ge- bäudetechnik (Dipl-GT), Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologie (Dipl-LMT), Dipl.-Ing. Technischer Umweltschutz (Dipl-TUS), Dipl.-Ing. Werkstoffwissenschaften (Dipl-WeWi), Bachelor of Science Energie- und Prozesstechnik (BSc-EPT), Bachelor of Science Technischer Umwelt- schutz (BSc-TUS), Bachelor of Science Werkstoffwissenschaften (BSc-WeWi). Der Daten- umfang der Bachelor-Studiengänge war teilweise zu gering, um eine Einzelanalyse zu voll- ziehen. Im Folgenden werden nur noch die Abkürzungen verwendet. Diese Daten wurden zu den folgenden Auswertungen aufbereitet. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es keine Veränderung der Durchfallquoten in den drei genannten Mathe-Fächern in der Zeitreihe gibt. Teilweise gibt es starke Schwankungen der Durchfallquoten zwischen den einzelnen Prüfungsdaten, aber ein Trend zu geringeren oder höheren Durchfallquoten ist nicht ersichtlich. 3.1.3.1 Notenspiegel aller Studiengänge zusammengefasst In Abbildung 8 ist der Notenspiegel aller analysierten Studiengänge nach Fächern zusammengefasst dargestellt. Es wird deutlich, dass Analysis I mit 58 % die höchste Durch- fallquote hat, gefolgt von Lineare Algebra mit 42% und Analysis II mit 38%. Ein „Nicht- Erscheinen“ zum Prüfungstag wird als 5,0 gewertet, aber gesondert erfasst. Diese Fälle sind also in den Notenspiegeln nicht enthalten, so dass keine Verzerrung entsteht. Abbildung 8: Notenspiegel aller analysierten Studiengänge nach Fächern zusammengefasst in %
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 17 3.1.3.2 Gesamt-Durchfallqoute nach Studiengang und Fach Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Durchfallquoten der Studiengänge in den drei „Mathe-Fächern“ über den Untersuchungszeitraum. Die Bachelor-Studiengänge wurden hier bewusst nicht berücksichtigt, da die Grundgesamtheit noch zu gering war, um eine Aus- sage zu treffen. Es ist deutlich ein Unterschied zwischen den einzelnen Studiengängen er- kennbar. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Alle sind den gleichen Anforderungen in den jeweiligen Fächern ausgesetzt. Abbildung 9: Durchfallquoten nach Studiengängen und Fach in % der Gesamtprüfungsteilnehmern 3.1.3.3 Gesamt-Durchfallqoute nach Geschlecht und Fach Abbildung 10 zeigt deutlich, dass Frauen immer eine höhere Erfolgsqoute aufweisen als Männer. Abbildung 10: Durchfallquoten nach Geschlecht und Fach in % der Gesamtprüfungsteilnehmer 3.1.3.4 Anmeldung und „nicht erschienen“ zum Prüfungstermin Diese Untersuchung sollte zeigen, wie viele Studierende sich zu einer Mathematikprüfung anmelden, dann aber zur Prüfung ohne Abmeldung nicht erscheinen. Die jeweiligen Pro-
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 18 zentzahlen in Abbildung 11 spiegeln den Anteil der Studierenden an der am Prüfungstag vorliegenden Anmeldungszahl wieder. Abmeldungen, die innerhalb der Abmeldefrist getätigt wurden, sind in den Anmeldungen nicht mehr enthalten. In Abbildung 11 sind die Anteile der zur Prüfung nicht erschienenen Studierenden von der Gesamt-Anmeldungszahl nach Fä- chern dargestellt unter Berücksichtigung aller analysierten Studiengänge. Es gibt keine gra- vierenden Unterschiede, jedoch ist der Anteil mit rund 20 % allgemein recht hoch. Normalerweise wird ein „Nichterscheinen“ zur Prüfung mit 5,0 bewertet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein ärztliches Attest vorzulegen und somit keinen „nicht bestandenen Prü- fungsversuch“ zu haben. Der Grund dieser doch recht hohen Anteile ist nicht erforscht. Ne- ben gesundheitlichen und anderen Gründen sind Prüfungsangst oder Angst, die Prüfung nicht zu bestehen und somit einen Prüfungsversuch zu verlieren, in Betracht zu ziehen. Abbildung 11: Anteil Nicht Erschienen von Gesamt‐Anmeldungen nach Fächern in % Ein jahreszeitbedingtes erhöhtes Fernbleiben von der Prüfung (grippale Infekte o. ä.) konnte in einer weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Es gibt durchaus unterschiedliche Werte in verschiedenen Jahren, aber innerhalb eines Jahres konnte kein Trend erkannt werden. Jedoch zeigt sich wie in Abbildung 11 ersichtlich ein Unterschied zwischen den Fächern. 3.1.3.5 Überprüfung von Mathematik als möglichem Abbruchgrund Ursprünglich sollte diese Analyse auch dazu dienen, vermutete Gründe für den Abbruch zu beweisen. Ein in der Gruppendiskussion immer wieder erwähnter Abbruchgrund war die hohe Belastung durch die Mathematik-Module. Leider war es mit den vorliegenden Daten NICHT möglich, den Abbruch eines Studierenden auf dessen Misserfolg oder die Anzahl der Prüfungsversuche in bestimmten Prüfungen (vermutet waren ANAI, ANAII und LinA), sta- tistisch zurückzuführen. Um dennoch einen möglichen Zusammenhang zu verdeutlichen, sind in Abbildung 12 die Verteilungen der Prüfungsversuche einiger Fächer dargestellt. Es wird deutlich, dass im ersten Prüfungsversuch in Analysis I (50%) und LinA (64%) die ge-
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 19 ringsten Erfolgsquoten liegen. Lediglich Analysis II liegt im Erfolgsbereich der anderen Fä- cher. Dazu muss angemerkt werden, dass die hier dargestellten Fächer aus dem Vordiplom alle als „schwer“ angesehen werden. Als Abbruchgrund ausgeschlossen werden kann das endgültige Nichtbestehen im dritten Versuch, da über den gesamten Untersuchungszeitraum (WS00/01 bis SS07) von allen Stu- dierenden in ANA I nur 18, in ANA II nur 1 und in LinA nur 7 Studierende die dritte mündliche Prüfung nicht bestanden haben. Diese Zahlen sind in Anbetracht der Gesamtprüfungsteil- nehmer/innen sehr gering. Abbildung 12: Verteilung der Prüfungsversuche ausgewählter Fächer
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 20
3.2 Gruppendiskussion
3.2.1 Durchführung
Die Gruppendiskussionen fanden - getrennt nach Studiengängen - an vier Terminen in der
Woche vom 21. - 24. Januar 2008 statt. Die Studiengänge Biotechnologie und Lebensmittel-
technologie wurden in derselben Diskussionsrunde erörtert, ebenso die Studiengänge Ener-
gie- und Verfahrenstechnik und Gebäudetechnik.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder Diskussion sollten sich aus Studienanfängerin-
nen und –anfängern, Studierenden höherer Semester und Studierenden, die über einen Stu-
dienabbruch nachdenken oder diesen bereits vollzogen haben, zusammensetzen. Es war
trotz umfassender Werbung für das Projekt schwierig, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
finden.
„Echte“ Studienabbrecherinnen und –abbrecher nahmen nicht teil, sehr wohl aber Studie-
rende, die solche kannten.
Die Zahl der Studierenden lag je nach Studiengang zwischen drei und sieben. Es wurde dar-
auf geachtet, dass an jeder Diskussion Frauen und Männer teilnahmen sowie Studierende
aus Grund- und Hauptstudium bzw. Bachelor. Einige Studierende hatten bereits einen Stu-
diengangswechsel hinter sich oder eine abgeschlossene Berufserfahrung.
3.2.2 Ergebnisse
Ein ausführliches Protokoll über alle Gruppendiskussionen befindet sich im Anhang. Dabei
wurden vier Themenbereiche, die in allen Diskussionen angesprochen wurden, identifiziert
und zusammengefasst:
• Klima an der Universität
• Psychische Belastung
• Qualität von Studium und Lehre
• Außeruniversitäre Gründe
Innerhalb der Fakultät gab es aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Stu-
diengänge mehr oder weniger starke Ausprägung dieser Bereiche.
In allen Diskussionen wurde betont, wie wichtig der Kontakt zu anderen Studierenden ist.
Dieser wird durch Gruppenarbeit gefördert, was insbesondere im Studiengang Technischer
Umweltschutz geschätzt wurde. Hier stehen eigene Arbeitsräume für Studierende zur Verfü-
gung. Der Kontakt zu den Lehrenden wurde unterschiedlich bewertet, die Professorinnen
und Professoren überwiegend als schwer erreichbar eingeschätzt und wenig aufgeschlossen
gegenüber Verbesserungsvorschlägen.
Die psychische Belastung war für die Studierenden aller Studiengänge hoch. Hier wurde dieAbschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 21 Unklarheit im Bezug auf die Eignung zum Studienfach und den eigenen Wissensstand ge- nannt. Letzterer wurde zumindest im Grundstudium erst viel zu spät über die Klausurergeb- nisse deutlich; hier fehlte den Studierenden Feedback. Die Studierenden fühlten sich zu Beginn des Studiums zeitlich und teilweise auch inhaltlich überfordert. Gerade die Mathematik stellte besonders hohe, den Studierenden unerklärliche Anforderungen, wodurch sie Prüfungsangst spürten und die Klausuren in hohem Maße nicht bestanden oder aber verschoben haben. Dadurch gab es Verzögerungen im Studienverlauf. Auch war für die Mathematik-Module erheblicher Zeitaufwand erforderlich, so dass den Stu- dierenden kaum noch Zeit für die anderen Module oder gar für außeruniversitäre Aktivitäten blieb. In einigen Studiengängen fühlten sich die Studierenden durch Äußerungen der Hochschul- lehrer demotiviert; so wurden beispielsweise hohe Abbruchquoten oder Durchfallquoten ein- zelner Module bekannt gegeben. Auch fehlten persönliche Erfolgsleistungen. Der Bereich Qualität der Lehre wurde besonders ausführlich diskutiert. Hierunter wurde auch die Ausstattung gefasst. Die Infrastruktur galt allgemein als unzureichend, Arbeitsräume oder die Möglichkeiten zu kopieren, waren wenig oder gar nicht vorhanden. Studierende lernten auf den Fluren der Gebäude. Auch die Zahl der Computerarbeitsplätze reichte nicht aus. Allgemein wurde der Zustand der Uni, speziell der Räume oder Toiletten, als dreckig be- zeichnet. Die Räume waren häufig für die entsprechende Lehrveranstaltung viel zu klein, so dass Studierende stehen mussten, oder aber viel zu groß. Die Zahl der Praktikumsplätze insbesondere in den Studiengängen Biotechnologie und Le- bensmitteltechnologie reichte nicht aus, so dass dies zu unfreiwilligen Studienzeitverlänge- rungen führte. Auch war die Planung von Zeiten und Erhalt eines Platzes unzuverlässig. Durch die hohe Zahl unbesetzter Professuren konnten die Studierenden nicht das komplette Lehrangebot belegen oder vertiefen, was zum Wechsel an andere Universitäten führte. Zu den Studieninhalten wurde kritisiert, dass das Studium zu Beginn sehr „trocken“ war, der Praxisbezug fehlte und die fachlichen Anforderungen nicht passten. So reichten beispiels- weise in Physik die Inhalte als Grundlage für das spätere Studium nicht aus, wohingegen in Mathematik die Anforderungen zu hoch waren und gar nicht alle Inhalte hinterher wirklich gebraucht wurden. Zudem waren die Übungsaufgaben in Mathematik viel zu theoretisch, während fachbezogene Aufgaben noch mehr Zeit erforderten. Es gab Überschneidungen von Praktika und Vorlesungen mit dem Projekt PIW Anfang Ja- nuar, außerdem in den Semesterferien zwischen Klausuren und dem Chemie-Praktikum. Auch lagen die Klausuren zu dicht hintereinander. Die verschiedenen Internet-Konten stifteten Verwirrung und sorgten für Fehler bei der An- und Abmeldung zu Prüfungen.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 22 Die genannten Aspekte sind zum einen persönlich subjektive Faktoren - wie die fehlende Studienmotivation oder die falsche Studienfachentscheidung - zum anderen zeichnen sich hier deutlich objektive Gründe ab, die Organisation und Hochschulbedingungen umfassen. Auch bei dieser Kategoriebildung muss schon an dieser Stelle klar sein, dass sie nicht völlig voneinander zu trennen sind. So kann fehlende Motivation durchaus aus mangelnden uni- versitären Bedingungen resultieren.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 23
3.3 Fragebogen zum Studienabbruch
3.3.1 Grundlage und Durchführung
Das Datenmaterial der Gruppendiskussion sollte neben den theoretischen Vorannahmen die
Grundlage für die Konstruktion eines Fragebogens sein. Die Erkenntnisse aus der Gruppen-
diskussion konnten genutzt werden, um den Fragebogen zielgerichteter zu formulieren. Aus
der Auswertung der Diskussion wurden deduktiv Fragen und Gründe abgeleitet, um quanti-
tativ Studienabbruchmotive zu erheben. Weiterhin wurden für die Fragebogenerstellung das
Referat für Lehre und Studium einschließlich der studentischen Studienfachberatungen und
die Diplom-Soziologin Dagmar Richter zu Rate gezogen.
Die Motive und Ursachen, die zu einem Studienabbruch führen können, wurden zunächst in
universitäre und außeruniversitäre Gründe getrennt. Diese Trennung erschien aufgrund des
Ziels, die Studiensituation für kommende Studierende besser zu gestalten, sinnvoll.
Anzumerken bleibt auch hier, dass Motive und Ursachen aufgrund von Wechselwirkungen
nicht unabhängig voneinander diskutiert werden können.
Die Problemlagen sind praktisch nicht von einander zu trennen und stellten in diesem Fall
nur eine analytische Unterscheidung dar. Ein abgrenzbares Motiv, das unweigerlich zu
einem Studienabbruch führt, war nicht identifizierbar. Das Phänomen Studienabbruch resul-
tiert aus einer Verkettung von verschieden Problemlagen, die den Austritt aus der Hoch-
schule zur Folge haben können.
Im Fragebogen wurden folgende Variablen abgefragt:
Inneruniversitäre Gründe:
• Fragen zu Leistungsdefiziten
• Fragen zur Studienbedingungen (Lehre und Lehrende)
• Fragen zu Studienbedingungen (Ausstattung und Organisation)
• Fragen zur sozialen Integration
Außeruniversitäre Gründe:
• Demographische Variablen
• Fragen zu persönlichen und familiären Problemen
• Fragen zur Erwerbstätigkeit
• Fragen bzgl. eines Interessenwechsels (Beruf, Studiengangwechsel)
• Fragen zur Information im Vorfeld
Die Ergebnisse des Fragebogens sollten auch unter Berücksichtigung gendertheoretischer
Erkenntnisse analysiert werden. Dies ist in technischen Fächern von besonderer Bedeutung,
da der Frauenanteil in diesen Studiengängen geringer ist.Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 24 Allgemeines zur Studie Im Januar 2009 wurden 755 ehemalige Studierende der Fakultät III angeschrieben, die sich im Zeitraum WiSe 06/07 bis WiSe 08/09 nicht mehr rückgemeldet hatten bzw. exmatrikuliert wurden und die sich zu diesem Zeitpunkt im Fachsemester 1 bis 7 befanden. Davon waren 317 Frauen und 438 Männer. Die Studienfachwechsler wurden vorher ausgefiltert. Die ange- schriebenen Personen wurden über das Projekt informiert und gebeten, den Fragebogen in- nerhalb von drei Wochen postalisch oder via Internet ausgefüllt zurückzusenden. Von den versendeten Briefen sind 206 Briefe zurückgekommen, da „Empfänger unbekannt verzogen“. 39 Personen haben geantwortet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Rücklaufquote von 7%. Auffallend sind zwei Werte der Studie. Zum einen antworteten deutlich mehr Frauen als Männer, obwohl mehr Männer angeschrieben wurden, zum anderen kam der Großteil der Antworten aus dem Studiengang Lebensmitteltechnologie. Beide Werte stehen in keiner Relation zu den tatsächlichen Abbruchstatistiken. 3.3.2 Ergebnisse der Analyse des Fragebogens Das Phänomen Studienabbruch zeichnet sich durch seine Komplexität und Vielschichtigkeit aus. Studierende, die sich entscheiden, ihr Studienfach aufzugeben, tun dies nicht aus einem einzigen abgrenzbaren Grund; vielmehr ist der Studienabbruch als ein Prozess zu be- greifen, bei dem im Laufe der Zeit verschiedene Motive zusammenlaufen, die den letztendli- chen Entschluss zum Studienaustritt bedingen. Im Folgenden werden zehn Motive dargestellt, die zum Studienabbruch beitragen können. Diese Motive bedingen sich wechselseitig und wirken aufeinander. 3.3.2.1 Soziale Integration Das Motiv der fehlenden sozialen Integration wird in vielen Studien als wichtige Ursache für einen Studienaustritt benannt. Je schwächer die soziale Integration ist, desto höher das Ab- bruchrisiko. Soziale Integration bezeichnet Variablen der persönlichen Anerkennung durch Dozenten und Kommilitonen, Bestätigung des eigenen Leistungsvermögens von Kommilito- nen und Dozenten sowie freundschaftliche Kontakte zu Kommilitonen. Der Grad der sozialen Integration wurde durch den Variablenkomplex 14 abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass 78% der Befragten angaben, gute Kontakte zu ihren Kommilitonen gepflegt zu haben. Weitere 48% stimmten der Aussage zu, oft mit ihren Kommilitonen ge- lernt zu haben. Diese positiven Ergebnisse sind auf die vor allem im ersten und zweiten Se- mester häufig durchzuführenden Gruppenarbeiten, beispielsweise bei der Bearbeitung von Hausaufgaben, zurückzuführen. 30% der untersuchten Studienabbrecher würden sich eher als Außenseiter beschreiben, und 15% stimmten der Aussage zu, dass sie keine Kontakte zu Kommilitonen finden konnten.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 25
Die Variable „Ich konnte keine Kontakte zu Kommilitonen finden“ impliziert damit auch den
gescheiterten Versuch zur Kontaktaufnahme.
Abbildung 13: Soziale Kontakte im Studium
Besonders Studierende, die über wenig soziale Kontakte innerhalb der Hochschule verfügen,
scheitern eher an Problemen, seien sie fachlicher oder organisatorischer Art. Gute Kontakte
zu Kommiliton/inn/en können helfen, Probleme zu bewältigen, da diese sich oft mit gleichen
Problemlagen konfrontiert sehen. 66,6% Studierende, die angaben, wenig Kontakt zu Kom-
militon/inn/en zu haben, hatten Probleme bei der Bewältigung der Studienorganisation. Auf
gut integrierte Studierende traf dies nur mit ca. 16% zu. Bei den fachlichen Aspekten blieb
dieses Verhältnis erhalten. Studierende, die schlechter sozial integriert waren, hatten grö-
ßere fachliche Probleme, wohingegen ihre stärker integrierten Kommiliton/inn/en Anforde-
rungen besser bewältigen konnten.
Abbildung 14: Probleme im Studium (organisatorisch und fachlich) nach sozialer Integration
(Werte 1 und 2 auf vierstufiger Skala; 1=trifft vollkommen zu 2=trifft eher zu)
Soziale Integration Gute soziale Wenig soziale
Kontakte Kontakte innerhalb
innerhalb der Uni der Uni
Vermehrte Prüfungsmisserfolge 48% 83,3%
Studienalltag zu anstrengend 10% 17%
Unübersichtliche Studienorganisation 20% 50%
Leistungsdefizite 37,7% 83,3%
Ungenügende Vermittlung des Lehrstoffs 54,4% 83,3%
Zu hohe fachliche Anforderungen 28% 100%
Unklare Leistungsanforderungen bzgl. der Prüfungen 49% 66,6
Probleme bei selbstständiger Organisation des Studiums 16% 66,6
Probleme bei selbstständiger Erarbeitung des Lehrstoffs 16% 50%Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 26 3.3.2.2 Leistungsdefizite Die Studiengänge der Fakultät III sind sehr leistungsintensiv und stellen sowohl hohe fachli- che als auch organisatorische Anforderungen an die Studierenden. Das Motiv Leistungsdefi- zite sollte an dieser Stelle nur fachliche Schwächen behandeln. 40% der Befragten gaben an, dass vermehrte Prüfungsmisserfolge zum Studienaustritt bei- getragen haben. 7% der Befragten hatten Prüfungen endgültig nicht bestanden und 37% ge- ben an, dass die fachlichen Anforderungen für sie zu hoch waren. Zur besseren Aufschlüsselung der fachlichen Problemlagen wurden im Fragebogen die Grundlagenfächer Mathe, Chemie und Physik hinlänglich der persönlichen Schwierigkeiten mit diesen auf einer Skala von eins bis sechs abgefragt. Wie schon aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion ersichtlich, gaben viele Befragte an, Schwierigkeiten im Fach Mathema- tik gehabt zu haben. Keiner der Befragten gab an, in diesem Fach keinerlei Probleme zu ha- ben, wohingegen neun von 38 Befragten anführten, auf große Schwierigkeiten fachlicher Art gestoßen zu sein. Auch Physik bereitete größere Schwierigkeiten, während das Grundla- genfach Chemie besser zu bewältigen schien. Die Ergebnisse unterstreichen die in der Gruppendiskussion angemerkte Kritik über zu hohe Leistungsanforderungen und übermäßigen Lern- und Prüfungsstoff, der kaum mehr fachspe- zifischen Bezug findet. Leistungsbedingte Überforderung kann aber auch ein Indiz für eine unzureichende schuli- sche Vorbildung in den Naturwissenschaften sein. 23% der Befragten gaben allerdings an, dass die falsche Einschätzung des eigenen Wissens als Ursache für den Studienabbruch beigetragen hat, obwohl eine durchschnittlich gute Abiturnote erworben wurde. Fehlende Computerkenntnisse, wenig Erfahrung im Umgang mit Technik, mangelnde engli- sche sowie mangelnde deutsche Sprachkenntnisse bereiteten kaum Schwierigkeiten bei den Befragten. 3.3.2.3 Überforderung Überforderungserfahrungen an der Hochschule resultieren nicht nur aus den hohen fachli- chen Anforderungen. Das System Hochschule verlangt in hohem Maße Selbstständigkeit in Studienorganisation und der Erarbeitung von Lehrstoff. 27% der Befragten gaben an, sich während des Studiums überfordert gefühlt zu haben. Überforderungsgefühle traten an dieser Stelle vor allen Dingen bei jungen Studierenden auf, die sich zum ersten Mal an einer Hoch- schule zurechtfinden mussten. Sie sahen sich mit einer großen Stoffmenge konfrontiert, und es fehlte an Strategien, diese bewältigen zu können. Überforderungen resultieren aber nicht nur aus mangelndem Organisationstalent, sondern sind auch oft auf institutioneller Ebene, wie Unübersichtlichkeit beim Studienverlaufsplan,
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 27
schlechte Betreuungsangebote oder unklaren Leistungsanforderungen, zu finden.
Abbildung 15: Überforderungen, unübersichtliche Studienorganisation
trifft überhaupt nicht zu/trifft eher 62,1%
zu wenig Erholungsphasen nicht zu
trifft eher zu/trifft vollkommen zu 37,9%
trifft überhaupt nicht zu/trifft eher 31,2%
schlechte Informationslage auf TU-Homepage nicht zu
trifft eher zu/trifft vollkommen zu 68,8%
trifft überhaupt nicht zu/trifft eher 44,1%
Unklare Leistungsanforderungen bzgl. der nicht zu
Prüfungen
trifft eher zu/trifft vollkommen zu 55,9%
trifft überhaupt nicht zu/trifft eher 59,4%
Studienalltag zu anstrengend nicht zu
trifft eher zu/trifft vollkommen zu 40,6
Überforderungsgefühle können auch dann auftreten, wenn außeruniversitäre Tätigkeitsfelder
wie Erwerbsarbeit oder Kindererziehung mit den universitären Anforderungen kollidieren. Bei
den Teilnehmer/innen der Gruppendiskussion herrschte Einigkeit darüber, dass die Anforde-
rungen der jeweiligen Studienfächer kaum mehr Zeit für außeruniversitäre Tätigkeiten ließen.
Die Evaluation durch den Fragebogen konnte dies bestätigen. Alle außeruniversitären Tätig-
keiten, die abgefragt wurden, mussten mäßig bis stark eingeschränkt werden.
3.3.2.4 Erwerbstätigkeit
Erwerbstätigkeit ist ein wichtiges Mittel zur Studienfinanzierung. 70% der Befragten gaben
an, ständig oder zeitweise erwerbstätig gewesen zu sein. Erreicht die Erwerbstätigkeit ein
Ausmaß, an dem es zu groben Differenzen in der Vereinbarkeit von Studienanforderungen
und der Beschäftigung kommt, resultieren Überforderungsgefühle und damit auch Motivati-
onsverlust und Leistungsdefizite.
Abbildung 16: Probleme im Studium (organisatorisch und fachlich) nach Erwerbstätigkeit
(Werte 1 und 2 auf vierstufiger Skala; 1=trifft vollkommen zu, 2=trifft eher zu)
Studienprobleme Erwerbstätigkeit
ständig oder zeitweise nicht erwerbstätig
erwerbstätig
zu wenig Erholungsphasen 28,6% 7,1%
Prüfungsangst 23,8% 0%
Studienalltag zu anstrengend 19,1% 0%
Gefühl der zeitlichen Überforderung 40% 23,1%Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 28 3.3.2.5 Falsche Studienfachentscheidung Ein erfolgreiches Studium bedarf einer ausreichenden Fachidentifikation. Ist diese nicht ge- geben, sinkt auch die Motivation zum Absolvieren des Studiums. Fehlende Fachidentifikation resultiert in den meisten Fällen aus einer unzureichenden Information über das zu studie- rende Fach im Vorfeld des Studiums. Auch ein Übermaß an extrinsischen Gründen für eine Studienfachwahl kann zu einem schnellen Motivationsverlust führen. Junge Studienanfän- ger/innen entscheiden sich häufig nicht anhand ihrer fachlichen Begabung, sondern lassen sich von äußeren Faktoren wie guter Karriere und Berufsaussichten leiten. Weiterhin führen hohe NCs häufig zur Wahl des Ausweichstudiums, wenn das eigentlich favorisierte Studium nicht studiert werden konnte. Für die Fakultät III trifft das auf den Studiengang „Lebensmit- telchemie“ zu. Der NC liegt hier bei 2,1. Die Annahme, dass Studierende ein anderes Stu- dienfach beginnen, in der Hoffnung, später in das eigentlich gewünschte wechseln zu kön- nen, wurde in der offenen Frage bestätigt. 52% der Befragten begannen ihr Studium mit Zweifeln an ihrer Studienfachentscheidung. Die Zweifel an der Studienfachwahl entstanden zum einen aus persönlichen Defiziten bei der Informationsbeschaffung, zum anderen führten ungenügende Informationsangebote der Hochschule dazu, dass potenzielle Studierende nicht in Lage waren, den nötigen Einblick in die Studienfächer zu erlangen. Die Studienfachbeschreibung bot einen groben Überblick bzgl. Verlauf, Anforderungen und Ziele des Studienfachs, konnte jedoch keine detaillierten Einblicke in das Studium bieten. Viele Studierende wünschten sich daher mehr Transparenz im Vorfeld des Studiums. 11% wünschten sich Einstiegskurse, 24% ein Orientierungsstu- dium. Die Vorbereitungskurse, die vor Semesterbeginn angeboten wurden, waren 51% der Studie- renden nicht bekannt. Weitere 49% der Befragten gaben an, dass die Einführungswoche nicht hilfreich für ihr Studium war. Die geschaffenen Orientierungsmaßnahmen wie eine Einführungswoche und Vorbereitungskurse müssen verbessert werden und einfach zugäng- lich sein. Beeinträchtigte Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung wurden von den Be- fragten bestätigt, indem 51% der TU-Homepage schlecht aufbereitete Informationen be- scheinigten. Die Universität sollte über die spezifische Darstellung des Studienfachs auch nicht verges- sen, über die grundsätzlichen Anforderungen und spezifische Ausbildungsform durch die Hochschule zu informieren. 37% der Studierenden gaben als wichtigen Grund für den Stu- dienabbruch den Wunsch nach einer anderen Ausbildungsart an.
Abschlussbericht zum OWL-Projekt Studienabbruch 29
Abbildung 17: Zweifel vor Beginn des Studiums an Studienfachwahl nach Zustimmung zu den Studienabbruchfaktoren
(Werte 3+4 auf vierstufiger Skala 1=trifft überhaupt nicht zu 4=trifft vollkommen zu)
Studienabbruchfaktoren Sicherheit bzgl. Studienfachwahl
Ich hatte an meiner Ich wusste genau, was
Wahl Zweifel ich studieren wollte
Unsicherheit bzgl. der grundsätzlichen 23,5% 6,7%
Entscheidung für ein Studium
Anwachsende Distanz zum Studienfach 41,1% 46,6%
Falsche Einschätzung des eigenen Wissens 23,5% 33%
Berufliche Neuorientierung 64,7% 46,6%
Unsicherheit bzgl. der beruflichen Eignung 25% 6,7%
Wunsch nach anderem Studienfach 76,4% 46,7%
Wunsch nach anderer Ausbildungsart 41,2% 28,5%
3.3.2.6 Interessenwechsel
Das Motiv Interessenwechsel kann den Studienabbruch maßgeblich bestimmen. Dabei ist
dies nicht auf fehlende Kenntnisse im Vorfeld des Studiums zurückzuführen. Ein Interessen-
wechsel fachlicher oder in Art der Ausbildung stellt sich erst im Laufe des Studiums ein.
20% gaben als Motiv für einen Studienabbruch den Wunsch nach einer praktischen Tätigkeit
an, 20% hatten Zweifel an der grundsätzlichen Entscheidung für ein Studium. Diese Gruppe
empfand die Ausbildungsart durch die Universität als für sie ungeeignet.
Bei den meisten Studienabbrecher/inne/n in der Studie (60%) kam es allerdings zu einer be-
ruflichen Neuorientierung. Diese Gruppe verbleibt in dem System Hochschule, hat aber das
fachliche Interesse gewechselt.
3.3.2.7 Ausstattung an der Universität
Die Kritik zur Ausstattung der Fakultät III der Technischen Universität Berlin fiel, verglichen
mit der harschen Kritik an Lehrenden, Lehre und Organisation, vergleichsweise gut aus. Die
Ausstattung der Labore wurde von 80% der Befragten positiv bewertet. Auch die generelle
technische Ausstattung an der TU hatte kaum Einfluss auf den Studienabbruch. Beanstandet
wurden in diesem Zusammenhang vor allem fehlenden Räume zur Aufbereitung des Lehr-
stoffs sowie fehlende Pausen- und Aufenthaltsräume. Hier gibt es großes Verbesserungs-
potenzial. Räume zum Aufbereiten des Lehrstoffs führten nicht nur zur Leistungsverbesse-
rung, sondern trugen auch zu einer angenehmeren Studienatmosphäre bei, die - wie in
Punkt 5.4 gezeigt - sehr wichtig für ein erfolgreiches Studium ist. Öffentliche Räume beför-
derten den Kontakt der Studierenden untereinander, was indirekt dazu beitrug, Studienpro-Sie können auch lesen