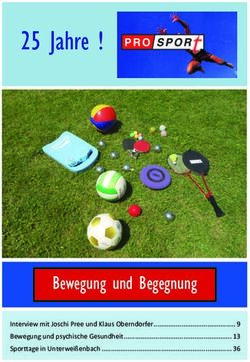Neubau Perimeter B Einstufiger Studienauftrag im selektiven Verfahren - Universitätsspital Basel
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhaltsverzeichnis
Vorworte
Spital der Zukunft 3
Städtebau und Nutzung im Einklang 4
Informationen zum Verfahren
Ausgangslage 6
Zielsetzung 7
Verfahren und Grundlagen 8
Beurteilungsgremium 9
Aufgabe
Aufgabenstellung 10
Rahmenbedingungen 11
Studienauftrag 16
Beurteilung
Beurteilung 17
Jurierung 18
Empfehlung und Weiterbearbeitung 19
Genehmigung
Genehmigung Beurteilungsgremium 20
Projektteil
Antrag zur Weiterbearbeitung 24
Nicht prämierte Beiträge 34
1Das Spital der Zukunft bauen
Das Universitätsspital Basel steht vor der grossen Aufgabe,
die Weichen für eine hochwertige und moderne Gesundheits
versorgung der Zukunft zu stellen. Dies betrifft uns alle:
egal, ob als Bürgerinnen und Bürger, als Patientinnen und Pati-
enten oder als Mitarbeitende. Dem Entwicklungsfeld Perimeter
B kommt darin eine besondere Rolle zu. Es freut uns, im vor
liegenden Jurybericht die hochstehenden Lösungsvorschläge
und insbesondere das Siegerprojekt der Planergemeinschaft
Herzog de Meuron / Rapp Architekten zu präsentieren.
Der «Masterplan Campus Gesundheit» dient dem Ich danke den sieben Teams für die hervorragenden,
Universitätsspital Basel als langfristig ausgerich- ideenreichen Lösungsansätze und für die sorgfältige
tetes Planungsinstrument. Ergänzend zum bereits Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen Auf
beschlossenen und notwendigen Ersatzbau des gabe. Die Jury war beeindruckt vom hohen Niveau
Klinikums 2 auf dem Perimeter A, kommt darin dem der eingereichten Arbeiten und vom Engagement
Perimeter B eine Rolle mit viel Entwicklungspoten- der Büros.
zial zu. Der im Februar 2018 öffentlich ausgeschrie-
bene Studienauftrag soll die mögliche Bebauung Mit dem nun einstimmig auserkorenen, siegreichen
entlang der Schanzenstrasse und der Klingelberg- Lösungsvorschlag der Planergemeinschaft Herzog
strasse als Teil des Perimeters B festlegen. Ziel war de Meuron und Rapp Architekten erreichen wir
es, im Rahmen der hochkomplexen Ausgangslage einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum Basler
raumplanerische und städtebaulich attraktive und Campus Gesundheit. Das Projekt zeigt gekonnt auf,
überzeugende Lösungsvorschläge zu evaluieren, die wie das Entwicklungspotenzial für das Universitäts-
gleichzeitig höchstmögliche betriebliche Effizienz spital und den Forschungs- und Medizinplatz Basel
garantieren. am bestehenden zentralen Standort optimal genutzt
werden können. Dem ausgewählten Planerteam
Für unsere Patientinnen und Patienten, Mitarbeiten- gratulieren wir herzlich zu seinem Erfolg.
den und die ganze Region Basel planen wir bereits
heute das Spital von morgen. Mit den anstehenden
Infrastrukturprojekten schaffen wir Raum für qua
litativ hochstehende Dienstleistungen und schaffen
ideale Voraussetzungen für eine langfristige Siche-
rung der regionalen und überregionalen medizini-
Dr. Werner Kübler
schen Versorgung.
Spitaldirektor
Mit dem Neubau im Perimeter B machen wir einen
nächsten Schritt in dieser herausfordernden Aufga-
be. Dieser Neubau kann zunächst auch notwendige
Rochadeflächen für den Neubau des Klinikums 2
schaffen. Die Rochadeflächen mit anpassbaren
Strukturen sollen dazu dienen, bei weiteren Bau-
und Sanierungsphasen flexibel zu sein und pro
duktive Prozesse sicherzustellen. Wie Vorstudien
gezeigt haben, ist ein Neubau nachhaltiger und
kostengünstiger als Provisorien, die wieder abge-
baut werden müssen.
3Städtebau und Nutzung im Einklang Architektur und Städtebau sind Disziplinen des Kollektivs. Das gilt umso mehr, wenn es sich um eine komplexe Aufgabenstel- lung handelt wie im vorliegenden Fall, der Konzeption eines neu- en Klinikgebäudes innerhalb eines bedeutungsvollen historischen Umfelds. Gelingt die Zusammenführung der unterschiedlichen Kompetenzen in ein von gegenseitigem Respekt getragenes Zu- sammenspiel, so kann etwas Überraschendes entstehen. Mit dem Masterplan Campus Gesundheit und dem Das Beurteilungsgremium ist sich bewusst, dass die rechtskräftigen Bebauungsplan 215 liegen die vorgegebenen Rahmenbedingungen der Aufgaben- Grundlagen für eine langfristige räumliche Weiter- stellung äusserst anspruchsvoll sind. Umso erfreuli- entwicklung des Universitätsspitals Basel bereits seit cher ist der Verlauf des Verfahrens und erst recht das geraumer Zeit vor. Während über die Entwicklung im Resultat zu werten. Es erfüllt uns mit grosser Freude, Perimeter A mit dem Neubau des Klinikums 2 be- dass wir nach sorgfältiger Abwägung ein Siegerteam reits Gewissheit darüber herrscht, wie sich das Areal auswählen konnten, dass die komplexen Anforde- am Petersgraben baulich entwickeln wird, waren rungen profund erforscht, daraus konzeptionell die im Perimeter B Entwicklungsfeld Klingelbergstras- richtigen Annahmen getroffen und einen Entwurf se / Schanzenstrasse die Konkretisierung der städte- präsentiert hat, der das Beurteilungsgremium auf baulichen Festlegungen über das vorliegende Vari- mehreren Ebenen zu begeistern vermag. Stellvertre- anzverfahren zu bestimmen. Dabei gab es eine Reihe tend sei hier auf die Fassadengestaltung zum Garten von Anforderungen zu berücksichtigen. Neben den verwiesen, die mit den auskragenden Balkonen und vielschichtigen Abläufen und funktionalen Aspekten den heiteren Stoffmarkisen auf die heutigen Schwes- eines Spitals und den offensichtlichen Bedürfnissen terhäuser verweist und gleichzeitig das atmosphä- der Patientinnen und Patienten waren dies auch Fra- risch dichte Bild eines zeitgenössischen Spitalbaus gen der etappenweisen Erneuerung unter laufendem evoziert. Das Beurteilungsgremium ist vollkommen Spitalbetrieb und selbstredend die Berücksichtigung überzeugt, dass mit dem auserkorenen Projekt von von Investitions- und Betriebskosten. Von zentraler Herzog de Meuron und Rapp Architekten die Grund- Bedeutung und als doppelte Herausforderung für lage für einen weiteren identitätsstiftenden Bau- die Teams hat sich der gebaute Kontext inner- und stein des Campus Gesundheit geschaffen wird. Ein ausserhalb des Areals erwiesen. Doppelt in dem Spitalgebäude, das die Gesamtkonzeption intelligent Sinne als dass es aufzuzeigen galt, wie die optimale weiterschreibt. funktionale Anbindung an die Bestandsgebäude des Areals in jeder Phase der Umsetzung gewährleistet wird und wie die beiden Baudenkmäler Holsteinerhof und Klinikum 1 in ihrem bauhistorischen Wert nicht geschmälert werden. 4
Der einstufige Studienauftrag im selektiven Verfahren Allen Beteiligten gebührt grosser Dank; dem Team
hat sich für die vorliegende Aufgabenstellung als der Verfahrensbegleitung, den stark involvierten
geeignetes Instrument zur Ermittlung des bestmög- internen und externen Experten, dem hochprofessi-
lichen Projektentwurfs erwiesen. Es hat sich bereits onellen Beurteilungsgremium und in erster Linie den
in der ersten Zwischenbesprechung gezeigt, dass teilnehmenden Planerteams. Letztere haben mit ihren
die Grundannahmen des gültigen Bebauungsplans unterschiedlichen Lösungsansätzen und den ambitiö-
aufgrund des sehr hohen Nutzungsdrucks mit einer sen Vorschlägen das Beurteilungsgremium gefordert
qualitativ hochwertigen städtebaulichen Setzung und und die profunde Diskussion erst ermöglicht. Exem-
einem im Gesamtensemble verträglichen Gebäude- plarisch haben sie gezeigt, dass Architektur nicht auf
volumen nicht vereinbar waren. In der Folge konnte sich allein gestellt, sondern auf die Mitwirkung aller
das Beurteilungsgremium in allseitigem Einverständ- angewiesen ist. Als Disziplin des produktiven Ensem-
nis die Rahmenbedingungen nachjustieren. Dieser blespiels kann in der Gemengelage Architekten, Bau-
allseits offene Dialog innerhalb des Beurteilungsgre- herr, Nutzende, Betreiber und Beurteilungsgremium
miums war von unschätzbarem Wert. Er hat wesent- tatsächlich Hervorragendes geschaffen werden!
lich zum hervorragenden Ergebnis dieses komplexen
Verfahrens beigetragen.
Beat Aeberhard, Architekt ETH / SIA
Kantonsbaumeister Basel-Stadt
5Ausgangslage
Am Life-Sciences-Standort Basel spielt das Univer Mit dem Masterplan Campus Gesundheit wurde
sitätsspital Basel eine zentrale Rolle. Es erbringt das ganze Areal unter einem langfristigen Horizont
Leistungen in der Gesundheitsversorgung ebenso betrachtet, und zur Konkretisierung der städtebauli-
wie in der klinischen Lehre und Forschung, auch chen Festlegungen wurden zwei Perimeter definiert.
über die Kantonsgrenzen hinaus mit Vernetzung und Im Perimeter A (Baufeld Petersgraben) basieren die
Kooperationen. Das Universitätsspital Basel muss städtebaulichen Aussagen direkt auf dem Sieger
und will sich zukunftsorientiert weiterentwickeln und projekt des Projektwettbewerbs Neubau Klinikum 2,
damit seine zentrale Stellung im regionalen und von giuliani.hönger Architekten.
überregionalen Versorgungsnetzwerk langfristig
Mit dem vorliegenden Studienauftrag wurde ein
sichern.
Neubaukonzept entlang der Schanzen- und Klingel-
Die Weiterentwicklung betrifft auch die Immobili- bergstrasse als Teil des Perimeters B gesucht.
eninfrastruktur. Bei verschiedenen Bauten auf dem
Mit dem Neubau im Perimeter B soll das Universi-
Areal des Universitätsspitals Basel besteht grosser
tätsspital Basel ideale Voraussetzungen erhalten, um
Handlungsbedarf, unter anderem aufgrund von
die anstehenden Erneuerungen und Erweiterungen
Flächendefiziten, veralteter Infrastruktur und nicht
zukunftsweisend umzusetzen, als Teil der Planung
mehr einzuhaltender Standards.
im Gesamtareal und unter Berücksichtigung von
Spitalbetrieb, Flexibilität, Effizienz, Städtebau und
Wirtschaftlichkeit.
6Zielsetzung
Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung eines • einen konsistenten Baustein des Campus Gesund-
Studienauftrags wurde ein kompetentes und heit bildet;
eingespieltes Generalplanerteam gesucht, welches • gestalterisch und städtebaulich überzeugt und den
bezüglich seiner Erfahrungen und Ressourcen gebauten und geplanten Kontext inner- und ausser-
qualifiziert ist, den sowohl technisch, funktional wie halb des Areals angemessen berücksichtigt;
gestalterisch anspruchsvollen Neubau im Perimeter • eine betrieblich sinnvolle Anordnung der verschie-
B in hoher Qualität zu planen und zu realisieren. denen Nutzungen während jeder Umsetzungspha-
se erreicht;
Ziel war es, die unterschiedlichen Anforderungen an
• flexibel unter Berücksichtigung des gesamten
Architektur, Städtebau oder Aussenräume mit Anfor-
Lebenszyklus geplant ist;
derungen aus Nutzung, Flexibilität, und Kosteneffizi-
• eine rationelle Anordnung und patientenfreundliche
enz in einer Projektstudie nach SIA 143 zu vereinen.
Betriebsabläufe gewährleistet;
Es galt, einen Projektvorschlag zu erarbeiten, der
• eine rasche Realisierung unter Berücksichtigung
einer nachhaltigen Investition ermöglicht;
• einen angemessenen Umgang mit den Aussenräu-
men findet und
• eine energetisch optimierte Gesamtlösung und
eine energiesparende und ökologische Bauweise
garantiert.
7Verfahren und Grundlagen
Auftraggeberin Teilnahmeberechtigung
Die Auftraggeberin dieses Verfahrens ist die Die Teilnehmenden mussten über einen Wohn- oder
Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertrags-
Healthcare Infra AG
staat des GATT / WTO-Übereinkommens über das
c/o Universitätsspital Basel
öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat
Hebelstrasse 32
Gegenrecht gewährt, verfügen. Der Stichtag für den
4031 Basel
Nachweis des Domizils war der Publikationstermin.
vertreten durch das Universitätsspital Basel.
Teambildung
Verfahren Für die Zulassung zum Studienauftrag mussten sich
Das Verfahren war ein selektiver, einstufiger, nicht Projektteams bilden, die im Auftragsfall die vollstän-
anonymer Studienauftrag mit fünf bis maximal sie- digen Grundleistungen über die Phasen 3 bis 5 nach
ben Generalplanerteams. Es fand ein Startkolloquium SIA 112-Modell Bauplanung abdecken können.
mit Begehung, zwei Zwischenbesprechungen sowie
einer Schlusspräsentation statt. Es wurden zum und Selektion
im Verfahren keine mündlichen Auskünfte erteilt. Das Beurteilungsgremium wählte aufgrund der
eingereichten Präqualifikationsunterlagen sieben Ge-
Der Vertiefungsgrad des Studienauftrages richtete
neralplanerteams zur Teilnahme am Studienauftrag
sich nach dem Informationsbedarf der Auftraggebe-
aus. Es bewertete deren Eignung nach der Qualität
rin im Hinblick auf die zu fällenden Entscheide, unter
ihrer Referenzobjekte, ihrer Erfahrung und Leistungs-
anderem in Bezug auf die funktionalen, gestalteri-
fähigkeit.
schen oder ökonomischen Aspekte des Vorhabens.
Die Auftraggeberin erachtete es als zielführend, auf-
Entschädigung
grund der Komplexität der Aufgabe, einen direkten
Die Teilnahme an der Präqualifikation wurde nicht
Dialog mit den Teams zu ermöglichen.
entschädigt.
Ablauf und Termine Die selektionierten Generalplanerteams erhielten
Phase 1, Präqualifikation je CHF 85’000.– (exkl. MWST) als feste Aufwand
Februar 2018 bis 10. April 2018 entschädigung für die Teilnahme am Studienauftrag.
Unter Vorbehalt, dass die jeweiligen Projekte zur
Phase 2, Studienauftrag Ausgabe Unterlagen
Beurteilung zugelassen wurden.
3. Mai 2018
Startveranstaltung, Modellabgabe Stellungnahme SIA
7. Mai 2018 Die Kommission für Wettbewerbe und Studienauf-
träge hat das Programm geprüft. Es ist konform zur
Zwischenbesprechung 1 Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe
19. Juni 2018 SIA 143, Ausgabe 2009.
Zwischenbesprechung 2
16. August 2018
Abgabe Pläne und Modelle
28. September 2018 und 5. Oktober 2018
Schlussbesprechung
26. Oktober 2018
1. Jurierungstag
30. Oktober 2018
2. Jurierungstag
29. Januar 2019
Bekanntgabe Entscheid
Ende April 2019
Vernissage
8. Mai 2019
Ausstellung
9. bis 17. Mai 2019
8Beurteilungsgremium
Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt der Beratende Experten
Veranstalter folgendes Beurteilungsgremium ein.
Roland Geiser, USB
Raum- und Baukoordination
Fachgremium
Richard Birrer, USB (bis Juli 2018)
Beat Aeberhard (Vorsitz)
Infrastruktur
Architekt ETH / SIA, Kantonsbaumeister BS
Alessandro Cerminara, USB (ab Juli 2018)
Lorenzo Giuliani
Infrastruktur
Architekt ETH / SIA / BSA, Zürich
Dr. Astrid Beiglböck, USB
Fawad Kazi
Tumorzentrum
Architekt ETH / SIA, Zürich
Prof. Katharina Rentsch, USB
Quintus Miller
Labormedizin
Architekt ETH / SIA / BSA, Basel
Juliane Sutter, USB
Stefan Traxler
Betriebsplanung
Architekt BDA, Frankfurt am Main
Massimo Fontana
Anne Marie Wagner
Landschaftsarchitektur
Architektin EPF / SIA / BSA, Basel
Daniel Meyer
Thomas Blanckarts (Ersatz)
Bauingenieurwesen
Architekt ETH / SIA, Basel
Daniel Stadler
Bernhard Gysin (Ersatz, bis Oktober 2018)
Gebäude- & Energietechnik
Architekt ETH / SIA, Basel
Dr. Daniel Schneller, BVD
Sachgremium Denkmalpflege
Robert-Jan Bumbacher, USB Dr. Thomas Lutz, BVD
Präsident des Verwaltungsrats Denkmalpflege
Prof. Albert Urwyler, USB Jürg Degen, BVD
Mitglied des Verwaltungsrats Planungsamt
Dr. Werner Kübler, USB Susanne Brinkforth, BVD
CEO, Spitaldirektor Stadtgärtnerei
Prof. Christoph A. Meier, USB Cornelius Bodmer, Metron
CMO, Ärztlicher Direktor Verfahrensbegleitung
Dr. Serge Reichlin, USB (bis Mai 2018)
Begleitung des Studienauftrags
Leiter Direktionsstab
Das Verfahren wurde extern durch die Metron Archi-
Dr. Henrik Pfahler, USB (Ersatz, ab Oktober 2018) tektur AG begleitet.
Leiter Direktionsstab
Nico Abt, Metron
Irmtraut Gürkan, USB (Ersatz) Verfahrensbegleitung
Vorsitzende VR Immobilien Ausschuss
Daniel Gerber, Metron
Dr. Volker Büche, USB (ab Mai 2018) Bauökonomie
Leiter Strategische Betriebsplanung
Organisation USB
Das Verfahren wurde intern durch die Abteilung
Arealplanung und Bauprojektsteuerung begleitet.
Bernhard Gysin, USB (bis Oktober 2018)
Leiter Arealplanung und Bauprojektsteuerung
Susanne Trombini, USB
Arealplanung und Bauprojektsteuerung
Fernando Imhof, USB (ab Oktober 2018)
Leiter Immobilien
9Aufgabenstellung
Bestandteil der Aufgabe war primär die Entwicklung Raumprogramm
eines städtebaulich und architektonisch vorzüglichen Im Rahmen des Studienauftrags wurde bis zur
Projektes innerhalb des Perimeters B des Bebauungs- Zwischenbesprechung 1 im Sinne eines Prüfauf-
plans 215, welches die Anforderungen an ein zu- trags über die Realisierung der Minimalforderung
kunftsweisendes, flexibles Spitalgebäude in vorbildli- des Soll-Raumprogramms Bebauungsplan BASIS
cher Weise erfüllt. Die Auftraggeberin erwartete von hinaus aufgezeigt, in welcher Art aus Sicht der Pro-
den Ergebnissen die notwendigen Entscheidungs- jektverfasser zusätzliche Flächen (Raumprogramm
grundlagen für die definitiv möglichen Nutzflächen Bebauungsplan PLUS) realisiert werden könnten.
im Bereich Schanzenstrasse / Klingelbergstrasse. Voraussetzung hierfür war eine Überschreitung der
Höhenbegrenzung des Bebauungsplans 215 im
Das Vorhaben stand im Kontext der Gesamtent
Baufeld des Perimeters B.
wicklung auf dem Areal des Universitätsspitals Basel.
Nebst der definitiven Platzierung verschiedener Be-
reiche, wie unter anderem dem Tumorzentrum und
den Räumen der Labormedizin, sind in einer ersten
Phase ab 2025 (im Weiteren als Phase 1 bezeichnet)
Rochadeflächen für die Erneuerung des Klinikums 2
bereitzustellen. Mit der Fertigstellung des Klinikums 2
ab 2030 (Phase 2) können diese Flächen einer defini-
tiven Nutzung zugeführt werden. In der Folge werden
sowohl die in Phase 1 platzierten Bereiche auf ihre
Sollgrösse erweitert als auch zusätzliche Bereiche
neu integriert.
10Rahmenbedingungen
Der Bebauungsplan 215 vom 20. Mai 2015 definiert die städtebaulichen Rahmenbedingungen für die zukünf-
tige Entwicklung des Universitätsspitals Basel in der innerstädtischen Lage an der Schnittstelle zur mittelalter-
lichen Altstadt. Grundlagen bilden die Erkenntnisse aus der Testplanung, dem Masterplan Campus Gesundheit
und dem zweistufigen Projektwettbewerb für die Erneuerung des Klinikums 2.
Der Bebauungsplan definiert zwei Perimeter entsprechend der vorhandenen Planungssicherheit. Im Perimeter
A (Baufeld Petersgraben, Neubau Klinikum 2) basieren die städtebaulichen Aussagen direkt auf dem Projekt
des Wettbewerbs zum Neubau Klinikum 2. Die räumlichen Grenzen der Bebauung sind hier durch Mantellinien
definiert. Im Perimeter B (Entwicklungsfelder Schanzenstrasse / Klingelbergstrasse sowie Hebelstrasse) sind die
städtebaulichen Grundlagen der definierten Entwicklungsfelder jeweils über einen Studienauftrag festzulegen.
Bebauungsplan 215
Im Sinne des Prüfauftrags wurden die Vorgaben zur maximalen Gebäude- und Wandhöhe zu Gunsten einer
effizienteren Ausnutzung des Baufeldes sowie eines grösseren gestalterischen Spielraums geprüft. Im An-
schluss an die Zwischenbesprechung 1 wurden auf Basis der Erkenntnisse die Höhenvorgaben für alle Teams
verbindlich für die weitere Bearbeitung festgeschrieben.
11Perimeter
Der Perimeter für den Neubau entspricht dem Entwicklungsfeld Schanzenstrasse / Klingelbergstrasse. Entlang
der Hebelstrasse muss die Gebäudeflucht überwiegend auf der Parzellengrenze liegen. Die Überbauung darf
im gestrichelten Bereich minimal überschritten werden, sofern dies nicht zu einer qualitativen Beeinträchti-
gung des Spitalgartens führt. Im erweiterten Betrachtungsperimeter sollen die oberirdischen Verbindung zum
Klinikum 1 und die Übergänge zum Garten und zum Holsteinerhof bearbeitet werden. Die Bestandsbauten
Schwesternhaus und Bettenhaus 3 werden zurückgebaut.
Erdgeschoss 1. Untergeschoss 2. Untergeschoss
Perimeter A + B
Entwicklungsfeld (EF)
Schanzen- / Klingelbergstrasse
Cityparking / Hunziker-Kanal
ELT / NEA-Stützpunkt 1
Verbindungsgang MTA
Erschliessung für Anlieferung
ober-/ unterirdisch
City-Park sfahrt
City-Park sfahrt
City-Park sfahrt
Fussgängerverbindung
Fussgängerverbindung
ing
ing
ing
Au
Au
Au
durch Gebäude
Ein- und
Ein- und
Ein- und
orientierender Inhalt
Betrachtungsperimeter
Bestand
denkmalgeschützte Bauten
trasse
trasse
trasse
/ Klingelbergs
/ Klingelbergs
/ Klingelbergs
EF Schanzen-
EF Schanzen-
EF Schanzen-
hrt
hrt
hrt
Ausfa
Ausfa
Ausfa
Ein- arking
Ein- arking
Ein- arking
und
und
und
City-P
City-P
City-P
Quelle: Geodaten Kanton Basel-Stadt
Erdgeschoss und Untergeschosse im Perimeter B
12Bestehende Bauten und Anlagen
Das Siegerprojekt aus dem mehrstufigen Wettbewerbsverfahren Neubau Klinikum 2 orientiert sich zum
Petersgraben hin mit einem Flachbau der weiterhin den Haupteingang und die Zufahrt zum Notfall verortet.
Im Inneren des Areals ist der Hochbau mit den Bettenstationen angeordnet. Dieser bildet mit dem Hauptbau
des Klinikums 1 ein Ensemble um den Spitalgarten.
OP
W
es
t
3)
Kli
nik
(B
um
s3
1(
au
K1
)
nh
tte
Be
OP
H)
Os Pr
s (S
t ed
VE ige
hau
LF rki
rch
e
tern
wes
Kli
Sch
Hol ZLF nik
stei um
n 2(
(HH erhof K2
) )
Ma
rkg
räfl
erh
of (
MG
H)
Bestehende Bauten und Anlagen
13Denkmalgeschützte Bauten
Das Areal des Universitätsspitals Basel liegt an der Schnittstelle zwischen der Altstadt und den Stadterweite-
rungsquartieren des 19. Jahrhunderts, zwischen den historischen Stadtmauern am Petersgraben und der eins-
tigen äusseren Stadtmauer, die seinerzeit entlang der Schanzenstrasse verlief. Auf dem Areal finden sich ver-
schiedene qualitativ hochstehende und wertvolle Bauten. Der Markgräflerhof und der Holsteinerhof stehen wie
das Klinikum 1 unter kantonalem Denkmalschutz und prägen das Gesicht des Spitalareals zusammen mit der
Lage in der Stadt und dem grossen Garten massgebend. Der Markgräflerhof und das Klinikum1 sind zudem im
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) mit dem Erhaltungsziel A aufgeführt.
e
ss
ra
st
en
nz
ha
Sc
Kli
RH
ng
St
elb
EI
.J
N
oh
e rg
an
str
ns
ass
-R
St
he
.J
e
oh
in
we
sse
an
ga
g
ns
ien
Ma
Sp
-V
in
it
or
al
le
st
ss
Kl
st
ad
in
ra
gä
ik
ss
er
t
um
e
ig
1
ed
Pr
To
t en
ta
nz
sse
stra
e rg
Pr
He ed
ige
gelb
be rk
ls irc
tr
as he
K l in
se
Bl
um
en
en
ab
ra
gr
Hol in
rs
st e
te
ine
rho
Pe
He f
bel
str
ass
e
se
tras
Pet ers gas se
e in s
Ma
r kg
önb
räf
ler
Sch
He hof He
bel rb
str er
ass gs
e ga
ss
e
Ber
nou
llis
tras Spi
se ege
lho
f
periMeter denKMalGesChütZt bebaubare FläChe
sChutZabstände
Denkmalgeschützte Gebäude
14Der Holsteinerhof ist ein ehemaliger herrschaftlicher Das bestehende unterirdische Parkhaus City ist von
Wohnsitz bestehend aus einem zweigeschossigen der Schanzenstrasse und Klingelbergstrasse her
Hauptgebäude an der Hebelstrasse, Annexbau und erschlossen und soll auf allen betrieblich möglichen
Gartenanlage. Die Baulichkeiten erhielten ihre baro- Geschossen direkt angebunden sein.
cke Gestalt im Wesentlichen um 1750 und weisen
eine überdurchschnittlich reiche Ausstattung jener Aussen- und Freiräume
Zeit auf. Die einst direkt an die Stadtbefestigung Der Spitalgarten ist Erholungs- und Aufenthaltsraum
grenzende Anlage zählt zu den bedeutendsten Basler für Patienten, Besucher, das Spitalpersonal und
Baudenkmälern des 18. Jahrhunderts und seit 1915 die Öffentlichkeit. Der Baum- und Pflanzenbestand
zu den kantonal geschützten Objekten. wirkt identitätsstiftend. Auch die Durchquerung und
Zugänge der verschiedenen Ebenen waren und sind
Das Klinikum 1 auf der anderen Seite des Perimeters,
wichtiger Bestandteil der Planung im Perimeter B.
das zwischen 1939 –1945 durch die Architektenge-
Insbesondere beim Holsteinerhof ist eine sorgfältige
meinschaft E. und P. Vischer, Hermann Baur sowie
Gestaltung des Grünraums und der Übergänge sowie
Bräuning, Leu, Dürig erbaut wurde, zählt zu den prä-
der vorgelagerten Gartensituation ein wichtiger Be-
genden Spitalbauten aus der Zeit der Moderne. Das
standteil der Aufgabe.
Gebäude wurde zwischen 1995 und 2003 unter Be-
rücksichtigung seiner Qualitäten umfassend saniert.
Nachhaltigkeit
Bei der Weiterentwicklung des Areals des Universi-
Betriebliche Rahmenbedingungen
tätsspitals Basel hat die wirtschaftliche Instandhal-
Grosse Teile des Projektperimeters sind unterirdisch
tung und energiesparende Bauweise einen hohen
unterbaut mit für das Spital essenziellen Infrastruk-
Stellenwert. Auch eine wirtschaftliche, ökologische
turbauten (Materialtransportanlage, Spontantrans-
Energieversorgung sowie eine nachhaltige Planung
portanlage, Energieleittunnel, unterbrechungsfreie
sind eminente Voraussetzungen. Grundlagen dazu
Stromversorgung) und dem Parkhaus City inklusive
bildet die SIA-Empfehlung 112 / 1 für nachhaltiges
dessen Ein- und Ausfahrt. Diese Bauteile sind zwin-
Bauen im Hochbau.
gend baulich, ingenieurmässig, logistisch und in der
Bauetappierung zu berücksichtigen.
Entwicklungen in der Nachbarschaft
Auf der Höhe der nördlichen Ein- und Ausfahrt des
Anbindung Neubau an Bestand
Parkhauses City entlang der Klingelbergstrasse wer-
Die Nutzungen im Neubau Perimeter B stehen in
den in naher Zukunft zwei Neubauten entstehen, die
Beziehung zum Gesamtspital. Für optimale Abläufe
zu einer neuen städtebaulichen Disposition führen
ist der Neubau sowohl unterirdisch für Personal,
werden. Im Dreieck Schanzenstrasse / Klingelbergs-
Patienten und Materialflüsse (Materialtransportan-
trasse entsteht das Labor- und Forschungsgebäude
lage, Spontantransportanlage) als auch oberirdisch
BSS der ETH Zürich. Weiter östlich an der Klingel-
zwingend an das Klinikum 1 anzubinden. Oberirdisch
bergstrasse ist das neue Biozentrum der Universität
sind möglichst viele Geschosse des Neubaus mit
Basel projektiert.
einer bettengängigen Verbindung an das Klinikum 1
anzubinden. Es sind sowohl die notwendige Durch- Südlich des Perimeters an der Hebelstrasse wird auf
fahrtshöhe (Feuerwehrzufahrt) von der Schanzen- der gegenüberliegenden Parzelle aktuell die Erweite-
strasse in die Kernzone des Spitalgartens als auch rung des Bernoullianums geprüft. Sämtliche Vorha-
maximale Rampensteigungen (Bettentransport) im ben wurden auf der abgegebenen Modellgrundlage
Gebäudeinneren zu berücksichtigen. nach aktuellem Kenntnisstand berücksichtigt.
Das Areal ist von allen Seiten für Fussgänger erreich-
bar. Es sind öffentliche und behindertengerechte
Fussgängerverbindungen von der Schanzenstrasse
durch den Spitalgarten zur Schönbeinstrasse und
parallel zur Hebelstrasse verlaufend auf dem Areal
vorzusehen. Durch den Spitalgarten soll zudem
eine Fussgängerverbindung von der Schanzenstrasse
zum Petersgraben ermöglicht werden.
Die Zufahrt für PKWs zum Zubringen von Patienten,
Taxis und Patiententransporte muss für den Perimeter
B oberirdisch nachgewiesen werden. Gewünscht
ist eine für die Nutzung notwendige und für die
Adressbildung sinnvolle Vorfahrt mit Raum zum aus-
und einsteigen lassen und nach Möglichkeit auch
für Kurzzeitparkierung.
15Studienauftrag
Präqualifikation Zwischenbesprechung 2
Das Beurteilungsgremium hat an seiner Sitzung vom Am 16. August 2018 wurde die Weiterentwicklung
10. April 2018 aus 19 eingegangenen Bewerbungen der Projektvorschläge präsentiert. Die Lösungsvor-
die folgenden Teams auf der Basis der Submissions- schläge und unterschiedlichen Strategieansätze
kriterien für die Teilnahme am Studienauftrag präqua- wurden sehr geschätzt.
lifiziert:
Die Freigabe der Höhenbegrenzung aus der Zwi-
• Boltshauser Architekten AG, 8003 Zürich schenbesprechung 1 zeigte eine Entspannung und
• PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten, Verbesserung der Projektbeiträgen hinsichtlich der
4142 Münchenstein 1 städtebaulichen Setzung und der Berücksichtigung
• dany waldner ag + Morger Partner Architekten AG, der denkmalgeschützten Bauten. Am Soll-Raum
4051 Basel programm PLUS und an der Freigabe der Höhen
• Burckhardt+Partner AG, 4002 Basel entwicklung wurde aufgrund des qualitativen
• Generalplaner Gmür, 4001 Basel Entwicklungspotentials im Perimeter B festgehalten.
• PG Nissen Wentzlaff Architekten BSA SIA AG /
Den Teams wurden im Nachgang eine allgemeine
Ludes Architekten - Ingenieure GmbH, 4052 Basel
und eine individuelle Rückmeldung zugestellt.
• ARGE Harry Gugger Studio Ltd. /
Itten+Brechbühl AG, 4002 Basel
Abgabe und Vorprüfung
Einzelne Generalplanerteams haben sich aufgrund Die Abgabe der Pläne erfolgte am 28. September
der Exklusiv-Regelung für die Phase 2 des Studien- 2018. Alle Teilnehmer haben ihre Unterlagen frist-
auftrags mit anderen Subplanern ergänzt. gerecht und vollständig eingegeben und erhalten
gemäss Programm die ausgelobte Entschädigung.
Studienauftrag
Am 7. Mai 2018 fand am Universitätsspital Basel die Schlusspräsentation
Startveranstaltung mit einer Einführung vor Ort und Am 26. Oktober 2018 konnten die Teams in einer
der Ausgabe der Modelle statt. halbstündigen Präsentation ihren endgültigen Projekt-
vorschlag dem Beurteilungsgremium präsentieren.
Zwischenbesprechung 1
Am 19. Juni 2018 stellten die Teams die Resultate
vom Prüfauftrag des Soll-Raumprogramms BASIS
und PLUS vor. Dabei wurde in der Diskussion klar
ersichtlich, dass nur mit einer Freigabe der Höhenbe-
grenzung aus dem Bebauungsplan über 25 Meter
eine sowohl städtebauliche wie auch für die Nutzung
funktionale und ansprechende Lösung möglich sein
wird. Nur so kann eine angemessene Reaktion auf
die denkmalgeschützten Bauten des Klinikums 1
und dem Holsteinerhof umgesetzt und trotzdem die
notwendigen Funktionsflächen ausgewiesen werden.
Das Beurteilungsgremium entschied sich für die
Fortführung des Studienauftrages auf dem Soll-
Raumprogramm PLUS. Somit wurde die Höhenbe-
grenzung von 25 Meter aus dem Bebauungsplan
freigegeben. Es erfolgte eine allgemeine und eine
individuelle Rückmeldung an alle Teams.
16Beurteilung
Beurteilungskriterien Vorprüfung
Die Bewertung der Projekte erfolgte anhand der Alle sieben Projekte wurden unter Berücksichtigung
nachstehend aufgeführten Beurteilungskriterien. Die des Studienauftragsprogramms «Neubau Perimeter B»
Reihenfolge der Kriterien ist keine Wertung. vom 7. Mai 2018 geprüft. Die formelle Vorprüfung
hat die Vollständigkeit der Unterlagen, die fristge-
• Architektur / städtebauliche Qualitäten
rechte Abgabe und die Erfüllung der formalen Anfor-
• Spitalbetriebliche Organisation (im Gebäude und
derungen festgestellt. In der materiellen Vorprüfung
Anbindung an Bestand)
wurden unter anderem die Erfüllung des Funktions-
• Freiraumkonzept und Umgang mit Garten
und Raumprogramms sowie die baurechtlichen
• Patientenattraktivität
und erschliessungstechnischen Rahmenbedingun-
• Etappierbarkeit / Aufrechterhaltung des Betriebs zu
gen geprüft.
jedem Zeitpunkt
• Erfüllung des Raumprogramms in beiden Phasen
• Wirtschaftlichkeit in der Erstellung und im Betrieb
• Prozesseffizienz der Patientenabläufe
• Bauliche und betriebliche Flexibilität im Hinblick
auf die absehbaren zwei Nutzungsphasen
• Umgang mit baugeschichtlichem Kontext und
Denkmalschutz
• Nachhaltigkeit
17Jurierung
Das Beurteilungsgremium hat sich am 30. Oktober Engere Wahl und Kontrollrundgang (im Plenum)
2018 zum 1. Jurierungstag und am 29. Januar 2019 Das Beurteilungsgremium entschied einstimmig,
zum 2. Jurierungstag getroffen. zwei Projekte vertieft zu prüfen und für die engere
Wahl vorzusehen:
Dem Antrag der Vorprüfung, sämtliche Projekte zur
Beurteilung zuzulassen, ist durch das Beurteilungs- Projekt 2, PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten
gremium einstimmig stattgegeben worden.
Projekt 3, dany waldner ag + Morger Partner Archi-
Das Verfahren des Studienauftrags «Neubau Perime- tekten AG
ter B» fand nach der Ordnung für Architektur- und
Aufgrund der Diskussion im Beurteilungsgremium
Ingenieurstudienaufträge SIA 143, Ausgabe 2009
und anhand der im Programm aufgeführten Beurtei-
statt. Die Unabhängigkeit des Beurteilungsgremiums
lungskriterien wurde einstimmig das Projekt 2, PG
wurde gewahrt und die Gleichbehandlung der teil-
Herzog de Meuron / Rapp Architekten zur Weiterbe-
nehmenden Teams war sichergestellt.
arbeitung empfohlen.
Das Beurteilungsgremium zeigt sich beeindruckt
Im Kontrollrundgang entschied das Beurteilungs
über die Qualität der eingereichten Projekte. Die
gremium einstimmig unter Abwägung von Vergleich-
Eingaben ermöglichten eine umfassende Auslege-
barkeit das Projekt 3, dany waldner ag + Morger
ordnung und bildeten die jeweilige Grundlage für
Partner Architekten AG zurück in den Rundgang 2 zu
engagierte und profunde Diskussionen.
stellen.
Rundgang 1 (im Plenum) Die ausgelobte Entschädigung in der Höhe von
Aufgrund städtebaulicher, architektonischer und / 85’000.– CHF (exkl. MwSt.) erhalten alle sieben ein-
oder betrieblicher Schwächen schieden folgende gereichten Projekte.
Projekte im ersten Rundgang aus:
Das Beurteilungsgremium bedankt sich bei allen Teil-
Projekt 1, Boltshauser Architekten AG nehmenden und Beteiligten für das grosse Engage-
ment und die wertvollen Beiträge.
Projekt 5, Generalplaner Gmür
Projekt 7, ARGE Harry Gugger Studio Ltd. /
Itten+Brechbühl AG
Rundgang 2 (im Plenum)
Es wurden einstimmig vier Projekte aufgrund der
Prüfung der Wirtschaftlichkeit, der betrieblichen An-
forderungen und der Rahmenbedingungen für den
2. Rundgang ausgewählt:
Projekt 2, PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten
Projekt 3, dany waldner ag + Morger Partner Archi-
tekten AG
Projekt 4, Burckhardt+Partner AG
Projekt 6, PG Nissen Wentzlaff Architekten BSA SIA
AG / Ludes Architekten - Ingenieure GmbH
18Empfehlung und
Weiterbearbeitung
Das Beurteilungsgremium empfiehlt in der Schluss- Im Rahmen der Weiterbearbeitung sollen folgende
abstimmung, das Projekt 2 und somit das Team PG Aspekte optimiert beziehungsweise geprüft werden:
Herzog de Meuron / Rapp Architekten unter Berück-
• Optimierung des statischen Rasters hinsichtlich
sichtigung der nachfolgenden Empfehlung mit der
Nutzung Phase 1 und Flexibilität in der Phase 2;
Weiterbearbeitung zu beauftragen.
• Optimierung der Entfluchtung aller Sicherheits-
Das Beurteilungsgremium ist überzeugt, einen treppenhäuser, auch hinsichtlich Querungen von
starken städtebaulichen Beitrag mit einem hohen Nutzeinheiten (EG-UG);
Mass an Nutzungsflexibilität, sinnvoll aufgezeigten • Optimierung der Fassade im Hinblick auf Unter-
Spitalprozessen und angemessener Wirtschaftlich- halts- und Betriebskosten;
keit gefunden zu haben. • Überprüfung der Dimensionen der innenliegenden
Lichthöfe, wenn möglich ist eine Vergrösserung
Es liegt ein klarer und konsequenter Entwurf vor,
anzustreben;
welcher auch aufgrund der Belegung der Nutzflächen
• Optimierung des 2h Schattens.
in der Phase 1 und in der Phase 2 auf Entwicklungen
und allfällige Veränderungen im Spitalbetrieb nach-
haltig reagieren kann.
19Genehmigung Beurteilungsgremium Beat Aeberhard (Vorsitz) Lorenzo Giuliani Fawad Kazi Qintus Miller Stefan Traxler Anne Marie Wagner Thomas Blanckarts (Ersatz) Bernhard Gysin (Ersatz) Robert-Jan Bumbacher Prof. Albert Urwyler Dr. Werner Kübler Prof. Christoph A. Meier Dr. Serge Reichlin (bis Mai 2018) Dr. Volker Büche (ab Mai 2018) Irmtraut Gürkan (Ersatz) Dr. Henrik Pfahler (Ersatz ab Oktober 2018) Basel, den 23. April 2019 20
21
22
Projektteil
23Antrag zur Weiterbearbeitung 24
Projekt 2
PG Herzog de Meuron /
Rapp Architekten
Generalplanung / Gesamtleitung Rapp Architekten AG
Architektur / Städtebau Herzog & de Meuron Ltd.
Landschaftsarchitektur Vogt Landschaftsarchitekten
Spitalbetriebsplanung Teamplan GmbH
Bauingenieurwesen ZPF Ingenieure AG
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaplanung Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG
Elektroplanung SYTEK AG
Sanitär- und Medizinalgasplanung Schudel + Schudel Ing. SIA
Gebäudeautomation / MSRL Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG
Fachkoordination Haustechnik Rapp Gebäudetechnik AG
25Projekt 2: PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten Modellfoto 1:1000, Städtebaulicher Kontext Campus Gesundheit und Campus Schällemätteli (Hochschulareal St. Johann) Modellfoto 1:500, Areal Campus Gesundheit 26
Städtebau es mit dem Turm auf den Neubau des Klinikums 2.
Ausgehend von der städtebaulichen Vision eines Die Gartenfassaden des Sockelbaus erinnern an den
Life-Sciences-Campus, der sich durch eine Gruppe heutigen Bestand und lassen so die ursprüngliche
höherer Häuser stadträumlich auszeichnet, wird eine Idee der Anlage weiterleben — eine bemerkenswerte
Komposition von drei Baukörpern vorgeschlagen: Form von Kontinuität, wenn der historische Bestand
ein Sockelbau mit Turm und Pavillon. nicht erhalten werden kann.
Der drei- bis viergeschossige Sockelbau übernimmt Die Nähe zum Holsteinerhof ist adäquat, der Gar-
die Höhe der heutigen Schwesternhäuser und beglei- ten des Holsteinerhofs wird jedoch verkleinert. Die
tet die Geometrie der Schanzenstrasse in einer fein Passerelle zum Klinikum 1 ist überzeugend, da die
konkaven Form, er endet volumetrisch angemessen geschützte Fassade von Hermann Baur nur minimal
zum Holsteinerhof. gestört wird.
Die Anbindung zum Klinikum 1 in der Flucht der
Freiraum
Fassade zur Schanzenstrasse beeinträchtigt die Ab-
Die Führung der Besucher von Süden wie von Nor-
wicklung der geschützten Fassade nur minimal und
den zum Haupteingang ist sehr klar. Der Eingang ist
schliesst gleichzeitig den Spitalgarten ab.
grosszügig dimensioniert und optimal positioniert.
Der 13-geschossige Turm schafft ein klares Vis-à- Torartig wird man an der Schanzenstrasse durch die
vis zum Klinikum 2. Zusammen mit dem Sockelbau neue Passerelle in den Spitalgarten geführt. Orga-
spannt er den Freiraum des Spitalgartens auf und nisch geformte Wege führen durch die Anlage und
sichert ihn weiterhin als Herz des Areals. Zur Stadt verbinden den Altbau mit dem Neubau.
definiert der Turm einen Platz mit dem Hauptzugang;
Die südliche Stirnfassade endet auf der Flucht des
die Kreuzung Klingelbergstrasse / Schanzenstras-
Holsteinerhofs, was zu einer räumlichen Klarheit in
se wird dadurch aufgewertet und es entsteht ein
der Hebelstrasse führt. Breite Sitzstufen transfor
eindeutiges Gegenüber zum Neubau BSS ETH. Die
mieren den Eingangsbereich zum Aufenthalts- und
Setzung des Turms ist funktional und stadträumlich
Begegnungsort und schaffen so eine klar erkennbare
präzise. Der 2h Schatten des Turms tangiert minimal
Adresse. Die Verbindung von der oberen zur unteren
Wohnliegenschaften an der Klingelbergstrasse.
Parkebene ist über die neue Treppe, welche am Ende
der Terrasse positioniert ist, gut und stimmig gelöst.
Architektur
Der Dachgarten hat eine adäquate Grösse und wird
Der Sockelbau ist vom Boden leicht abgehoben und
durch den Pavillonbau gut zoniert.
übernimmt den topographischen Sprung entlang
der Schanzenstrasse. Eine grosszügige Eingangshalle
Statik
durchquert das Gebäude am Ausgleichpunkt der
Das Tragwerk gliedert sich in einen viergeschossigen
Höhenkoten Garten / Strasse und verbindet – wie im
Sockelbau und den Turm mit 13 Geschossen. Eine
Klinikum 1 – Stadt- und Hofeingang. Die Fassade zur
intensive Analyse der vielfältigen Randbedingungen
Stadt ist mit Brise Soleils fein strukturiert, mineralisch
im Untergrund legt die Position des Turms auf dem
und hell; zum Garten erinnern auskragende Balkone
Perimeter fest, so dass eine relativ einfache Grün-
und Stoffmarkisen an die heutigen Schwesternhäuser
dung dafür realisierbar ist.
und lassen die ursprünglichen Ideen der Anlage, Luft,
Licht, Erholung der Patienten im Garten, weiterleben. Das gesamte Gebäude ist mit einem Platten-Stüt-
zen-System als Skelettbau konzipiert; die auskragen-
Zwei Innenhöfe und offene Wartebereiche bringen
den Bereiche des Turms werden elegant mit schräg
Tageslicht und Orientierung in die langen Gänge des
gestellten Stützen gelöst. Die vorgeschlagenen
tiefen Baukörpers. Biomorphe Geometrien werden
statischen Massnahmen für die anspruchsvollen
immer wieder eingesetzt: für die Treppenhäuser, die
Bereiche über dem Parkhaus City, dem bestehenden
Eingangshalle und den Dachpavillon. Sie verweisen
Energieleittunnel-Kanal und der Überschneidung
mit ihrer geschwungenen Form auf den Verlauf der
Sockelbau mit der Tiefgarageneinfahrt sind nach-
ehemaligen Stadtmauer.
vollziehbar und effizient.
Ein zurückgesetztes hohes Geschoss mit Veranstal-
tungsräumen trennt den über den Dächern auskra- Gebäudetechnik
genden Kubus vom Sockelbau. Eine öffentliche oder Die Gewerke sind umfangreich beschrieben. Die
halb-öffentliche Nutzung an dieser Schnittstelle ist Konzepte sind durchdacht und teilweise mit Berech-
ideal; ein Dachgarten auf dem Sockelbau bietet einen nungen und Kennzahlen hinterlegt. Die Anbindungen
geschützten Aussenraum für das Personal wie für die an Energieleittunnel, Materialtransportanlage und
Patienten und erweitert den Spitalgarten visuell aus Pathologie sind gewährleistet.
der Perspektive der umliegenden höheren Häuser.
Alternativer Ansatz einer zusätzlichen, redundanten
Wärmeerzeugung mittels Erdsonden, die jedoch auf-
Denkmalschutz
grund der bestehenden Energieerschliessung nicht
Das vorgeschlagene Projekt wird einerseits mit dem
zum Tragen kommen wird.
Sockelbau der ursprünglichen Planung der Spitalanla-
ge von Hermann Baur gerecht, andererseits reagiert
27Projekt 2: PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten
Funktionsanordnung und Prozesse Betrieblich-bauliche Effizienz
Die Schnittstellenthematik und Verknüpfung der
Funktionale Erscheinung und Logistik
Prozesskaskaden sind richtig erkannt und explizit
Der Planungsentwurf überzeugt durch ein hohes
dargestellt. Vorgaben wie zum Beispiel der Umgang
Planungsverständnis für die klinischen Zusammen-
mit radioaktiven Stoffen sind bereits offenkundig
hänge am Universitätsspital Basel. Makroeffizienz-
umgesetzt. Wegelängen sind erkennbar optimiert.
überlegungen sind richtig erkannt und platziert. Der
Zusammengefasst ist dies aus strategischer Betriebs-
Flächenquotient Geschossfläche / Nutzfläche liegt bei
sicht der beste Planungsentwurf.
1,86 und zeigt somit ein gutes Aufteilungsverhältnis.
Etappierung (Phasenbelegung)
Die Situation der beiden Haupteingänge Schanzen
Die Belegung zeigt über beide Phasen, dass das
strasse und Spitalgarten ist übersichtlich; der zentrale
Planungsverständnis und die Zusammenhänge in der
Informations- / Anmeldetresen ist gut positioniert und
Makrobelegung des Gebäudes mit Funktionseinhei-
die Wegleitung der Patienten sehr gut gelöst. Die
ten gut verstanden wurde. Der Vorschlag zeigt über
Hauptvertikalerschliessungen für gehfähige, rollstuhl-
beide Etappen eine funktionierende Lösung.
bedürftige und liegende Patienten sind direkt erreich-
bar. Gesamtwürdigung
Die Gliederung in drei Baukörper, die unterschiedliche
Das Gebäude schliesst über drei Geschosse (zwei
stadträumliche Funktionen abdecken und die unter-
oberirdisch, eines unterirdisch) an das Klinikum 1 an,
einander ausgewogene Verhältnisse aufweisen, ist
so dass eine grundsätzliche Flexibilität gegeben ist.
städtebaulich überzeugend. Ihre Lage stellt sowohl
Die hauptsächlichen Patienten-, Personal- und Logis-
zur städtischen Umgebung als auch zum Spital
tikströme werden im Gebäudeteil mit dem darüber
areal präzise räumliche und atmosphärische Bezüge
liegenden Turm zu erwarten sein. Entsprechend stark
her. Die Position des Turms ist städtebaulich explizit
wurde dieser Teil mit den quantitativ notwendigen
gewählt um den Platz zur Stadt zu fassen, ein Gegen-
Aufzügen und Verteillogistiksystemen geplant. Die
über zum Klinikum 2 zu schaffen und eine angemes-
benötigten Vertikalerschliessungen sind überwiegend
sene Distanz zum Klinikum 1 zu gewährleisten.
richtig abgebildet. Die Materialversorgung ist nach-
vollziehbar dargestellt und klar betrieblich gegliedert. Im Inneren ist die Position des Haupterschliessungs-
kernes des Turms betrieblich ideal, er dockt an der
Durch Leit- und Anmeldepunkte an allen Kreuzungs-
Eingangshalle an und wird somit an der Topographie
oder Verzweigungspunkten erschliesst sich das
justiert. Der Entscheid der Verfasser, die Position des
Gebäude vollumfänglich. Die Laufwege sind klar und
Turms gegenüber dem 2h-Schatten vorzuziehen,
eindeutig, das Gebäude insgesamt sehr gut durch-
ist nachvollziehbar. Die Konsequenzen der Verletzung
dacht.
sind noch nicht abschätzbar und gehören zu dem
Der Sockelbau und der Pavillon mit der Nephrologie weiteren politischen und rechtlichen Prozess. Der
beinhalten alle definitiven Nutzungen, die Rochade- Beitrag überzeugt durch die präzise städtebauliche
flächen befinden sich im Turm. Die innere Organisati- Konfiguration, die aus dem Kontext entliehene Archi-
on folgt einer hohen Funktionalität und wird betrieb- tektursprache und das hohe Planungsverständnis
lich sehr gut bewertet. für die klinischen Prozesse des Spitals. Trotz hoher
Komplexität ist das Projekt in der Lage, klar struk-
Funktionalität und Flexibilität
turierte Grundrisse mit angemessenen räumlichen
Die Primärfunktionalität des Gebäudes leitet sich aus
Qualitäten anzubieten. Die Anordnung der Nutzungen
der Primärstruktur des Gebäudes ab. Dazu zählen die
und Prozesse im Gebäude sind sehr gut gelöst.
Geschosshöhen und der verwendete Stützenraster.
Eine hohe Primärfunktionalität lässt auf eine bauliche Die Zugänge, die Erschliessung aller Nutzungen
Flexibilität schliessen und in der Folge eine über die sowie die Materialversorgung sind betrieblich klar ge-
Zukunft notwendige Ausbau- und Umnutzungs gliedert und nachvollziehbar dargestellt. Die Sorgfalt
flexibilität. Der Turm basiert auf einer niederinstallier- mit der das Raumprogramm umgesetzt worden ist
ten Nutzung, der Sockelbau auf einer hochinstallier- und weitgehend erfüllt wird, ist lobenswert.
ten Nutzung und lässt somit sämtliche medizinischen
Die wiederkehrenden Elemente mit biomorphen
Umnutzungen zu.
Geometrien, die den gesamten Raum prägen wie
Das Tumorzentrum und die Nephrologie können Eingangshalle und Treppenhäuser, oder die plastisch
durch die gezeigte Eingangssituation gut getrennt wirkenden Brise-soleils bringen eine angemessene
voneinander erreicht werden. Für die Labormedizin und bewusst gestaltete Atmosphäre ins Projekt; der
ist dieser Planungsentwurf grundsätzlich sehr gut Ausdruck der Fassaden in ihren Massstäben und ihrer
geeignet, insgesamt zeigt sich die Belegung als hoch Materialität wird gewürdigt.
funktional.
Der ganze Entwurf ist geprägt von einer sorgfältigen
und tiefen Auseinandersetzung mit der Aufgabe auf
allen Ebenen, vom Städtebau bis zur Logistik und
Konstruktion. Das Ergebnis entspricht somit den
hohen Erwartungen sowohl der Stadt wie auch dem
Universitätsspital Basel.
2829
Projekt 2: PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten 30
31
Projekt 2: PG Herzog de Meuron / Rapp Architekten 32
33
Nicht prämierte Beiträge Reihenfolge ohne Wertung 34
Projekt 1
Boltshauser Architekten AG
Generalplanung / Gesamtleitung Boltshauser Architekten AG
Architektur / Städtebau Boltshauser Architekten AG
Landschaftsarchitektur Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt
Spitalbetriebsplanung Hospitaltechnik Planungsgesellschaft MBH
Bauingenieurwesen Basler & Hofmann AG
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaplanung Meierhans + Partner AG
Elektroplanung IBG B. Graf Engineering
Sanitär- und Medizinalgasplanung Balzer Ingenieure AG
Gebäudeautomation / MSRL IBG B. Graf Engineering
Fachkoordination Haustechnik Meierhans + Partner AG
35Projekt 1: Boltshauser Architekten AG Modellfoto 1:1000, Städtebaulicher Kontext Campus Gesundheit und Campus Schällemätteli (Hochschulareal St. Johann) Modellfoto 1:500, Areal Campus Gesundheit 36
Städtebau Freiraum
Grundidee der städtebaulichen Setzung ist ein langes, Der gewählte Abstand zum Klinikum 1 erscheint
radial geformtes Volumen. Seiner Rolle als Vermittler adäquat, die Nutzung als Gästeparkplatz überzeugt
zwischen den Bestandsbauten wird der Neubau mit jedoch weder funktional noch gestalterisch. Der ganz
seiner vorgeschlagenen Positionierung jedoch nicht im Norden des Gebäudes gelegene Haupteingang ist
gerecht; die respektvolle Distanz zum Klinikum 1 zwar in Bezug auf den öffentlichen Verkehr gut posi-
vermag stadträumlich nicht wirklich zu überzeugen. tioniert, doch die beengten Platzverhältnisse werden
Das südliche Ende des gebogenen Volumens endet den Anforderungen an einen repräsentativen und gut
abrupt an der Hebelstrasse, auch die Staffelung der funktionieren Eingang nicht gerecht.
Obergeschosse beurteilt das Beurteilungsgremium
bezüglich Reaktion auf den Holsteinerhof als kritisch. Statik
Generell wurde eine flexible Gebäudestruktur entwi-
Architektur ckelt, welche sich auf einem sinnvollen Raster von
Das sehr eigenständige Erscheinungsbild des neuen 8.1 m aufbaut. Das Tragwerk wurde sorgfältig und
Gebäudes mit hohem Glasanteil, den weiss gestriche- nachvollziehbar bearbeitet und leistet konstruktiv
nen Stahlstützen und den umlaufenden vorgehängten einen interessanten Vorschlag. Fragwürdig bleibt das
Balkonen setzt sich deutlich von seiner Umgebung sichtbare Deckenprinzip mit offener Installation im
ab. Spitalbau, auch hinsichtlich des Brandschutzes.
In Bezug auf die zu erstellende Geschossfläche wird
Gebäudetechnik
sehr viel Nutzfläche angeboten, jedoch zu Lasten von
Alle Gebäudetechnikgewerke sind abgebildet,
betrieblichen Funktionalitäten. Dies nicht nur in Bezug
beschrieben und ausführlich auf Prinzipschemas
auf Prozesse, sondern auch bezüglich Orientierung
dargestellt. Die Umsetzung Gebäudetechnik hält sich
und innenräumlichen Qualitäten.
an die Vorgaben, mit Ausnahme der Netzersatzan-
Die grosse Gebäudetiefe und die vorgeschlagene lage, welche im Untergeschoss statt auf dem Dach
hohe Flächeneffizienz führen zu vielen Raumeinheiten geplant ist.
ohne jeglichen Bezug zu Tageslicht oder auch oft zu
schmalen und ungünstigen Raumproportionen.
Denkmalschutz
Der Projektvorschlag versucht, gemäss der ursprüng-
lichen Planung von Hermann Baur, den Neubau als
Flügel des Klinikums 1 auszubilden. Dies gelingt
jedoch nicht, da das Volumen zu dominant erscheint.
Die Materialisierung der Fassaden in Metall wirkt im
Umfeld der mineralischen Fassaden von Klinikum 1
und Holsteinerhof als Fremdkörper.
37Projekt 1: Boltshauser Architekten AG
Funktionsanordnung und Prozesse Gesamtwürdigung
Die vollständige Abkehr von einer Entwurfsidee zum
Funktionale Erscheinung und Logistik
Zeitpunkt der zweiten Zwischenbesprechung ist dem
Das bereitgestellte Flächenangebot und die Stock-
nun vorliegenden Projekt vielfach anzusehen. Die
werkshöhen berücksichtigten die Funktionszu-
städtebauliche Setzung vermag als Gegenüber zum
ordnungen unzureichend. Der Flächenquotient
Spitalareal nicht wirklich zu überzeugen. Der neue
Geschossfläche / Nutzfläche liegt bei tiefen 1,6. Aus
Freiraum bildet trotz Passerelle keinen befriedigenden
betrieblich-baulicher Sicht bedeutet dies kaum Flexi-
Abschluss des Spitalgartens. Die sowohl im Längs-
bilität für weitere Planungsschritte oder notwendige
wie auch im Querschnitt vorgenommenen Abstaffe-
Funktionsrochaden.
lungen lösen keine der relevanten Fragen, weder
Auf den Fluren ist eine Trennung von Patienten-, bezüglich Spitalgarten noch in Bezug auf den Hol-
Personal- und Materialströmen nicht möglich. Eine steinerhof. Die äussere Anmutung, insbesondere
Führung der Patienten über Leitstellen im Gebäude Materialität und die umlaufenden Balkone, werden
ist nicht erkennbar. Die gezeigten Kerne in der Mit- kritisch beurteilt.
telzone sind nicht ausreichend dimensioniert, zudem
Es gelingt den Verfassern, auf ihrer vorgeschlagenen
fehlen Materialversorgungsaufzüge. Eine Beurteilung
Geschossfläche das grosse Raumprogramm vollstän-
der Materialversorgung ist auf Grund der fehlenden
dig und vielerorts funktional zu organisieren, doch
Versorgungslogistik wie zum Beispiel der Materi-
es bleiben zum Teil betrieblich relevante Mängel in
al- und Spontantransportanlage nicht möglich, die
beiden vorgegebenen Betriebsphasen bestehen.
Förderanlagensysteme sind nicht dargestellt.
Auf die grosse Gebäudetiefe wird mit vier- und
Die gezeigte Planung lässt eine intuitive Orientierung
dreibündigen Geschossdispositionen reagiert. Dabei
bis zur Organisations- oder Funktionseinheit zu, die
entstehen mancherorts sehr ungünstige Raumpro-
zweite Funktionsebene ist weniger klar organisiert.
portionen mit wenig Tageslicht. Die innenräumli-
Funktionalität und Flexibilität chen Qualitäten vermögen generell nicht wirklich zu
Es gibt logische Brüche bei der Funktionsbelegung überzeugen.
sowie bei der Schnittstellenanbindung der Bereiche
Insgesamt erkennt das Beurteilungsgremium einen
untereinander. Die Aufteilung der Labormedizin auf
Projektvorschlag mit einer sehr eigenständigen
drei Stockwerke ist nicht nachvollziehbar, Schreib-
städtebaulichen Grundhaltung, der in einigen Berei-
plätze am Fenster werden in einem medizinischen
chen stufengerecht, vollständig und sorgfältig aus
Labor nicht benötigt. Eine Isolierung der Radiologie
gearbeitet wurde, dies trotz überraschender Kehrt-
ist nicht ideal.
wende nach der zweiten Zwischenbesprechung.
Das Gebäude ist mit dem gezeigten Raster sehr flexi-
bel. Umplanungen im Sinne von zukünftiger Entwick-
lung, Strukturveränderungen (Umbauten) sind durch
den richtungsungebundenen Raster möglich.
Betrieblich-bauliche Effizienz
Die gezeigte Planung lässt noch keine Schlüsse auf
betriebliche Effizienzen zu.
Etappierung (Phasenbelegung)
Aufgrund der bereits nachgewiesenen Flexibilität
sind die Belegungen in beiden Phasen wie vorge-
schlagen möglich, aber nicht im Sinne der betriebli-
chen Effizienz.
38Sie können auch lesen