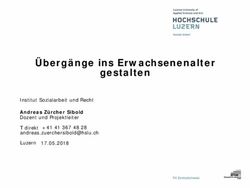WIE WEITER MIT DER RENTE? - MODELL ÖSTERREICH - LEISTUNGSFÄHIGE RENTENVERSICHERUNG FÜR ALLE GENERATIONEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
WIE WEITER MIT DER RENTE? MODELL ÖSTERREICH – LEISTUNGSFÄHIGE RENTENVERSICHERUNG FÜR ALLE GENERATIONEN AK WIEN I JOSEF WÖSS I 27.4.2017
ÜBERBLICK 1. Rentensystem in Österreich 2. Vergleich Österreich – Deutschland 3. Arbeitsmarkt als zentrale Stellschraube zur Bewältigung des demographischen Wandels
ALTERSSICHERUNG IN ÖSTERREICH - ÜBERBLICK
Anteil an
Typus Erfassungsgrad Rentenzahlungen*
* (2010)
Öffentliche - Gesetzliche (fast*) alle
Renten Rentenversicherung Erwerbstätigen
90 %
(GRV)
- Beamtenversorgung
Betriebsrenten - (vor allem) ca 30 % der AN
Pensionsfonds 4%
(„Pensionskassen“)
Privatrenten vor allem: keine verlässlichen
- Lebensversicherung Daten
6%
- „prämienbegünstigte
Zukunftsvorsorge
* Ausnahmen: geringfügig Beschäftigte und bestimmte freie Berufe
** Url Thomas/Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (2012)ALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
GRV – LEISTUNGSARTEN / RENTENALTER
Regelaltersrente (Dauerrecht*): ab 65
Vorzeitige Altersrenten (Dauerrecht*)
- Korridorrente: ab 62 (40 Versicherungsjahre)
- Schwerarbeitsrente: ab 60 (45 Versicherungsjahre / 10 Jahre Schwerarbeit)
„Ausgleichszulage“ zu Niedrigrenten (Einkommensanrechnung)
- Aufstockung auf € 889,84 für Singles (€ 1.000 falls mind. 30 Versicherungsjahre)
- Aufstockung auf € 1.334,17 für Paare (Werte 2017)
* Für Frauen gelten dzt günstigere ÜbergangsregelungenALTERSSICHERUNG IN ÖSTERREICH
GRV – LEISTUNGSZIEL / RENTENBERECHNUNG
Leistungsziel 80/45/65
(dh 80 % Bruttoersatz nach 45 Beitragsjahren
und Rentenantritt zum Alter 65)
Rentenformel
Anwartschaftserwerb/Jahr: 1,78 % vom Jahresbruttolohn
jährl Anpassung erworbener Anwartschaften: mit
Entwicklung der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen
jährl Anpassung laufender Renten: mit Inflationsrate
Abschläge / Zuschläge
Rentenantritt vor Regelalter: - 5,1 % p.a. (- 4,2 %*)
Rentenantritt nach Regelalter (bis 68): + 4,2 % p.a.
Abschlag bei Schwerarbeitsrente: - 1,8 % p.a.
* Der niedrigere Abschlag kommt als Übergangsregelung zur Anwendung für Personen mit zumindest 45 Versicherungsjahren.ALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
GRV - HÖHE DER ALTERSRENTEN
OHNE ZWISCHENSTAATL TEILLEISTUNGEN
NEURENTEN 2015
Männer Frauen
25% 50% 75% 25% 50% 75%
bekommen pro Monat weniger als … Euro brutto (14 x)
Arbeiter 1.339 1.739 2.095 584 845 1.120
Angestellte 2.049 2.668 3.109 851 1.261 1.797
Werte inkl Ausgleichszulagen
Quelle: Hauptverband der öst.SV-Träger: Statistisches Handbuch der öst. SV 2016ALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
GRV - FINANZIERUNG
Beitragssatz GRV 22,8 % (seit 1988 unverändert)
(Unselbständige)
12,55 % AG-Beitrag
10,25 % AN-Beitrag
Beitragsbemessungsgrenze € 4.980 / Monat (2017)
(„Höchstbeitragsgrundlage“) € 69.720 / Jahr (4.980 x 14)*
Bund ist gesetzlich verpflichtet, die Differenz zwischen
(Beitrags)Einnahmen und Ausgaben zu zahlen
Bundesbeitrag Ausfallshaftung
Ausfallshaftung: 21,9 % des Rentenaufwands (2015)
Bund ersetzt der PV den Aufwand für Ausgleichszulagen
* In Österreich erhalten fast alle AN 2 zusätzliche Monatslöhne pro Jahr
(Urlaubs-/Weihnachtsgeld). Von den „Sonderzahlungen“ sind ebenfalls SV-Beiträge zu zahlen.ALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
RENTENREFORMEN I
ANPASSUNG AN DEMOGRAPHISCHEN WANDEL
Bemessungsgrundlage: 15 beste Jahre Lebensdurchrechnung (mit besserer
Aufwertung – Anbindung an Entwicklung der Beitragsgrundlagen)
Rentengutschrift/Jahr: 2 % (max 80 %) 1,78 %
Erhöhung der Abschläge bzw. Zuschläge bei früherem / späterem Rentenantritt
Erschwerter Zugang zu vorzeitigen Altersrenten Abschaffung Rente bei AL
etc. / Anhebung der Altersgrenzen / Anhebung der erforderlichen
Versicherungsjahre
Erschwerter Zugang zu Invaliditätsrenten Rehab vor Rente etcALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
RENTENREFORMEN II
ANPASSUNG AN DEMOGRAPHISCHEN WANDEL
Rentenanpassung – Umstellung auf Verbraucherpreisindex
(reduzierte Anpassung in einzelnen Jahren insb. für höhere Renten)
Erhöhung der Transparenz: Einführung individueller „Pensionskonten“
(Übertragung aller „Alt-Anwartschaften“) – jährliche Gutschrift von 1,78 % der
jeweiligen Bemessungsgrundlage
Angleichung Regelrentenalter der Frauen: 60 65
(Übergangsjahrgänge: 1964 – 1968)
Angleichung Beamtenpensionsrecht an Leistungsrecht der GRV
(volle Wirkung für neueintretende Beamte ab 2005)ALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
GRV - AUSGABEN / FINANZIERUNG
1985 - 2015
BIP Ausgaben Ausgaben Bundesmittel Beitragssätze
PV* PV* PV** (Unselbständige
in Mrd € in Mrd € in % des BIP in % des BIP AG+AN)
1985 99 10,8 10,8 % 3,0 % 22,7 %
1990 136 14,3 10,5 % 2,7 % 22,8 %
1995 176 18,4 10,4 % 2,6 % 22,8 %
2000 213 22,3 10,5 % 2,3 % 22,8 %
2005 253 26,2 10,4 % 2,6 % 22,8 %
2010 294 33,0 11,2 % 3,0 % 22,8 %
2015 337 39,5 11,6 % 2,9 % 22,8 %
*inkl Ausgleichszulage; ** inkl Ausgleichszulage, „Partnerleistung“, Bundesbeiträge für Teilversicherungszeiten
Quelle: Pensionskommission (2015); Handbuch der öst SV 2015; korrigierte BIP-Werte (Statat/WIFO 2015);
2015: vorläufige WerteALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
ÖFFENTLICHER RENTENAUFWAND - AUSBLICK
VORAUSSCHÄTZUNG 2010 – 2060 (EU-AGEING-REPORT 2015)
Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Altersgruppe 65+
gesetzliche PV Beamtenpensionen gesamt
in % der
in % des BIP
Gesamtbevölkerung
2013 10,4 3,5 13,9 18,2
2020 10,6 3,3 13,9 19,5
2030 11,6 2,8 14,4 23,5
2040 12,8 1,9 14,7 26,4
2050 13,5 1,1 14,6 27,4
2060 13,5 0,9 14,4 28,9
Quellen: EU-Kommission (Ageing Report 2015); BMF/BMASKALTERSSICHERUNG ÖSTERREICH
ÖFFENTLICHER RENTENAUFWAND - AUSBLICK
GRAFIK
30,0%
25,0%
% des BIP
20,0%
Pensionsaufwand
Beamte
15,0% Pensionsaufwand
PV
65+ in % der
Gesamtbevölkerung
10,0%
5,0%
0,0%
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059
Quelle: Europäische Kommission 2015, BMF 2015 ; eigene GrafikÖGB/AK POSITION
Jede Form einer guten Alterssicherung kostet viel Geld
gesetzliche Systeme sind kostengünstiger als private
(keine Vertriebskosten, niedrigere Verwaltungskosten, keine
Gewinnverrechnung, etc)
Jede Form der Alterssicherung ist Risiken ausgesetzt
die Risiken gesetzlicher umlagefinanzierter Systeme sind in Summe
geringer als die Risiken bei „Kapitaldeckung“
Hochwertige Alterssicherung erfordert sozialen Ausgleich
die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten, von
Arbeitslosigkeit etc gibt es nur in gesetzlichen Systemen
FAZIT: WIR BRAUCHEN AUCH FÜR DIE HEUTE JÜNGEREN EIN
STARKES GESETZLICHES RENTENSYSTEM2.
VERGLEICH
ÖSTERREICH - DEUTSCHLANDÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
REFORMWEGE
Österreich:
Umfassende Reformen, aber Beibehaltung des Ziels der
Lebensstandardsicherung im gesetzlichen System (Zielformel: 80/45/65)
Deutschland:
Umfassende Reformen mit gezielter Teilverlagerung zu Betriebs- und
Privatrenten (Lebensstandardsicherung soll in Zukunft im
Zusammenwirken von 1./2./3. „Säule“ erreichbar sein)ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
ZENTRALE UNTERSCHIEDE I
Österreich setzt auch für die heute Jüngeren auf eine starke
umlagefinanzierte „1. Säule“ (keine Verlagerung zu kapitalbasierten
Renten)
Das Leistungsniveau der GRV ist in Österreich wesentlich höher als in
Deutschland
Die Mindestsicherung im Alter ist in Österreich in die GRV integriert
(„Ausgleichszulage“ finanziert aus Bundesmitteln)
Der Versichertenkreis der GRV ist in Österreich wesentlich breiter als in
Deutschland - ErwerbstätigenversicherungÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
ZENTRALE UNTERSCHIEDE II
Finanzierung GRV:
- in Österreich gibt es höhere Beitragssätze (22,8 %)
- „Ausfallshaftung des Bundes“: in Österreich ist gesetzlich geregelt, dass
die Differenz zwischen Beitragseinnahmen und Ausgaben aus dem
Bundesbudget zu begleichen ist
Die Beamtenversorgung wurde in Österreich in den Reformprozess
einbezogen (Angleichung des Leistungsrechts)
Betriebsrenten: Der Erfassungsgrad ist in Österreich deutlich niedriger als
in Deutschland (ca 30 %) / gesetzliche Vorgabe: mindestens 50 % des
Beitrags durch ArbeitgeberÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
RENTENHÖHEN 2013
2600
2400
ÖSTERREICH DEUTSCHLAND
2200
2000 € 1.820
1800
1600
1400
€ 1.220
1200
€ 1.050
1000
800
€ 590
600
400
200 Männer Frauen Männer Frauen
0
Quelle: Blank et al: Österreichs Alterssicherung: Vorbild für Deutschland?, Wirtschaftsdienst 4/2016; eigene GrafikÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
(THEORETISCHE) ERSATZRATEN FÜR JÜNGERE
100
ÖSTERREICH DEUTSCHLAND
90
78.1%
80
70
60
Gesetzliche Pension
50
Betriebspension
37.5%
40
30
20
12.5%
10
0
Zentrale Annahmen: Arbeitsbeginn 2014 in Alter 20; durchgehende Erwerbstätigkeit bis 65; konstanter Verdienst jeweils in Höhe des
Durchschnittsverdiensts
Quelle: OECD: Pensions at a Glance 2015; eigene GrafikMAKROÖKONOMISCHE ENTWICKLUNG Zentrale Erkenntnis: Trotz starker öffentlicher Rentenversicherung ist Österreich ist volkswirtschaftlich nicht schlechter gefahren als Deutschland! Quelle: Blank et al: Alterssicherung in Deutschland und Österreich: Vom Nachbarn lernen? WSI-Report Nr 27/2016
3.
Arbeitsmarkt als zentrale Stellschraube
zur Bewältigung des demographischen
WandelsFEHLER AUS VERSEHEN?
VERWECHSLUNG / GLEICHSETZUNG VON DEMOGRAPHISCHER UND
ÖKONOMISCHER „ABHÄNGIGKEITSQUOTE“
“Erwartet wird, dass sich die Zahl der Rentner in Europa bis 2060 relativ zur
Zahl der Beitragszahler verdoppeln wird – diese Situation ist unhaltbar”
(EU-Kommission, Vorstellung des Grünbuchs zu den Pensionen am 7/7/2010)
“Die Zahl der Menschen im Alter 65+ in Relation zur Zahl der Menschen im
Erwerbsalter wird sich verdoppeln von 25,4 % (2008) auf 53,5 % (2060) … 2008
standen jedem Rentner vier Erwerbstätige gegenüber. 2060 wird es pro Rentner
werden es nur mehr zwei Erwerbstätige geben.”
(EU-Parlament, Bericht vom 4/2/2011 zum Grünbuch zu den Pensionen)FEHLER AUS VERSEHEN?
RÜRUP-BERICHT – FEHLER AUS VERSEHEN? GLEICHSETZUNG DEMOGRAPHISCHE/ÖKONOMISCHE „ABHÄNGIGKEIT“ HIOBSBOTSCHAFT: 2030 ENTFÄLLT 1 RENTNER AUF 2,2 VERSICHERTE! – WIE IST DAS HEUTE ???
AK-ABHÄNGIGKEITSQUOTEN-RECHNER
DEMOGRAPHISCHER WANDEL 2010-2050
(EU-27)
2010 (EU-27) 2050 (EU-27)
Demographische Abhängigkeitsquote: 26 % Demographische Abhängigkeitsquote: 50 %
d_DR = Demographische Abhängigkeitsquote: Altersgruppe 65+ relativ zu 15-64
Quelle: AK-Wien / Abhängigkeitsquoten-Rechner (Daten: Eurostat, europop 2010)AK-ABHÄNGIGKEITSQUOTEN-RECHNER
DEMOGRAPHISCHE / ÖKONOMISCHE „ABHÄNGIGKEIT“
(EU-27 / LABOUR FORCE SURVEY INKL. MINIJOBS)
2010 2010
Demographische Abhängigkeitsquote: 26 % Demographische Abhängigkeitsquote: 26%
Ökonomische Abhängigkeitsquote : 65 %
Beschäftigungsquote (20-64): 68.6 %
d_DR = Demographische Abhängigkeitsquote ……….Bevölkerung im Alter 65+ relativ zu 15-64
e_DR = Ökonomische Abhängigkeitsquote…………... Arbeitslose und Pensionisten (incl Invalidität)
relativ zur Zahl der Erwerbstätigen
Erwerbstätige Arbeitslose und Andere – Schüler, Studenten,
Pensionisten Hausfrauen/-männer, etc
(rechtes Bild)
Quelle: AK-Wien, AK-Abhängigkeitsquoten-Rechner (database: Eurostat – europop 2010 / Labour Force
Survey 2012; EU-Kommission – Ageing Report 2012; eigene Berechnungen)ABHÄNGIGKEITSQUOTEN IM VERGLEICH
2010-2050 / EU-27
100
90 Demographische „Abhängigkeit“
+ 92%
80
70
60
50
40
30
Ökonomische „Abhängigkeit“
+ 23% Standard Szenario
20
+ 12% Ökonomische „Abhängigkeit“
10 High-Employment Szenario
0
2010 2050
Quelle: AK-Wien, Abhängigkeitsquotenrechner (2012)EU-WEISSBUCH ZU PENSIONEN (2012)
VERWEIS AUF AK – ABHÄNGIGKEITSQUOTEN-RECHNER
DIE ALTERSSTRUKTUR EINER GESELLSCHAFT ALLEIN SAGT
WENIG AUS. VIEL WICHTIGER ALS DEMOGRAPHISCHE SIND
ÖKONOMISCHE ABHÄNGIGKEITSQUOTEN
„Der springende Punkt ist die wirtschaftliche Abhängigkeitsrate,
die wie folgt definiert ist: Arbeitslose und Personen im Ruhestand als
Prozentsatz der Erwerbstätigen“
ERFORDERLICH IST EINE STEIGERUNG DER BESCHÄFTIGUNGS-
QUOTEN IN ALLEN ALTERSGRUPPEN
„… Beschäftigungsquote steigern, und das nicht nur in der Gruppe der
Älteren, sondern auch in Gruppen mit geringen Beschäftigungsquoten
wie Frauen, Migrantinnen und Migranten sowie junge Menschen“STRATEGIEN ZUR SICHERUNG DER BALANCE ZWISCHEN ARBEITS- UND PENSIONSJAHREN
„Die Anhebung der Beschäftigungsquoten … ist die wirksamste Strategie, mit der sich Länder auf die Alterung der Bevölkerung vorbereiten können“ (EU-Kommission, Demographie-Bericht 2008)
Sie können auch lesen