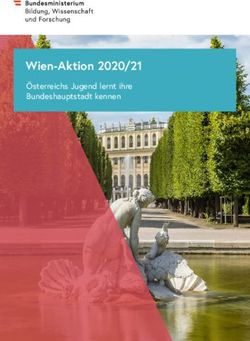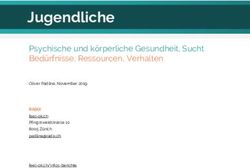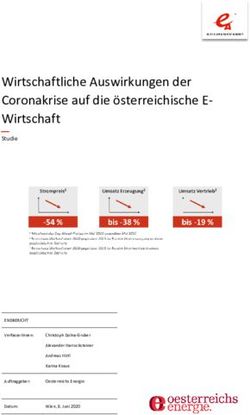Wien 1918 - Tagebücher des Umbruchs - Die Anfangsjahre der Ersten Republik x - Bundesministerium ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Medienbegleitheft zum USB-Stick 14434
Wien 1918 –
Tagebücher des Umbruchs
Die Anfangsjahre der Ersten Republik
xWien 1918 – Tagebücher des Umbruchs Die Anfangsjahre der Ersten Republik Medienbegleitheft zum USB-Stick 14434 Ca. 46 Minuten, Produktionsjahr 2018
Impressum Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Medienservice 1010 Wien, Minoritenplatz 5 Tel.: +43 1 53 120-4830 FAX +43 1 53 120-81-4830 E-Mail: medienservice@bmbwf.gv.at Ausgearbeitet von: Dr. Klaus Madzak In Zusammenarbeit mit: Universität Wien Bibliotheks- und Archivwesen Arbeitsgruppe audiovisuelle Medien im Unterricht 1010 Wien, Universitätsring 1 Tel.: +43 1 4277-15116 E-Mail: ag_av-medien.ub@univie.ac.at Download unter: Link https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ugbm/medienservice/specials.html Ein wichtiger Hinweis zur Barrierefreiheit: Dieses medienbegleitende Arbeits- und Informationsheft dient ausschließlich als Handreichung für die Vor bereitung und Durchführung von Unterrichtseinheiten mit Medieneinsatz durch Studierende, durch Pädago ginnen und Pädagogen. Es ist zum Ausdrucken bestimmt und nicht als elektronisches Unterrichtsmaterial erarbeitet. Aus diesem Grund erfüllt es die Erfordernisse der Barrierefreiheit nicht. Bestellungen: AMEDIA Servicebüro 1030 Wien, Faradaygasse 6 Tel.: +43 1 982 13 22, Fax +43 1 982 13 22-311 E-Mail: office@amedia.co.at Verlags- und Herstellungsort: Wien, 2020
Inhalt
1 Einleitung..................................................................................................................... 8
1.1 Zur TV-Dokumentation ....................................................................................................... 8
1.2 Zum Unterrichtsmedium .................................................................................................. 10
1.2.1 Inhaltsangabe zum Film .......................................................................................... 10
1.2.2 Filmkapitel .............................................................................................................. 10
1.2.3 Einsatzempfehlung ................................................................................................. 10
1.2.4 Übersicht über die Arbeitsblätter und Kompetenzen zu den Filmkapiteln............ 11
1.3 Zum Einsatz des Begleitmaterials ..................................................................................... 12
1.3.1 Benötigtes Vorwissen ............................................................................................. 12
1.3.2 Informationen für Lehrkräfte zu den Arbeitsblättern M4–M14 ............................ 12
2 Verwendete und weiterführende Quellen, Literatur und Links................................... 16
2.1 TV-Dokumentation ........................................................................................................... 16
2.2 Über die Dokumentation .................................................................................................. 16
2.3 Begriffe ............................................................................................................................. 16
2.4 Personen ........................................................................................................................... 18
2.5 Biografien von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ................................................................. 18
3 Abbildungsnachweis .................................................................................................. 20
Anhang: Arbeitsmaterialien ................................................................................................ 22
Zeichenerklärungen .................................................................................................................... 22
M1 Glossar: Begriffe ............................................................................................................... 23
Antisemitenbund .............................................................................................................. 23
Arbeiter-und Soldatenräte ............................................................................................... 23
Frontkämpfervereinigung................................................................................................. 24
Genfer Sanierung (Genfer Protokolle).............................................................................. 24
Gründonnerstagputsch..................................................................................................... 24
Isonzofront ....................................................................................................................... 24
Lebensmittelkarten / Lebensmittelmarken...................................................................... 25
Monarchie ........................................................................................................................ 25Rädda Barnen ................................................................................................................... 25
Räterepublik ..................................................................................................................... 26
Reparationskommission ................................................................................................... 26
Republik ............................................................................................................................ 26
Rote Garde ........................................................................................................................ 27
Rotes Wien ....................................................................................................................... 27
Volkswehr ......................................................................................................................... 28
M2 Glossar: Personen ............................................................................................................. 28
Bosel Siegmund ................................................................................................................ 28
Castiglioni Camillo ............................................................................................................ 29
Karl I. (Österreich-Ungarn) ............................................................................................... 30
M3 Biografien der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.................................................................. 31
Elsa Björkman-Goldschmidt ............................................................................................. 31
Ludmilla Fiala .................................................................................................................... 31
Anton Hanausek ............................................................................................................... 32
Marianne Jarka ................................................................................................................. 32
Milena Jesenská ................................................................................................................ 33
Karl Kraus .......................................................................................................................... 34
Lotte Pirker ....................................................................................................................... 34
Alois Rezac ........................................................................................................................ 35
Karl Schovanez .................................................................................................................. 35
Leo Schuster ..................................................................................................................... 36
Stefan Zweig ..................................................................................................................... 37
M4 Der Krieg ist aus!? ............................................................................................................. 38
M5 Rollenspiel: Religion und Krieg ......................................................................................... 40
M6 Die Ausrufung der Republik – Neues Frauenbild ............................................................. 42
1. Lotte Pirker – eine Frau des 20. Jahrhunderts............................................................. 42
2. Alte und neue Rollenbilder .......................................................................................... 43
M7 Krieg und Kinder – Kriegsfolgen ....................................................................................... 45
M8 Die Not hat ihre eigenen Gesetze..................................................................................... 46M9 Wien feiert – Wien stirbt .................................................................................................. 48
M10 Die gespaltene Gesellschaft ............................................................................................. 51
1. Opportunismus ............................................................................................................ 51
2. Umgang mit der persönlichen Vergangenheit ............................................................ 52
M11 Dekonstruktion von Wahlplakaten................................................................................... 53
M12 Die Inflation und ihre Folgen ............................................................................................ 56
M13 Antisemitismus ................................................................................................................. 58
M14 Es geht bergauf / Das Rote Wien...................................................................................... 601 Einleitung
1.1 Zur TV-Dokumentation1
Gestern war noch Monarchie, heute ist Republik. Für die Menschen in
Wien – seit Jahrhunderten kaiserliche Residenzstadt – Erleichterung und
Schock zugleich. Alle Gewissheiten sind dahin, alte Hierarchien haben
sich umgedreht.2
Am 12. November 1918 wird in Wien die Republik ausgerufen. Es ist das Ende der Donaumo
narchie und des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn. Wien war bis dahin eine Weltstadt, das
politische Zentrum einer Großmacht und kulturell mindestens ebenso bedeutsam wie Paris,
Berlin und London.
Der folgende wirtschaftliche Zusammenbruch trifft die Hauptstadt besonders hart. Die notlei
dende Bevölkerung hungert und friert. Die rasante Inflation führt zu einer massenhaften Ver
armung der Bevölkerung.
Doch wenige Jahre später wird das Rote Wien unter sozialdemokratischer Führung mit fort
schrittlichen Schul-, Sozial- und Wohnprojekten eine Modellmetropole des frühen 20. Jahr
hunderts.
Trotz der gleichzeitig herrschenden Not ist Wien eine Stadt der Bälle, der Vergnügungen, der
Musik und des Theaters. Auch als Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft mit bedeuten
den Personen aus diesen Bereichen, wie zum Beispiel den Literaten Stefan Zweig und Robert
Musil, bleibt Wien weiterhin bestehen.
Wie aber erleben die einfachen Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten diese
Umbrüche und Wiedersprüche?
Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind mittlerweile verstorben, doch ihre Nachkommen haben
ihre Briefe, Tagebücher, Fotografien gesammelt und aufbewahrt. Sie erzählen von der Not
1
Vgl. ORF: Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs. Link (https://tv.orf.at/orf3/stories/2942626/), aufgerufen
am 12.12.2019, zusammengefasst Mag.a Evangelia Tzoukas, AG AV-Medien im Unterricht.
2
Ebd.
8und der Hoffnung, vom gebrochenen Selbstverständnis, von radikalen und aggressiven Reakti
onen und von idealistischen Ideen aus den Anfangsjahren der Ersten Republik.
Das Österreichische Filmarchiv und das Filmmuseum in Wien sind im Besitz von zahlreichen
Filmdokumenten, die Glanz und Elend dieser Zeit zeigen.3
Die Zitate aus der Dokumentation stammen unter anderem aus „Hungern – Hamstern – Heim
kehren: Erinnerungen an die Jahre 1918 bis 1921“ herausgegeben von Günter Müller und
Peter Eigner. In diesem Buch sind die persönlichen Erinnerungen und Tagebuchnotizen von
Kriegsheimkehrern, Zivilpersonen, Kindern, Jugendlichen und Ehefrauen gesammelt und ge
ben ein anschauliches Bild von dieser Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der materiel
len Not. 4
3
Vgl. Ebd.
4
Siehe: Eigner, Peter & Müller, Günter [Hg.]: Hungern – Hamstern – Heimkehrern. Erinnerungen an die Jahre
1918–1921. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 2017. PDF online.
Link (https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representation/zd_std_o
rig__zd_schw_orig/041/264/423/9783205206569_table_of_content_pdf_1.pdf), aufgerufen am 06.10.2019.
91.2 Zum Unterrichtsmedium
1.2.1 Inhaltsangabe zum Film
Am 12. November 1918 verliert Wien mit der Ausrufung der Republik ihre Stellung als Haupt
stadt eines riesigen Vielvölkerstaates. Die verarmte Bevölkerung hungert und revoltiert. Die
Eliten fahren mit ihrem imperialen Gehabe fort, als sei nichts geschehen. Wie erleben sie, wie
die einfachen Menschen die Brüche und Widersprüche? Anhand von Lebensgeschichten aus
allen Bevölkerungsschichten und neu restaurierten Materialien aus dem Filmmuseum zeigt
der Film das gebrochene Selbstverständnis, das Elend und den Glanz der Stadt Wien vor 100
Jahren, eine Zeitenwende voller Dramatik, die die Stadt bis heute prägt.5
1.2.2 Filmkapitel
Kapitel 1: Intro
Kapitel 2: Das Ende des Ersten Weltkriegs 1918
Kapitel 3: 12. November 1918: Ausrufung der Republik
Kapitel 4: Die Folgen des Krieges – die Bevölkerung hungert und friert
Kapitel 5: Wien feiert – Wien stirbt
Kapitel 6: Die gespaltene Gesellschaft
Kapitel 7: Die Inflation und ihre Folgen
Kapitel 8: Antisemitismus
Kapitel 9: Es geht bergauf / Das Rote Wien
1.2.3 Einsatzempfehlung
Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung (Mittelstufe, Oberstufe)
Erwachsenenbildung
5
Beringer, Peter, Synopsis zum Film Wien 2018, 2017.
101.2.4 Übersicht über die Arbeitsblätter und Kompetenzen zu den Filmkapiteln
Im Anhang befinden sich folgende Module mit Arbeitsblättern zum Ausrucken.
Arbeitsblatt Historische Kompetenzen Zu Filmkapitel
M4 Der Krieg ist aus!? Methodenkompetenzen: Kapitel 2: Das Ende des Ersten
Rekonstruktion, Dekonstruktion Weltkriegs 1918
M5 Rollenspiel: Religion und Krieg Methodenkompetenzen: Kapitel 2: Das Ende des Ersten
Rekonstruktion, Dekonstruktion Weltkriegs 1918
M6 Die Ausrufung der Republik – Methodenkompetenz: Kapitel 3: 12. November 1918:
Neues Frauenbild Dekonstruktion Ausrufung der Republik
M7 Krieg und Kinder – Methodenkompetenzen: Kapitel 4: Die Folgen des Krieges –
Kriegsfolgen Rekonstruktion, Dekonstruktion; die Bevölkerung hungert und friert
Historische Orientierungskompe
tenz
M8 Die Not hat ihre eigenen Ge Methodenkompetenzen: Kapitel 4: Die Folgen des Krieges –
setze Rekonstruktion, Dekonstruktion; die Bevölkerung hungert und friert
Historische Orientierungskompe
tenz
M9 Wien feiert – Wien stirbt Methodenkompetenzen: Kapitel 5: Wien feiert – Wien
Rekonstruktion, Dekonstruktion; stirbt
Historische Orientierungskompe
tenz
M10 Die gespaltene Gesellschaft Methodenkompetenzen: Kapitel 6: Die Gespaltene Gesell
Rekonstruktion, Dekonstruktion; schaft
Historische Orientierungskompe
tenz
M11 Dekonstruktion von Wahl Methodenkompetenzen: Kapitel 6: Die Gespaltene Gesell
plakaten Rekonstruktion, Dekonstruktion; schaft
Historische Orientierungskompe
tenz
M12 Die Inflation und ihre Folgen Methodenkompetenz: Kapitel 7: Die Inflation und ihre
Rekonstruktion; Folgen
Historische Orientierungskompe
tenz
M13 Antisemitismus Methodenkompetenz: Kapitel 8: Antisemitismus
Dekonstruktion
M14 Es geht bergauf / Das Rote Methodenkompetenzen: Kapitel 9: Es geht bergauf /
Wien Rekonstruktion, Dekonstruktion; Das Rote Wien
Historische Orientierungskompe
tenz
111.3 Zum Einsatz des Begleitmaterials
1.3.1 Benötigtes Vorwissen
Die Schüler/innen sollten sich zum besseren Verständnis der Inhalte der Dokumentation im
Vorfeld bereits mit der Thematik des Films (Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen, Aus
rufung der Republik, Zwischenkriegszeit in Österreich) befasst haben.
Im Arbeitsmaterial im Anhang findet man Informationen zu wichtigen Begriffen (M1) und Per
sonen (M2), die in der Dokumentation angesprochen werden, sowie kurze Biografien (M3) zu
den genannten Zeitzeug/inn/en, von denen die Texte aus dem Film stammen.
Die Schüler/innen sollten zudem auf das kritische Arbeiten mit Film-Dokumentationen vorbe
reitet werden.
1.3.2 Informationen für Lehrkräfte zu den Arbeitsblättern M4–M14
M4: Der Krieg ist aus!?
Die Schüler/innen sollen versuchen, sich in die Lage der jeweiligen Personen hineinzuverset
zen, aber auch die Sichtweise des Gegenübers zu verstehen.
M5: Rollenspiel: Religion und Krieg
Karl Schovanez befindet sich mit all seinen Kriegserfahrungen in einer Ausnahmesituation und
wird mit einem Vertreter der Kirche konfrontiert, der in seinem augenblicklichen Weltbild kei
nen Platz hat. Prinzipiell geht es auch um die Frage – Religion und Krieg. Welche Rolle spielt
die Religion bzw. deren Vertreter/innen im Krieg?
Auch hier sollen die Schüler/innen versuchen, sich in die Lage der jeweiligen Person (eigene
Rolle) hineinzuversetzen, aber auch die Sichtweise des Gegenübers zu verstehen.
M6: Die Ausrufung der Republik – Neues Frauenbild
Im Gegensatz zum Bild der „typischen Hausfrau“ zeigt sich Lotte Pirker auf der abgebildeten
Fotografie als selbstbewusste Frau mit Zigarette.
12Die Schüler/innen sollen die unterschiedlichen Frauenbilder und die politische Emanzipation
zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausarbeiten.
M7: Krieg und Kinder – Kriegsfolgen
Die Schüler/innen sollen sich mit der Subjektivität von Medienberichten auseinandersetzen.
Sie haben nur drei Informationsquellen zur Verfügung und sollen daraus einen möglichst ob
jektiven Bericht verfassen. Die Frage lautet – wie weit können sie sich von Bild und Text lösen
bzw. ihre eigenen Sichtweise ausblenden. In Summe geht es um die Frage von objektivem
Journalismus.
M8: Die Not hat ihre eigenen Gesetze
Die Schüler/innen sollen der Frage nachgehen, wie weit Notsituationen und gesetzliche Rege
lungen kompatibel sind.
Sie haben zu entscheiden: Sollen notleidende Kinder und alte, mittelose Menschen, die gegen
das Gesetz verstoßen, zur Rechenschaft gezogen werden? Wie verhält es sich mit Schleich
händlern und Hamsterern?
M9: Wien feiert – Wien stirbt
Die Schüler/innen sollen sich mit den unterschiedlichen Lebensbereichen von damals und
heute auseinandersetzen und sich persönlich die Frage stellen: Wie gehe ich mit meinem
Wohlstand um? Wie reagiere ich auf Armut, z.B. Obdachlose bzw. Bettler/innen auf der
Straße?
M10: Gespaltene Gesellschaft
1. Opportunismus
Die Schüler/innen sollen der Frage nachgehen, wie weit mit dem Strom schwimmen als ver
ständlich erscheint.
2. Umgang mit der eigenen Vergangenheit
Anhand eines Zitats von Stefan Zweig sollen sich die Schüler/innen in die Situation von ehema
ligen Untertanen versetzen, die auf das abgedankte Kaiserpaar treffen. Wie würden sie selbst
in einer solchen Situation reagieren?
13M11: Dekonstruktion von Wahlplakaten
Aufgabe 1
Die Schüler/innen sollen befähigt werden, politische Botschaften von Wahlplakaten zu ent
schlüsseln und sie in einen Zusammenhang zu den politischen Verhältnissen zu stellen. Sie sol
len lernen, die Subjektivität der Aussagen von Zeitzeug/inn/en zu dekonstruieren.
Aufgabe 2
Es geht um die Frage der politischen Gewalt:
Der Zeitzeuge Alois Liptak beschreibt, dass auf einmal aus der Menge ohne jeden Grund auf
die Polizei geschossen wurde. Damit bezieht er Stellung. Er stellt sich auf die Seite der Polizei
und gegen die „Jungen Burschen“ (Demonstranten).
„Auf einmal wurde aus der Menge ohne jeden Grund auf die Polizei, die
das Parlament besetzt hielt, geschossen. Junge Burschen machten Barrika
den und warfen Steine in die Fenster des Abgeordnetenhauses und schos
sen.“ (Alois Liptak)
Die Schüler/innen sollen sich selbst die Frage nach der Legitimität von politischer Gewalt stel
len.
M12: Die Inflation und ihre Folgen
Die Schüler/innen sollen die Auswirkungen von Geldentwertung herausarbeiten und auch den
Unterschied zwischen einer inflationären und einer stabilen Währung erkennen.
M13: Antisemitismus
Aufgabe 1
Die Schüler/innen sollen in der Lage sein, eine Karikatur nach ihrer Gestaltung und ihrer Bot
schaft zu analysieren.
Aufgabe 2
Es geht um die Frage von Vorurteilen und persönlichen Sichtweisen, die möglicherweise auf
dem subjektiven Gefühl, zu den gesellschaftlichen Verlierern zu gehören, basieren. Verlierer
suchen oft einen Sündenbock, dem sie die Verantwortung für das eigene Schicksal übertragen
können. (Der Jud‘ ist schuld!)
14M14 Es geht bergauf / Das Rote Wien
Aufgabe 1
Die Schüler/innen sollen den Unterschied zwischen damals und heute unter dem Aspekt „was
damals Lust und Freude bereitete, ist heute selbstverständlich“ herausarbeiten.
Gemeindebauten waren eine Errungenschaft des Roten Wiens. Sie hatten eine bewusst ge
wählte Architektur, die das neue Selbstbewusstsein der Arbeiterschaft wiedergeben sollte.
Die Gemeindebauten der Zwischenkriegszeit waren zugleich ein politisches Programm, das
sich so in den heutigen Gemeindebauten nicht mehr findet. Die Schüler/innen sollen die Un
terschiede herausarbeiten und in einen historischen Zusammenhang setzten.
152 Verwendete und weiterführende
Quellen, Literatur und Links
2.1 TV-Dokumentation
Wien 1918. Tagebücher des Umbruchs. TV-Dokumentation. Eine Koproduktion von Epo-Film
Wien / Graz mit ORF III & BMBWF, Buch & Regie: Peter Beringer. 2018.
2.2 Über die Dokumentation
Beringer, Peter: Wien 2018. Tagebücher des Umbruchs. Synopsis zum Film. 2017.
ORF: Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs. Link (https://tv.orf.at/orf3/stories/2942626/),
aufgerufen am 12.12.2019.
2.3 Begriffe
AEIOU Österreich Lexikon: Frontkämpfervereinigung
Link (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f892608.htm), aufgerufen am 14.10.2019.
AEIOU Österreich Lexikon: Genfer Protokolle
Link (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g250642.htm), aufgerufen am 14.10.2019.
dasrotewien.at – Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie: Kommunaler Wohnbau. Auch Ge
meinde(wohn)bau
Link (http://www.dasrotewien.at/seite/kommunaler-wohnbau), aufgerufen am 16.12.2019.
Duden: Opportunismus. Link (https://www.duden.de/rechtschreibung/Opportunismus), auf
gerufen am 16.12.2019.
Polit Lexikon für junge Leute: Republik
Link (http://www.politik-lexikon.at/republik/), aufgerufen am 12.10.2019.
16Wien Geschichte Wiki: Volkswehr
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Volkswehr), aufgerufen am 09.01.2020.
Wikipedia: Antisemitenbund
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitenbund), aufgerufen am 14.10.2019.
Wikipedia: Lebensmittelmarke
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelmarke), aufgerufen am 12.10.2019.
Wikipedia: Rädda Barnen
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Rädda_Barnen), aufgerufen am 12.10.2019.
Wikipedia: Räterepublik
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Räterepublik), aufgerufen am 13.10.2019.
Wikipedia: Reparationskommission
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Reparationskommission), aufgerufen am 13.10.2019.
Wien Geschichte Wiki: Rote Garde
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rote_Garde), aufgerufen am 12.10.2019.
Wikipedia: Rotes Wien
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Wien), aufgerufen am 12.10.2019.
Poti miru: Die Isonzofront
Link (http://www.potmiru.si/deu/opis-soske-fronte/), aufgerufen am 12.10.2019.
Zeitklicks.de: Was sind Arbeiter- und Soldatenräte? Was ist eine Räterepublik?
Link (https://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/zeitklicks/zeit/13/typisch-weimar/was-
sind-arbeiter-und-soldatenraete-was-ist-eine-raeterepublik), aufgerufen am 14.01.2020.
172.4 Personen
Camillo Castiglioni
Wien Geschichte Wiki: Camillo Castiglioni
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Camillo_Castiglioni), aufgerufen am 14.10.2019.
Wikipedia: Camillo Castiglioni
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Camillo_Castiglioni), aufgerufen am 14.10.2019.
Kaiser Karl I.
Die Welt der Habsburger: Karl I. als Thronfolger und Monarch
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/karl-i-als-thronfolger-und-monarch), aufgerufen
am 14.10.2019.
Die Welt der Habsburger: Kaiser Karl der Letzte – Entmachtung und Exil
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/kaiser-karl-der-letzte-entmachtung-und-exil),
aufgerufen am 14.10.2019.
Die Welt der Habsburger: Kaiser Karl I. – Kindheit, Ausbildung und Familie
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/kaiser-karl-i-kindheit-ausbildung-und-familie),
aufgerufen am 14.10.2019.
Siegmund Bosel
Wikipedia: Siegmund Bosel
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Bosel), aufgerufen am 14.10.2019.
2.5 Biografien von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen
Alois Rezac, Anton Hanausek, Elsa Björkman-Goldschmidt, Karl Schovanez, Leo Schuster,
Ludmilla Fiala
Eigner, Peter & Müller, Günter [Hg.]: Hungern – Hamstern – Heimkehrern. Erinnerungen an
die Jahre 1918–1921. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 2017. PDF online.
Link (https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/represen
tation/zd_std_orig__zd_schw_orig/041/264/423/9783205206569_table_of_con
tent_pdf_1.pdf), aufgerufen am 06.10.2019.
18Karl Kraus
AEIOU Österreich Lexikon: Karl Kraus
Link (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.k/k774193.htm), aufgerufen am 12.10.2019.
Lotte Pirker
Wien Geschichte Wiki: Lotte Pirker
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Lotte_Pirker), aufgerufen am 06.10.2019.
Wiener Zeitung.at vom 07.04.2018: 100 Jahre Tagebuch: Als vor dem Parlament die Republik
geboren wurde. Lotte Pirker (1877-1963), über den 12. November 1918. Ein Beitrag der Doku
Lebensgeschichten, Universität Wien.
Link (https://www.wienerzeitung.at/themen/100-jahre-republik/100-jahre-republik-tage
buch/957194-Als-vor-dem-Parlament-die-Republik-geboren-wurde.html), aufgerufen am
06.10.2019.
Stefan Zweig
Projekt Gutenberg-DE: Stefan Zweig
Link (https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/zweig.html), aufgerufen am
09.10.2019.
Marianne Jarka
Salm-Reifferscheidt, Franziska: Frauen in der Kriegskrankenpflege im Ersten Weltkrieg am Bei
spiel der Rotkreuzschwester Marianne Jarka. Diplomarbeit. Universität Wien. Wien: 2010. S.
56–61. PDF online.
Link (http://othes.univie.ac.at/8208/1/2010-01-13_0104971.pdf), aufgerufen am 05.10.2919.
Melina Jesenská
Wikipedia: Melina Jesenská
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Milena_Jesenská), aufgerufen am 07.10.2019
193 Abbildungsnachweis
Deckblatt / Coverbild: Collage aus Screenshots aus der TV-Dokumentation Wien 1918 – Tage
bücher des Umbruchs. Eine Koproduktion von Epo-Film Wien / Graz mit ORF III & BMBWF,
2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019.
Abbildung 1: Collage aus Screenshots aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019. 38
Abbildung 2: Collage aus Screenshots aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019. 40
Abbildung 3: Collage aus Screenshots aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019. 40
Abbildung 4: Lotte Pirker. Screenshot aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018. 42
Abbildung 5: Screenshot aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs,
Epo-Film, 2018. 44
Abbildung 6: Collage aus Screenshots aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019. 45
Abbildung 7: Collage aus Screenshots aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des
Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im Unterricht, 2019. 46
Abbildung 8: Screenshot aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs, Epo-Film,
2018. 47
Abbildung 9: Wien feiert – Wien stirbt. Collage aus Screenshots aus dem Film Wien
1918 – Tagebücher des Umbruchs, Epo-Film, 2018, bearbeitet AG AV-Medien im
Unterricht, 2019. 49
20Abbildung 10: Wählt sozialdemokratisch. Wahlwerbung Nationalratswahl 1920
(17.10.1920), Österreich. Lithographie, Urheber: Mihály Biró, Wien, 1920.
Militärgeographisches Institut. Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Quelle: ÖNB Digitale
Sammlung Plakate Inventarnr. PLA16304310. ÖNB Bildarchiv Austria. Link
(http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=15823551),
abgerufen 14.01.2020. 53
Abbildung 11: Gegen die Einheitsfront des Kapitalismus. Wahlwerbung, Nationalratswahl
1920 (17.10.1920), Österreich. Lithographie, Urheber: Mihály Biró, Wien, 1920.
Militärgeographisches Institut. Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Quelle: ÖNB Digitale
Sammlung Plakate Inventarnr. PLA16304318. ÖNB Bildarchiv Austria.
Link (http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=15823599),
abgerufen 14.01.2020. 53
Abbildung 12: Seipels Sanierung Wahlwerbung. Screenshot aus dem Film Wien 1918 –
Tagebücher des Umbruchs, Epo-Film, 2018. 58
Abbildung 13: Karl-Marx-Hof, Wien 1190, längster Gemeindebau der Welt, Bauzeit: 1927
bis 1933. Screenshot aus dem Film Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs, Epo-Film,
2018. 61
Abbildung 14: CUUUBE BAG2, Wien Berresgasse, Gemeindewohnungen NEU. Geplanter
Bezug: September 2021. Bildquelle: © Nerma Linsberger ZTGmbH. 61
21Anhang: Arbeitsmaterialien Die Arbeitsmaterialien im Anhang sind als Kopiervorlage für den Ausdruck in Klassenstärke ge dacht. Sie sind nicht als elektronisches Unterrichtsmaterial erarbeitet. Aus diesem Grund erfüllen sie die Erfordernisse der Barrierefreiheit nicht. Die Formatierung wurde an die inhaltlichen und didaktischen Anforderungen für Arbeitsmate rialien für Schüler/innen angepasst. Sämtliche Quellangaben befinden sich auch im Literatur- und Abbildungsverzeichnis. Zeichenerklärungen
M1 Glossar: Begriffe
Antisemitenbund
Der Antisemitenbund wurde vom christlichsozialen Politiker Anton Jerzabek 1919 in
Wien gegründet. Diese antisemitische und überparteiliche Sammelbewegung hatte
anfangs ihren Sitz in Gersthof (Schindlergasse 20), später in Salzburg.
In der Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg veranstaltete der Antisemitenbund meh
rere Massenveranstaltungen in Wien und anderen Landesteilen, wo Redner […] die
Ausweisung der Ostjuden verlangten und den Kommunismus als von Juden getragen
darstellten. 1921 forderte der Antisemitenbund die Erstellung eines Judenkatasters
für Wien. Speziell in Tirol, wo ohnehin sehr wenige Juden lebten, wurden sehr extre-
me antisemitische Forderungen gestellt, wie ein weitreichendes Berufsverbot, Verbot
des Land- und Hauskaufs, Verbot des Holz- und Viehhandels etc. Als die wirtschaftli
che und politische Krise 1923/24 allmählich überwunden wurde, verlor der Antise
mitenbund viel von seiner Anziehungskraft.
Der Bund wurde zu Beginn des Austrofaschismus 1933 vom autoritären Ständestaat
offiziell verboten, da er als Verein der NSDAP galt, durfte er aber seine Tätigkeit wei
ter ausüben. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 wurde der Bund aufgelöst. […]
Quelle: Wikipedia: Antisemitenbund
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitenbund), aufgerufen am 14.10.2019.
Arbeiter-und Soldatenräte
Arbeiter- bzw. Soldatenräte sind direkt von den Arbeiter/inne/n bzw. Soldat/inn/en in
den Fabriken bzw. Kasernen gewählte Vertreter/innen (nach dem Vorbild der russi
schen Revolution-Sowjets = Räte), abseits von politischen Parteien.
Gewählt werden mehrere Personen aus den eigenen Reihen in einen Rat, der wiede
rum seine Gesandten in die nächste höhere Ebene schickt. Ganz oben steht ein Zen
tralrat. Er ist Gesetzgeber, Regierung und Gericht in einem. Es gibt keine Gewalten
teilung.
Quelle: Vgl. Zeitklicks.de: Was sind Arbeiter- und Soldatenräte? Was ist eine Räterepublik?
Link (https://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/zeitklicks/zeit/13/typisch-weimar/was-sind-
arbeiter-und-soldatenraete-was-ist-eine-raeterepublik), aufgerufen am 14.01.2020.
23Frontkämpfervereinigung
[Die] Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs war eine 1920 […] gegründete
Organisation ehemaliger Frontsoldaten der k. u. k. Armee; ein relativ kleiner paramili
tärischer Verband der Rechten (1933: 2000–3000 Mann) mit hohem Offiziersanteil;
[Sie fungierte als] antisemitische, antimarxistische und antidemokratische Schutz
truppe bei christlichsozialen, großdeutschen und nationalsozialistischen Versammlun
gen. Historisch bedeutsam wurde die Organisation durch den Zusammenstoß von
Schattendorf, bei dem 1927 zwei Menschen von Frontkämpfern getötet wurden. Der
Prozess gegen die Täter endete mit Freisprüchen, was wiederum die große Demonst
ration vom 15.7.1927 und den Justizpalastbrand auslöste. Die Frontkämpfervereini
gung Deutsch-Österreichs wurde 1935 aufgelöst. […]
Quelle: AEIOU Österreich Lexikon: Frontkämpfervereinigung
Link (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f892608.htm), aufgerufen am 14.10.2019.
Genfer Sanierung (Genfer Protokolle)
[Die] Genfer Protokolle sind, auf Initiative des Völkerbunds am 4.10.1922 geschlosse
ner Staatsvertrag zwischen Österreich einerseits und Großbritannien, Frankreich, Ita
lien und der ČSR andererseits. Österreich erhielt eine auf 20 Jahre befristete Völker
bundanleihe (circa 650 Millionen Goldkronen), die die Beendigung der Nachkriegsin
flation durch Einführung der Schillingwährung […] ermöglichte und verpflichtete sich
zur Aufrechterhaltung seiner Unabhängigkeit. Die Vertragspartner garantierten die
österreichische Integrität. […]
Quelle: AEIOU Österreich Lexikon: Genfer Protokolle
Link (http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g250642.htm), aufgerufen am 14.10.2019.
Gründonnerstagputsch
Der Begriff bezeichnet die kommunistischen Unruhen in Wien vom 17. April 1919. Ein Angriff
auf das Parlament wird von der Polizei zurückgeschlagen, mit einer Bilanz von fünf toten und
36 verletzten Polizisten sowie zehn verletzten Volkswehrmännern.
Isonzofront
[…] Italien erklärte am 23. Mai 1915 Österreich-Ungarn den Krieg. So wurde die Süd
westfront eröffnet, die 600 km lang war. Sie verlief vom Pass des Stilfser Jochs im
schweizerisch-italienisch-österreichischen Grenzdreieck über Tirol, den Karnischen
Alpen und dem Sočatal bis zum Adriatischen Meer. Der 90 km lange Frontabschnitt,
24der am Sočafluss (Isonzo) entlanglief, vom Rombon bis zum Adriatischen Meer, war
die Isonzofront. […]
Quelle: Poti miru: Die Isonzofront
Link (http://www.potmiru.si/deu/opis-soske-fronte/), aufgerufen am 12.10.2019.
Lebensmittelkarten / Lebensmittelmarken
Eine Lebensmittelmarke ist ein von der öffentlichen Hand ausgegebenes Dokument
zur Bescheinigung, dass der Besitzer ein bestimmtes Lebensmittel in einer bestimm
ten Menge kaufen darf. Lebensmittelmarken werden in der Regel in Notzeiten, vor
allem im Krieg, an die Bevölkerung ausgegeben, um den allgemeinen Mangel an Kon
sumgütern besser verwalten zu können. Die Marken sind in Lebensmittelkarten zu
sammengefasst.
Quelle: Wikipedia: Lebensmittelmarke
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelmarke), aufgerufen am 12.10.2019.
Monarchie
An der Spitze einer Monarchie steht ein König oder Kaiser (oder eine Königin – wie in Großbri
tannien – oder eine Kaiserin). Monarchen bzw. Monarchinnen hatten unumschränkte politi
sche Rechte. Sie waren die mächtigsten Personen im jeweiligen Reich (deshalb auch der
Name: Monarch heißt übersetzt so viel wie ein Herrscher). Sie leiteten ihre Macht als Begrün
dung für ihre Herrschaftsansprüche direkt von Gott ab (Gottesgnadentum).
Rädda Barnen
Rädda Barnen (schwed. für Rettet die Kinder) ist eine schwedische Hilfsorganisation
für Kinder und Mitglied der International Save the Children Alliance […]. Unter dem
Eindruck des Ersten Weltkriegs und der russischen Revolution wurde im Mai 1919
Save the Children in England gegründet […]. Folgende Grundsätze formulierte sie für
diese Arbeit:
Die einzige internationale Sprache ist das Weinen eines Kindes. Alle Kriege richten
sich gegen Kinder. Wir achten nicht auf Politik, Rasse oder Religion. Ein Kind ist ein
Kind, ob es rot, weiß, braun oder schwarz ist. Jeder ist dafür verantwortlich, wie es
den Kindern in der Welt ergeht.
Ab 1919 leitete Elsa Björkman die Aktivitäten von Rädda Barnen in Wien. 1923 wurde
die schwedische Nachkriegshilfe für Wien beendet. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs war Rädda Barnen im Rahmen der Schwedenhilfe wieder in Wien aktiv.
25Im Jahr 1950 wurde in Wien Favoriten (10. Bezirk) der Rädda-Barnen-Platz nach dem
Hilfswerk benannt.
Quelle: Wikipedia: Rädda Barnen
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Rädda_Barnen), aufgerufen am 12.10.2019.
Räterepublik
Eine Räterepublik oder Rätedemokratie ist ein politisches System, bei dem über ein
Stufensystem sogenannte Räte gewählt werden. Die Räte sind direkt verantwortlich
und an die Weisungen ihrer Wähler gebunden. Räte können demgemäß von ihrem
Posten jederzeit abberufen oder abgewählt werden […].
In einer Räterepublik sind die Wähler in Basiseinheiten organisiert, beispielsweise die
Arbeiter eines Betriebes, die Bewohner eines Bezirkes oder die Soldaten einer Ka
serne. Sie entsenden direkt die Räte als öffentliche Funktionsträger, die Gesetzgeber,
Regierung und Gerichte in einem bilden. […]
Quelle: Wikipedia: Räterepublik
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Räterepublik), aufgerufen am 13.10.2019.
Reparationskommission
Die Reparationskommission, im Vertragstext Wiedergutmachungsausschuss genannt,
war ein nach dem Ersten Weltkrieg mit Vertretern der Entente besetzter fünfköpfiger
Ausschuss […]. Die Befugnisse der Kommission waren weitreichend: In ihrer Hand lag
die Überwachung und Auslegung der Bestimmungen des Friedensvertrages von Ver
sailles. […] Zunächst wurde durch die Kommission die Gesamthöhe der Reparation be
schlossen und ein Zahlungsplan aufgestellt […].
Die Reparationskommission war gemäß Artikel 179 des Vertrags von Saint Germain
auch für die Festsetzung der Reparationen Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg zu
ständig. […]
Quelle: Wikipedia: Reparationskommission.
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Reparationskommission), aufgerufen am 13.10.2019.
Republik
Das lateinische res publica bedeutet auf Deutsch öffentliche Sache, aber auch Staat
bzw. Staatsgewalt. Eine Republik ist demnach ein Staat, in dem die verschiedenen
26Staatsgewalten eine Angelegenheit der gesamten Gesellschaft sind (Gewaltenteilung
/ Gewaltentrennung). Die Wähler und Wählerinnen bestimmen bei den Wahlen, wer
regieren darf oder wer im Parlament sitzen soll. In der jeweiligen Verfassung ist das
genau geregelt. […]
Quelle: Polit Lexikon für junge Leute: Republik
Link (http://www.politik-lexikon.at/republik/), aufgerufen am 12.10.2019.
Rote Garde
Die Rote Grade ist eine von Korporal Haller (eigentlich: Bernhard Förster) und Egon
Erwin Kisch am 31. Oktober 1918 gegründete linke Wehrgruppe. Sie strebte eine
Rätediktatur nach russischem Vorbild an (Rätebewegung). Sie war aber keine Wehr
formation der KPDÖ (Kommunistische Partei Deutschösterreich). Die Rote Garde
schlug ihr Quartier in der Stiftkaserne auf und wurde am 4. November 1918 in die
staatliche Volkswehr (als Bataillon 41) eingegliedert.
Aufgelöst wurde die Rote Garde am 27. August 1919 durch den damaligen Staatssek
retär für Heerwesen Dr. Julius Deutsch (SDPDÖ).
Quelle: Vgl. Wien Geschichte Wiki: Rote Garde
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rote_Garde), aufgerufen am 12.10.2019.
Rotes Wien
Als Rotes Wien bezeichnet man die Zeit von 1919 bis 1934, als die Sozialdemokrati
sche Arbeiterpartei Deutschösterreichs bei den Wahlen zum Landtag und Gemeinde
rat in Wien wiederholt die absolute Mehrheit erreichte.
Die sozialdemokratische Kommunalpolitik dieser Jahre war geprägt von umfassenden
sozialen Wohnbauprojekten und von einer Finanzpolitik, die neben dem Wohnbau
auch umfangreiche Reformen in der Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik unter
stützen sollte. Die Sozialdemokratie bildete durch ihre Stellung in Wien […] einen Ge
genpol zur Politik der Christlichsozialen Partei (CS), die damals in den anderen Bun
desländern und auf Bundesebene regierte.
Das ‚Rote Wien‘ endete 1934, als Bürgermeister Karl Seitz infolge des österreichi
schen Bürgerkrieges seines Amtes enthoben und verhaftet wurde und die aus der CS
hervorgegangene Vaterländische Front (VF) auch in Wien die Macht übernahm.1
Quelle: Vgl. Wikipedia: Rotes Wien
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Wien), aufgerufen am 12.10.2019. 1Ebd.
27Volkswehr
Nach der Auflösung der k. u. k. Armee im Oktober 1918 wurde am 3. November 1918
mit dem Erlass des Staatsamtes für Heerwesen eine Freiwilligenarmee gegründet –
der Volkswehr.
Erforderlich für den Eintritt in der Volkswehr war ein Bekenntnis zur Republik
Deutschösterreich. Die Macht innerhalb der Volkswehr lag in den Händen der Solda
tenräte.
Ihr Ende fand die Deutschösterreichische Volkswehr im Vertrag von Saint-Germain-
en-Laye, der Österreich nur ein Berufsheer von 30.000 Mann gestattete und dem mit
dem Wehrgesetz vom 18.3.1920 entsprochen wurde.
Quelle: Vgl. Wien Geschichte Wiki: Volkswehr.
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Volkswehr), aufgerufen am 09.01.2020.
M2 Glossar: Personen
Bosel Siegmund
Siegmund Bosel, auch Sigmund, (geboren 10. Jänner 1893 in Wien; gestorben am 8.
Februar 1942 oder 8. April 1945) war ein österreichischer Großkaufmann, Bankier und
Börsenspekulant, der eine bedeutende, aber umstrittene Rolle im Wirtschaftsleben in
der Ersten Republik spielte.
Der in Wien geborene Textilkaufmann jüdischer Herkunft arbeitete sich während des
Ersten Weltkriegs zum größten Heereslieferanten hoch. Während der Nachkriegsinfla
tion bewahrte und vergrößerte Bosel durch gewagte Börsengeschäfte sein Vermögen,
übernahm 1923 die Union-Bank und wurde kurzfristig zu einem der reichsten Männer
des Landes.
[…] Nach dem Anschluss Österreichs wurde Bosel auch aus rassischen Gründen ver
folgt. Unter anderem wurde die gesamte Einrichtung seiner Villa in Wien-Hietzing
(Gloriettegasse 17–19) auf Anordnung des Exekutionsgerichtes am 14. und 15. Juli
1938 im Wiener Dorotheum versteigert.
Über Bosels Tod gibt es widersprüchliche Angaben. Das Todesdatum 1945 findet sich
im Österreichischen Personenlexikon. Nach anderen Angaben soll der SS-Führer Alois
Brunner Bosel im Februar 1942 anlässlich der Deportation der Wiener Juden nach
Riga erschossen haben.
28Quelle: Wikipedia: Siegmund Bosel
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Bosel), aufgerufen am 14.10.2019.
Castiglioni Camillo
Der Sohn [geb. 1879 in Triest, gest. 1957 in Rom] eines Triestiner Mathematiklehrers
und späterem Rabbiners erlebte in jungen Jahren als Export-/Importkaufmann in der
Gummiindustrie eine steile Karriere. Im Jahr 1902 wurde er von den Österreichisch-
Amerikanischen Gummiwerken (später Semperit) von Istanbul nach Wien berufen,
wo er schon 1909 zum Direktor aufstieg. Die Gummiwerke vertrieben vor allem Auto
reifen, was ihn der Auto- und Flugzeugindustrie näherbrachte.
[…] Schon vor Kriegsbeginn trat Castiglioni als Direktor der Semperit AG zurück. Er
widmete sich nun ganz eigenen Geschäften. […] Bei Kriegsende zählte Castiglioni be
reits zu den sehr reichen Männern seiner Zeit. […] Zur Figur öffentlichen Interesses
wurde der Unternehmer und Finanzmann jedoch erst nach Kriegsende. […]
Castiglioni kontrollierte in der Nachkriegszeit eine ihm hörige Presse und trat als Wis
senschafts- und Kunstmäzen auf.1
Fehlspekulationen ließen in der Folge das aufgebaute Vermögensimperium wieder
weitgehend schwinden; […] In der Folge verlegte Camillo Castiglioni seine Aktivitäten
zunächst nach Berlin und später nach Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er
aber auch für die jugoslawische Regierung tätig.2
1
Quelle: Wien Geschichte Wiki: Camillo Castiglioni
Link (https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Camillo_Castiglioni), aufgerufen am 14.10.2019.
2
Quelle: Wikipedia: Camillo Castiglioni
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Camillo_Castiglioni), aufgerufen am 14.10.2019.
29Karl I. (Österreich-Ungarn)
Karl wurde als ältester Sohn von Erzherzog Otto und Maria Josefa von Sachsen am 17.
August 1887 auf Schloss Persenbeug (NÖ) geboren.1
Durch das Attentat von Sarajewo, dem der Thronfolger Franz Ferdinand zum Opfer
fiel, rückte Karl früher als erwartet in die Position des Thronfolgers auf.
[…] Nach dem Tod Kaiser Franz Josephs im November 1916 bestieg Karl mit 29 Jahren
den Thron.2
Im Herbst 1918 begann die Auflösung der Monarchie, der der politisch isolierte und
machtlose Kaiser nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
[…] Am 11. November 1918 unterschrieb Karl, dem de facto längst die Macht abhan
dengekommen war, in Schloss Schönbrunn schließlich eine Erklärung, in der er auf
jegliche Beteiligung an den Regierungsgeschäften in der österreichischen Reichshälfte
verzichtete. Karl weigerte sich jedoch abzudanken, da er sich von der göttlichen Vor
sehung (von Gottes Gnaden) mit der Funktion des Monarchen betraut sah, und nicht
durch den Willen einer Volksvertretung. […]
[Kaiser Karl ging 1919 ins Exil in die Schweiz bzw.1921 nach Madeira], wo er am
1. April 1922 im Alter von nur 35 Jahren an der Spanischen Grippe verstarb.3
1
Quelle: Die Welt der Habsburger: Kaiser Karl I. – Kindheit, Ausbildung und Familie
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/kaiser-karl-i-kindheit-ausbildung-und-familie), auf
gerufen am 14.10.2019.
2
Quelle: Die Welt der Habsburger: Karl I. als Thronfolger und Monarch
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/karl-i-als-thronfolger-und-monarch), aufgerufen
am 14.10.2019.
3
Quelle: Die Welt der Habsburger: Kaiser Karl der Letzte – Entmachtung und Exil
Link (https://www.habsburger.net/de/kapitel/kaiser-karl-der-letzte-entmachtung-und-exil),
aufgerufen am 14.10.2019.
30M3 Biografien der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
Anmerkung: Ein Zeitzeuge aus der Dokumentation wurde im Film aus archivarisch-rechtlichen
Gründen teilanonymisiert.
Elsa Björkman-Goldschmidt
Elsa Björkman-Goldschmidt (1888–1982) wurde am 16. April 1888 in Linköping in
Schweden geboren. Nach Abschluss einer Lehrerinnenausbildung, einem Studium an
der Kunsthochschule in Stockholm und einigen Sprachaufenthalten im Ausland
schloss sie sich im November 1916 den Aktivitäten ihrer Schulfreundin Elsa Brand
ström an, die sich im Auftrag des schwedischen Roten Kreuzes für die Verbesserung
der Lage deutscher und österreichischer Kriegsgefangener in Russland einsetzte und
dafür als Engel von Sibirien Berühmtheit erlangte. Elsa Björkman lernte im Zuge die
ses Engagements ihren späteren Ehemann, den Wiener Arzt Waldemar Goldschmidt,
kennen. Im September 1919 kam sie nach Wien, um nunmehr Hilfsaktionen der
schwedischen Organisation „Rädda Barnen“ (Rettet das Kind) für die notleidende
österreichische Bevölkerung zu organisieren. Nach der Heirat im Jahr 1921 verbrachte
das Ehepaar Björkman-Goldschmidt die Zwischenkriegszeit in Wien und flüchtete
1938 gemeinsam vor dem nationalsozialistischen Regime nach Schweden. In den Jah
ren nach dem Zweiten Weltkrieg und anlässlich der Ungarnkrise im Jahr 1956 kehrte
die Autorin weitere Male für humanitäre Hilfsmissionen nach Wien zurück. Sie ver
starb 1982 im Alter von 94 Jahren.
Quelle: Eigner, Peter & Müller, Günter [Hg.]: Hungern – Hamstern – Heimkehrern. Erinnerungen an
die Jahre 1918–1921. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 2017. S. 225. PDF online.
Link (https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representa
tion/zd_std_orig__zd_schw_orig/041/264/423/9783205206569_table_of_content_pdf_1.pdf),
aufgerufen am 06.10.2019.
Ludmilla Fiala
Ludmilla Fiala (1910–1995) wurde am 14. September 1910 als Ludmilla Focke in Wien
geboren und wuchs mit sieben Geschwistern in beengten Verhältnissen auf der
„Kreta“, einem zu Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem von Zugewanderten aus
Böhmen und Mähren bewohnten Elendsviertel an der Grenze der Wiener Bezirke
Favoriten und Simmering auf. Ihre Mutter war mit 15 Jahren als Dienstmädchen von
Mähren nach Wien gekommen, ihr Vater war Arbeiter im Gaswerk und ist früh ver
storben. Durch Besuch einer Handelsschule und weiterbildende Kurse konnte Lud
milla Fiala sich eine ansehnliche berufliche und gesellschaftliche Stellung erarbeiten,
31identifizierte sich jedoch zeitlebens mit ihrer Herkunft als Kind der Vorstadt. Sie starb
1995 im Alter von 85 Jahren.
Quelle: Eigner, Peter & Müller, Günter [Hg.]: Hungern – Hamstern – Heimkehrern. Erinnerungen an
die Jahre 1918–1921. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 2017. S. 220. PDF online.
Link (https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representa
tion/zd_std_orig__zd_schw_orig/041/264/423/9783205206569_table_of_content_pdf_1.pdf),
aufgerufen am 06.10.2019.
Anton Hanausek
Anton Hanausek (1898–1984) wurde am 19. September 1898 in Wien geboren, hatte
zwei jüngere Schwestern und wuchs ab 1905 in ärmlichen Verhältnissen in Wien-
Ottakring auf. Für den Lebensunterhalt sorgte vor allem die Mutter mit Hilfsarbeiten,
während der Vater den Verlust einer leitenden Stellung in einem Betrieb in der Slowa
kei und des damit verbundenen relativen Wohlstands nicht verkraften konnte. Nach
dem Besuch der Volks- und Bürgerschule absolvierte Anton Hanausek eine Lehre als
Elektriker und wurde unmittelbar nach dem Lehrabschluss im Frühjahr 1916 zum Mili
tärdienst eingezogen. Als Mitglied einer Telegraphenabteilung stand er in Rumänien,
in den Karpaten und in Oberitalien im Kriegseinsatz. Im Anschluss an die im Folgen
den beschriebene glückliche Heimkehr versuchte Anton Hanausek mit verschiedenen
Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ende der 1920er Jahre konnte er sich
schließlich als Kohlenhändler selbständig machen. Seine 1931 geschlossene Ehe blieb
kinderlos. Hanausek verstarb 1984 im Alter von 86 Jahren.
Quelle: Eigner, Peter & Müller, Günter [Hg.]: Hungern – Hamstern – Heimkehrern. Erinnerungen an
die Jahre 1918–1921. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 2017. S. 45. PDF online.
Link (https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representa
tion/zd_std_orig__zd_schw_orig/041/264/423/9783205206569_table_of_content_pdf_1.pdf),
aufgerufen am 06.10.2019.
Marianne Jarka
Marianne Jarka (1889–1980) wurde am 27. Dezember 1889 in Gloggnitz geboren. Im
Alter von 12 Jahren zog sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Reichenau an
der Rax.
Marianne Jarka beendete ihre Grundschulzeit in Reichenau. Anschließend machte sie
eine Ausbildung zur Handarbeitslehrerin in Kladno in Böhmen. Nach dem Tod ihrer
Schwester verließen die Eltern Reichenau und zogen nach Wien, wo Marianne als Kin
derfräulein arbeitete. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges stellte sie sich dem Spital
32in der Stiftskaserne zur Verfügung. Ihre Ausbildung erhielt sie am Sanatorium Löw
und Hera. Ihr erster Arbeitsplatz als Krankenschwester war die Wiener Stiftskaserne,
die zu einem Reservespital umfunktioniert worden war. Nach der Kriegserklärung Ita
liens an Österreich-Ungarn im Mai 1915 meldete sich Marianne Jarka über das Rote
Kreuz für ein mobiles Feldspital. Zugewiesen wurde ihr eine Tätigkeit an der Isonzo
front. Mit Ende des Krieges geriet sie in Gefangenschaft und kehrte danach nach
Wien zurück.
Nach verschiedenen Tätigkeiten vor und während des Zweiten Weltkrieges emigrierte
sie 1962 in die USA und starb am 8. April 1980 in Missoula, Montana im Alter von 91
Jahren.
Quelle: Vgl. Salm-Reifferscheidt, Franziska: Frauen in der Kriegskrankenpflege im Ersten Weltkrieg
am Beispiel der Rotkreuzschwester Marianne Jarka. Diplomarbeit. Universität Wien. Wien: 2010. S.
56–61. PDF online.
Link (http://othes.univie.ac.at/8208/1/2010-01-13_0104971.pdf), aufgerufen am 05.10.2919.
Milena Jesenská
Milena Jesenská (1896–1944) wurde am 10. August 1896 in Prag geboren.
Sie besuchte das Mädchengymnasium „Minerva“ in Prag und studierte danach Medi
zin. Nach dem Abbruch des Studiums arbeitete sie am Prager Konservatorium und
verkehrte in der Prager deutsch-jüdischen Gesellschaft, wo sie unter anderen auch
Max Brod und Franz Werfel kennenlernte. 1917 wurde sie von ihrem Vater, Jan
Jesenský, wegen ihres Liebesverhältnisses mit dem jüdischen Bohemien Ernst Pollak
in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, in der sie bis zu ihrer Volljährigkeit (damals
21 Jahre) eingesperrt blieb.
Unmittelbar nach ihrer Entlassung heiratete sie Pollak und zog mit ihm nach Wien.1
Sie lebte von Gelegenheitsarbeiten bzw. von Übersetzungstätigkeiten für Franz Kafka.
1923 scheiterte ein Selbsttötungsversuch.
Nach ihrer Rückkehr nach Prag wurde sie Mitglied einer Gruppe avantgardistischer
linker Intellektueller.
1931 trat Milena Jesenská der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei.
Aufgrund einer kritischen Äußerung über den Stalinismus wurde sie 1936 aus dieser
Partei ausgeschlossen.2
Nach der durch das Münchener Abkommen erfolgten Okkupation durch das national
sozialistische Deutsche Reich und anschließender Zerschlagung der Rest-Tschechei
schloss sie sich 1939 dem antifaschistischen tschechoslowakischen Widerstand an. Im
33Sie können auch lesen