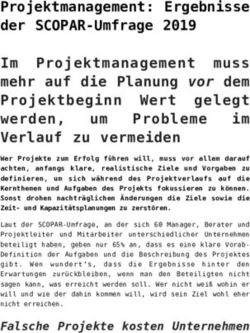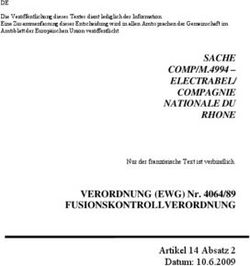ZUKUNFTSIMPULS Nachhaltige Wertschöpfung in der Mikroelektronik in Sachsen - Industrie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ZukunftsImpuls 2
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ..................................................................................................................................... 5
1 Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit? .......................................... 8
2 Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik .............................................................................. 11
2.1 Status Quo der zirkulären Wertschöpfung ................................................................. 11
2.2 Nachhaltigkeit als Unternehmensziel in der Mikroelektronik ..................................... 14
3 Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impulsgeber für nachhaltige
Wertschöpfung ................................................................................................................... 18
4 Zusammenfassung und Ausblick ..................................................................................... 21
Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 24
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 3
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit und ihre Verknüpfung untereinander 6
Abbildung 2: Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik 9
Abbildung 3: Möglicher Kreislaufprozess in der Elektronik 11
Abbildung 4: Verteilung der Fördermittel auf Bundesmittel mit bzw. ohne die Mittel für
Cool Silicon sowie die sächsischen Mittel für Cool Silicon 19
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 4
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten sämtliche
Personenbezeichnungen gleichwohl für alle Geschlechter.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 5
Einleitung
Die »ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE« leistet mit aktuellen Analysen zum Industriestandort Sachsen
einen Beitrag, um durch die Aufbereitung evidenzbasierter Informationen die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit im Freistaat zu stärken.
Im vorliegenden ZukunftsImpuls „Nachhaltige Wertschöpfung in der Mikroelektronik in Sachsen“ widmet
sich die ZukunftsWerkstatt einem täglich an Stellenwert gewinnenden Thema. Ziel ist es, den globalen
Trend hin zu nachhaltiger Wertschöpfung in seinen Implikationen für die Mikroelektronik als einen der
1
bedeutendsten Wirtschaftszweige Sachsens zu untersuchen.
In Sachsen schlägt das europäische Herz der Mikroelektronik: Vier moderne Halbleiterfabriken stehen
in Dresden, darunter einer der führenden Anbieter für energieeffiziente Leistungselektronik (Infineon
Technologies Dresden GmbH & Co. KG) und ein Fertigungsdienstleister für energieeffiziente
Halbleiterbauelemente für das Internet der Dinge (GLOBALFOUNDRIES Dresden). Für den Freistaat
und den Standort Deutschland insgesamt hat die Elektronik eine herausragende wirtschaftliche wie
auch strategische Bedeutung. Zahlreiche sächsische Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette
der Mikroelektronik agieren, haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben oder besitzen einen starken
Fokus auf Nachhaltigkeit. Rund 350 Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen und andere Akteure
der Halbleiterbranche haben sich zu Europas größtem Cluster dieser Branche vernetzt, dem Silicon
Saxony e. V. Das Cluster nimmt weltweit eine führende Positionen ein (Industrie- und Handelskammer
Dresden, 2021).
Nachhaltigkeit ist ein in Sachsen tief verwurzeltes Thema. Bereits vor mehr als 300 Jahren führte Hans
Carl von Carlowitz, ein gebürtiger Sachse, den Begriff ein (Carlowitz, 1713). Die Nachhaltigkeitsstrategie
des Freistaats Sachsen betont in dieser Tradition die hohe Relevanz des Themas für die Zukunft
(Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, 2018). Bereits
1993 riefen die Sächsische Staatsregierung und die sächsische Wirtschaft die „Umweltallianz Sachsen“
ins Leben. Im Rahmen des Vorläuferprojektes „StrategieWerkstatt: Industrie der ZUKUNFT.“ mündete
die industriepolitische Auseinandersetzung mit „Nachhaltiger Wertschöpfung“ in der Ableitung von
Missionen und Maßnahmen im Kontext des Themenfeldes und ist im Folgeprojekt, der
ZukunftsWerkstatt, ebenfalls fester Bestandteil des industriepolitischen Diskurses.
Grundsätzlich unterscheidet die Literatur drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: soziale, ökonomische
und ökologische Nachhaltigkeit (siehe Abbildung 1 (Die Bundesregierung, 2008)). Der Begriff der
Nachhaltigkeit ist heute eng mit den 17 Nachhaltigkeitszielen verknüpft (Sustainable Development
Goals), welche 2015 durch die UN veröffentlicht wurden.
1
Aufgrund der im Freistaat entlang der Wertschöpfungskette abgebildeten großen Breite dehnt der vorliegende ZukunftsImpuls
den Begriff der Mikroelektronik von den Halbleiterbauelementen und ihrer Fertigung über Komponenten, Module und
Baugruppen bis zu den Systemen aus, einschließlich deren Entwurf.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 6
Abbildung 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit und ihre Verknüpfung untereinander
Der vorliegende ZukunftsImpuls legt ein besonderes Augenmerk auf die Chancen und Potenziale der
Stärkung einer ökologisch nachhaltigen Wertschöpfung in der Branche der Mikroelektronik, da diese
wie kaum eine andere als Querschnittsbranche eine Multiplikatorfunktion in zahlreiche andere
Bereiche der Wirtschaft sowie für das tägliche Leben besitzt. Damit kann sie die Rolle einer Impuls-
geberin für eine nachhaltige Transformation industrieller Wertschöpfung einnehmen. Mithilfe ihrer
Produkte kann die Branche Unternehmen anderer Wertschöpfungsketten dabei unterstützen,
nachhaltigere Produkte und Prozesse zu realisieren. Von intelligenter, effizienzoptimierter Steuerung
von Produktions- und Logistikprozessen bis hin zu besonders energieeffizienten Komponenten für die
Energiewende und die Elektromobilität – die Mikroelektronik kann zum Schlüsselakteur (Enabler) einer
nachhaltigen Transformation der Digitalisierung werden.
In Anbetracht der langen, komplexen Wertschöpfungskette (siehe Abbildung 2) in der Mikroelektronik
und der Komplexität der Produktionsprozesse stellt die Etablierung nachhaltiger Wertschöpfung eine
besondere Herausforderung dar, der nur in kleinen Schritten begegnet werden kann. Der
ZukunftsImpuls enthält neben umfangreichen Recherchen auch konkrete sächsische Fallbeispiele, die
belegen, dass die Herausforderungen auf der einen Seite bereits heute in Teilaspekten ökonomisch
sinnvoll gemeistert werden können und auf der anderen Seite wiederum Chancen eröffnen.
Die sächsische Mikroelektronik besitzt durch umfangreiche Innovationsaktivitäten im Themenfeld
überregionale Strahlkraft und die Chance, Vorreiter für die Entwicklung nachhaltiger Wert-
schöpfungsbündnisse zu sein. Der vorliegende ZukunftsImpuls soll das Thema mit Fakten und Daten
untersetzen und weitere Entwicklungsbedarfe am konkreten Beispiel der Mikroelektronik Sachsens
ableiten.
In Kapitel 1 „Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit?“ erfolgt zunächst eine
Darstellung der aktuellen Situation innerhalb der Branche. Die Digitalisierung hat sowohl positive als
auch negative Effekte für die ökologische Nachhaltigkeit. Aufgrund der globalen Erwärmung hat das
Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen. Unternehmen, auch der
Elektronikindustrie, können sich diesem Thema nicht verschließen.
Kapitel 2 „Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik“ adressiert den aktuellen Stand (ökologischer)
Nachhaltigkeit in technologischer Hinsicht und gibt einen Überblick über derzeitige Entwicklungen im
Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Branche. Weiterhin betrachtet das Kapitel Nachhaltigkeit im
Kontext unternehmerischen Denkens und zukunftsweisenden Handelns und diskutiert Erkenntnisse am
Praxisbeispiel der Mikroelektronik.
Das sich anschließende Kapitel 3 „Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impuls-
geber für nachhaltige Wertschöpfung“ untersucht den Einfluss der Forschungslandschaft in
Wirtschaft und Wissenschaft auf die nachhaltige Wertschöpfung in der Elektronikbranche in Sachsen.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 7
Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen nachhaltige Innovationen in der Elektronikindustrie und durch die
entwickelte Elektronik.
Das abschließende Kapitel 4 „Zusammenfassung und Ausblick“ verschränkt die Ergebnisse und
gibt einen Ausblick über mögliche Ansätze zur Stärkung der Potenziale nachhaltiger Entwicklung in der
Branche selbst sowie darüber hinaus.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 8
1 Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit?
Die Digitalisierung ist ein anhaltender Trend, der alle Lebenslagen durchdringt. Die Basis dafür ist seit
jeher die Elektronik, denn Sensoren müssen die Daten erst erfassen, jeder Auswertealgorithmus
braucht eine physische Plattform zur Ausführung, die gewonnenen Informationen müssen übermittelt,
gespeichert und für den Menschen verfügbar gemacht werden. All dies benötigt Hardware – häufig
subsummiert unter dem Begriff „Informations- und Kommunikationstechnologie“ (IKT) – und Energie
zum Betreiben der Hardware.
Es ist unumstritten, dass der steigende Einsatz von IKT im Rahmen der Digitalisierung sowohl positive
als auch negative Effekte für die ökologische Nachhaltigkeit bedingt (Wittpahl, 2021). Studien zufolge
steigt die weltweite CO2-Emission durch IKT von 2015 bis 2025 um 50 % (Hoch & Zimmermann, 2020).
Die IKT könnte 2030 mehr als 50 % der global erzeugten elektrischen Energie nutzen und damit bis zu
23 % der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verursachen (Andrae & Edler, 2015). Gleichzeitig spart
die steigende Energieeffizienz der elektronischen Bauteile und Komponenten Treibhausgas-
Emissionen ein. Auch dem Einsatz von KI-Lösungen (z. B. in den Bereichen Energie und
Transport/Logistik) sprechen Studien ein Einsparpotenzial an Treibhausgas-Emissionen zu (Jetzke,
Richter, Ferdinand & Schaat, 2019).
Grundsätzlich ist es sinnvoll zu unterscheiden: Wird Elektronik ressourcenschonend und nachhaltig
ausgelegt und hergestellt („Green ICT“) oder werden Ressourcen und/oder Treibhausgas-Emissionen
durch die Nutzung von elektronischen Bauteilen, Komponenten oder Systemen eingespart („Green by
ICT“). Bei der Betrachtung der Potenziale, die eine nachhaltige Mikroelektronik für das Erreichen der
Klimaschutzziele hat – sowohl im Hinblick auf ihre Fertigung als auch die Endprodukte – sind
grundsätzlich beide Betrachtungen wichtig. Detailinformationen ermöglichen eine Ökobilanzierung,
welche einzelne Hersteller freiwillig durchführen. Für ein Smartphone (am Beispiel iPhone X, 64 GB
Speicher) entstehen rund 80 % der Treibhausgas-Emissionen bereits im Produktionsprozess und nur
17 % in der Nutzung (insgesamt 79 kg CO2-Äquivalente) (Apple Inc., 2017). Die restlichen 3 % entfallen
auf Transport (2 %) und Recycling (1 %). Unternehmen, die den Endverbrauchermarkt bedienen, wie
z. B. Apple, sind beim Thema Nachhaltigkeit besonders aktiv und nutzen diesen Trend in ihrer
Marketingstrategie. Schon 2018 gab Apple bekannt, weltweit den Energiebedarf in allen Büros,
Rechenzentren usw. vollständig mit erneuerbaren Energien zu decken (Apple Inc., 2018). Jedes
Produkt von Apple soll bis 2030 klimaneutral sein (Apple Inc., 2021b). Das betrifft die Produktion (75 %
der Emissionen entstehen laut Unternehmensangaben hier), die Auftragsfertigung, die Gerätenutzung
und die Entsorgung. Für alle Zulieferer von Apple heißt das, ebenfalls bis 2030 klimaneutral produzieren
zu müssen (Apple Inc., 2021a). Ähnliche Bestrebungen kommunizieren in Deutschland einzelne Unter-
nehmen wie z. B. die Daimler AG (Daimler AG, 2021). Die drei Tochtergesellschaften der Volkswagen
AG, Porsche, Audi und Volkswagen, setzen auf Künstliche Intelligenz (KI), um Nachhaltigkeitsrisiken
wie Umweltverschmutzung, Menschenrechtsverstöße und Korruption nicht nur bei direkten
Geschäftspartnern, sondern auch in den tieferen Stufen ihrer Lieferkette frühzeitig zu erkennen
(macondo publishing GmbH, 2021). Der jeweilige zentrale Einkauf prüft Anzeichen von
Nachhaltigkeitsrisiken und leitet gegebenenfalls Vermeidungsmaßnahmen bis hin zur Beendigung von
Geschäftsbeziehungen ein. Die KI wird so zum proaktiven Frühwarnsystem für Verstöße gegen die
Nachhaltigkeitsanforderungen der Volkswagen AG. Seit Beginn des Pilotprojekts im Oktober 2020
analysieren die Tochtergesellschaften mehr als 5.000 Schlagworte in öffentlich zugänglichen Medien
sowie sozialen Netzwerken in mehr als 50 Sprachen und aus über 150 Ländern und haben über 4.000
Lieferanten im Blick. Dieses Engagement zeigt, dass international führende Unternehmen durch
ökologische Nachhaltigkeit auch aus wirtschaftlicher Sicht langfristig positive Effekte auf die
Marktstellung und die jeweilige Wettbewerbssituation erwarten. Anders lässt sich der erhebliche
Aufwand für diese Maßnahmen für ein börsennotiertes Unternehmen kaum gegenüber den Investoren
rechtfertigen.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 9
Gleichzeitig verdeutlicht dieses Beispiel die großen Herausforderungen für Unternehmen, das Thema
Nachhaltigkeit in allen Dimensionen der Wertschöpfungskette zu verankern. Die Wertschöpfungsketten
der (Mikro-)Elektronik sind lang und hochgradig komplex (siehe auch Abbildung 2). Rohstoffe und
elektronische Bauelemente werden an Börsen oder über Distributoren gehandelt und lassen sich nur
unter großen Schwierigkeiten zum eigentlichen Erzeuger zurückverfolgen. Vielfach sind Daten zur
Ermittlung des eigenen CO2-Fußabdrucks nicht verfügbar. Das Thema ist sehr vielschichtig und die
Branche kann es nur in kleinen Schritten angehen.
2
Abbildung 2: Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik
Auch ein großes Unternehmen wie Apple muss demnach erhebliche Anstrengungen vollziehen, um den
CO2-Fußabdruck seiner Produkte nachhaltig zu senken. Es unterzieht jedes neue Produkt einer
Lebenszyklusanalyse (engl. Life Cycle Assessment, LCA), die veröffentlicht wird. Seit dem Bekenntnis
zur CO2-Neutralität 2018 ist der CO2-Fußabdruck der neu erschienenen Topmodelle von Apple iPhones
von 77 auf 86 kg CO2-Äquivalente angewachsen. Zwar unterscheiden sich die Modelle in
Leistungsfähigkeit und Größe, aber mit dem Fokus auf eine nachhaltigere Produktion sind diese Zahlen
beunruhigend. Die höhere Leistungsfähigkeit verursacht höhere CO2-Ausstöße (Rebound-Effekte)
(Umweltbundesamt, 2019), d. h. dass hier neue, innovative Ansätze gefragt sind (siehe auch Kapitel 3).
Mit der Idee der Nachhaltigkeit entstehen nicht nur ein Nutzen für die Umwelt, sondern neue Potenziale
für Wertschöpfung. Schon heute lassen sich nachhaltige Produkte leichter verkaufen. Das Weltwirt-
schaftsforum unterstreicht, dass die vierte industrielle Revolution nur gelingt, wenn Digitalisierung und
Nachhaltigkeit zusammengedacht werden (World Economic Forum, 2019). Zudem gibt es erste
Anzeichen, dass Kapitalmarktakteure künftig eine Umverteilung von Kapital in Richtung nachhaltig
agierender Unternehmen anstreben. Dem zugrunde liegt eine Neubewertung von Risiken und
2
stark vereinfachte Darstellung unter Ausblendung der hochkomplexen Teilketten, die der Bereitstellung von Rohstoffen,
Prozessmitteln und Energie zuzuordnen sind
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 10
Vermögenswerten unter dem Einfluss von Umweltfaktoren ((Peters & Goluchowicz, 2020) sowie
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020)). Dies ist von besonderer Relevanz, weil eine nachhaltigere
Produktion Investitionen in erheblichem Umfang erfordert. Auf lange Sicht erwarten Unternehmen
jedoch deutliche Wettbewerbsvorteile. Für die Robert Bosch GmbH, die mit ihrer Tochter Robert Bosch
Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH erst vor kurzer Zeit einen neuen, großen Fertigungs-
standort im Freistaat Sachsen aufgebaut hat, gehe diese Strategie nach eigenen Angaben auf. Das
Unternehmen habe für sich selbst vor Jahren Megatrends identifiziert und daraus eine Nachhaltigkeits-
strategie entwickelt. Es bekenne sich zum Pariser Klimaabkommen und leiste seinen Beitrag im Bereich
Energieerzeugung und Energieeinkauf, indem die Nutzung der Bosch-Produkte durch Steigerung der
Energieeffizienz weniger CO2-Emissionen erzeuge. Außerdem habe sich Bosch zum Ziel gesetzt, die
vor- und nachgelagerten Emissionen der Lieferketten bis 2030 um 15 % gegenüber 2018 zu senken
(Robert Bosch GmbH, 2021).
Die Planung der neuen Halbleiterfabrik in Dresden habe daher Nachhaltigkeitsaspekte konsequent
einbezogen. Das Unternehmen wurde von der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem
Goldstandard zertifiziert. Sie würdigte insbesondere die Energietechnik der Fabrik. Eine Anpassung der
Medienversorgung an die Bedarfe erfolge kontinuierlich. Bei der Beschaffung der notwendigen
Fertigungsausrüstung (Transformatoren, Pumpen, Motoren usw.) habe Bosch den Lieferanten Ver-
gleichsmaßstäbe für eine Energieeffizienzklasseneinteilung vorgegeben. Hier bringen höhere Anfangs-
investitionen deutliche, langfristige Vorteile. Für alle Anlagen gebe es eine KI-basierte Leit-
technikplattform zur Überwachung der Energie- und Medienverbräuche. Mit ihrer Hilfe lassen sich für
bestimmte Produktionsprozesse die Lastspitzen optimieren. Moderne, den Paradigmen von
Industrie 4.0 folgende Steuersysteme machen dies möglich. Aber auch für die Zukunft habe sich Bosch
weitere Projekte vorgenommen, beispielsweise die Prüfung der sinnvollen Nutzung der Prozess-
abwärme.
Wer als Zulieferer für Unternehmen aktiv ist, die ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen, steht
zunehmend unter Druck, selbst Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Und das nicht perspektivisch,
sondern kurzfristig. Andernfalls müssen Zulieferer mit einer Beendigung langjähriger Geschäfts-
beziehungen rechnen. Diesen Umbruch werden sicher einige nicht schaffen. Aber auf der anderen Seite
bietet dies die große Chance, sich durch frühzeitige Anpassung an die neue Ausrichtung bei der
Auswahl von Lieferanten im Rennen um neue, auf Nachhaltigkeit fußende langfristige
Geschäftsbeziehungen einen vorteilhaften Startplatz zu sichern. Die Elektronikbranche im Freistaat
Sachsen hat aufgrund ihrer Breite, guten Vernetzung und hohen Innovationskraft beste
Voraussetzungen dafür.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 11
2 Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik
Nachfolgende Ausführungen adressieren den aktuellen Stand (ökologischer) Nachhaltigkeit in
technologischer Hinsicht (siehe Kapitel 2.1) und geben einen Überblick über derzeitige Entwicklungen
im Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Mikroelektronik. Im Anschluss verdeutlichen konkrete
Praxisbeispiele der Branche, wie Nachhaltigkeit sich im Unternehmenshandeln niederschlagen kann
(siehe Kapitel 2.2).
2.1 Status Quo der zirkulären Wertschöpfung
Wie zuvor am Beispiel des Smartphones verdeutlicht, verantwortet der Betrieb von Elektronik
typischerweise über den gesamten Lebenszyklus hinweg nur einen kleinen Anteil der Treibhausgas-
Emissionen. Über die Steigerung der Energieeffizienz hinaus besteht folglich ein noch deutlich größerer
Hebel in der Produktion und der Verwertung ausgedienter Geräte sowie der Verlängerung ihrer
Nutzungsdauer (z. B. durch Reparaturen). Neben der Emission von Treibhausgasen sind der Bezug
von nachhaltig gewonnenen Rohstoffen oder Prozessmitteln sowie der ressourcenschonende Umgang
damit von großer Bedeutung. Das Ziel für nachhaltige Elektronik muss daher ein Kreislaufprozess, wie
in Abbildung 3 (Eigene Darstellung nach (World Economic Forum, 2019a)) dargestellt, sein.
Abbildung 3: Möglicher Kreislaufprozess in der Elektronik
Folgende Ansatzpunkte dienen der Forcierung einer Kreislaufwirtschaft in der Wertschöpfungskette der
Mikroelektronik:
1. (Rohstoff-)Beschaffung – Einsatz von Rezyklaten bzw. Sekundärrohstoffen oder Substituten im
Produktionsprozess;
2. Produktdesign – Erhöhung der Anforderungen an Produktlebensdauer, Reparierfähigkeit und
Modularität für effizientes Recycling nach Erreichen der Nutzungsdauer;
3. Produktionsintegrierter Umweltschutz (PIUS) bzw. Materialeffizienz – Stärkung von
Maßnahmen zur innerbetrieblichen Kreislaufführung von Produktionsabfällen;
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 12
4. Entsorgung – Beeinflussung von Rücklaufquoten durch Etablierung von Anreizsystemen und
neuartigen Geschäftsmodellen.
Zur Erreichung von Nachhaltigkeits- und Klimazielen muss das Potenzial in jedem dieser Aspekte
adressiert und gehoben werden. Dies trifft auf die Elektronikbranche ganz besonders zu, da hier eine
Vielzahl von Ausgangsstoffen erforderlich ist, die häufig nur in vergleichsweise geringen Mengen
verfügbar sind bzw. nur unter großem Aufwand gewonnen oder in eine Form gebracht werden können,
die weiterverarbeitet werden kann (siehe auch Aktionsplan zu kritischen Rohstoffen der EU
(Europäische Kommission, 2020)). Eines der bekanntesten Beispiele ist Kobalt, das in der derzeitig
führenden Li-Ionen-Batteriezelltechnologie eine wesentliche Rolle spielt und bei dem durch die
Arbeitsbedingungen beim Abbau auch die soziale Komponente der Nachhaltigkeit besonders
hervorzuheben ist. Der Umstieg von Primär- auf Sekundärrohstoffe, sprich Rezyklate, kann einen
sichtbaren Beitrag zur nachhaltigen Produktion leisten.
Die CO2-Bilanz von aus Elektroschrott recyceltem Gold ist gegenüber primärem Gold um den Faktor
300 besser (MSV Mediaservice & Verlag GmbH). Auch wenn diese Materialien teilweise nur in geringen
Mengen in einem elektrischen Gerät vorkommen (wenige Milligramm), so ist es die hohe Anzahl an
Geräten, die laut Statista für einen jährlichen Goldverbrauch von ca. 300 Tonnen in der
Elektronikindustrie verantwortlich ist (Hohmann, 2020). Allein der Einsatz von rückgewonnenem Gold
könnte hier ca. 48.000 Tonnen CO2-Äquivalente jährlich einsparen. Ähnlich verhält es sich
beispielsweise mit Zinn (Apple Inc., 2019). Lösungsbeispiele sind hier Entwicklungsarbeiten der Stannol
GmbH & Co. KG, einem Unternehmen aus dem Bereich der Löttechnik. Das Unternehmen entwickelte
gemeinsam mit dem Verein Fairlötet e. V. ein nachhaltiges Lötzinn (Stannol GmbH & Co. KG) auf Basis
von rückgewonnenem Zinn und Kupfer, ohne Anteile von Blei, welches als umweltschädlich gilt. Die
Nutzung eines solchen fairen Zinns hat auch ökonomische Auswirkungen, sowohl beim Produzenten
als auch beim Kunden: Dem höheren Preis im Einkauf steht ein neues Geschäftsmodell mit dem Fokus
auf nachhaltige Elektronik gegenüber.
Neben den Substitutionsmöglichkeiten und zunehmenden Bestrebungen in Bezug auf metallische
Rohstoffe nimmt auch der Einsatz von Kunststoffrezyklaten in energieverbrauchsrelevanten Geräten
immer weiter zu. Es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Bereich der Haushaltskleingeräte und vereinzelt
der Weißen Ware sowie Beispiele aus der Informations- und Kommunikationstechnik. Rezyklate sind in
relevanten Mengen aus Elektro- und Elektronikaltgeräten von einer begrenzten Anzahl größerer
Recycler und von einigen kleineren Unternehmen verfügbar. Dabei sind die Materialeigenschaften von
entscheidender Bedeutung: Sie können veränderte Anforderungen an das Design von Bauteilen
genauso wie Anpassungen innerhalb der Verarbeitungsprozesse erfordern. Darüber hinaus ist die
Standardisierung von Rezyklatqualitäten und -eigenschaften ein wesentlicher Zwischenschritt, um eine
ökonomische und technische Sicherheit hinsichtlich der verarbeiteten Materialien zu erreichen.
Essenziell für den Einsatz von Rezyklaten ist auch die Rückverfolgbarkeit. Dokumentenbasierte
Nachweissysteme und Standards spielen dabei eine wesentliche Rolle. Beispielsweise unternimmt die
Circular Plastics Alliance derzeit erhebliche Anstrengungen, um den Einsatz von Kunststoffrezyklaten
zu forcieren (Schischke et al., 2021).
Gleichwohl werden bis zur vollständigen Umsetzung einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft
voraussichtlich mindestens weitere zehn Jahre vergehen. Die Branche der Mikroelektronik im Freistaat
Sachsen hat diesbezüglich allerdings einen wesentlichen Standortvorteil: Ein großer Teil der
notwendigen Partner zur Etablierung einer geschlossenen Wertschöpfung (Circular Economy) ist vor
Ort vorhanden, von Wafern (z. B. Siltronic AG Werk Freiberg, Freiberger Compound Materials GmbH)
bis hin zum Recycling von Silizium aus Photovoltaik-Anlagen (z. B. SiC Processing (Deutschland)
GmbH). Hier besteht das Potenzial, die regional vorhandenen Kompetenzen im Bereich der
Sekundärrohstoffwirtschaft und der Elektronikindustrie zu bündeln und die steigende Nachfrage an
nachhaltiger Elektronik zu bedienen.
Die Produktion in der Mikroelektronik ist darüber hinaus durch den Einsatz einer großen Zahl von höchst
umweltschädlichen Substanzen wie organische Lösemittel, Laugen, Säuren sowie klimaschädlichen
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 13
Prozessgasen wie Schwefelhexafluorid gekennzeichnet. Wie die Vermeidung des Einsatzes dieser
Substanzen in der Elektronikfertigung durch innovative Lösungen bereits heute zumindest teilweise
gelingen kann, zeigen die Beispiele für sächsischen Ideenreichtum in Kapitel 3.
Die Notwendigkeit, die Produktion von Mikroelektronik nachhaltiger zu gestalten, ergibt sich nicht zuletzt
auch aufgrund elementarer Probleme, wie z. B. aufgrund von Wetterextremen oder Wassermangel. So
mussten mehrere Halbleiterfabriken in Texas (Qualcomm, Renesas, Samsung, Infineon und NXP) Mitte
Februar 2021 wegen Stromausfällen aufgrund von unerwarteten Schneemassen und extremer Kälte
ihren Betrieb zeitweise einstellen (Demling, 2021). Die Kälte beschädigte Rohre, Pumpen und
Wasserwerke, sodass die Produktion auch nach Wiederherstellung der Stromzufuhr längere Zeit wegen
Wassermangels stillstand. Der Produktionsausfall führte zu einem erheblichen wirtschaftlichen
Schaden. Obwohl Taiwan grundsätzlich zu den regenreichsten Gebieten der Erde zählt, muss der dort
ansässige weltgrößte Halbleiterfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited
(TSMC) aufgrund ausbleibender Regenfälle derzeit Wasser mit Tank-LKWs aus Wasserreservoiren aus
dem Norden des Landes zuliefern lassen (Lee & Kao, 2021). Weil TSMC bereits in der Vergangenheit
Probleme mit der Wasserversorgung hatte, entwickelte das Unternehmen verschiedene Strategien zum
Wasserrecycling, die die Sammlung von Kondenswasser aus Klimaanlagen und Regenwasser sowie
den Bau von Wasserrückgewinnungsanlagen beinhalten. Umgerechnet 900 Liter Wasser benötigt jedes
einzelne Smartphone in der Herstellung (Schulte, 2016). Den hohen Wasserverbrauch zu reduzieren,
ist eine enorme Herausforderung für die Halbleiterindustrie. Deshalb stehe beim Halbleiterhersteller
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG nach eigenen Angaben aktuell das Thema Wasser-
management im Fokus. Da das hierfür eingesetzte Trinkwasser für die Produktion weiter aufbereitet
werden müsse, habe das Unternehmen eine erhebliche Investition getätigt, um ein Rückhaltebecken
auf dem Gelände zu errichten. Dieses werde mit Wasser aus der Elbe gespeist, sogenanntem Uferfiltrat.
Die Aufbereitung dieses Uferfiltrats wäre kaum aufwändiger als die des Trinkwassers und werde zu
einer enormen Energieeinsparung und einer erheblichen Entlastung des Trinkwassersystems der Stadt
Dresden führen. Die Inbetriebnahme und Einweihung wäre nach einer Planungs- und Bauzeit von rund
15 Monaten für das vierte Quartal 2021 geplant.
Die Branche kann und sollte auf die Energie- und Ressourceneffizienz von Produkten bereits beim Ent-
wurf und der Entwicklung (Sustainability-by-Design) Einfluss nehmen, wie es beispielsweise bei Haus-
haltsgeräten die neue Ökodesign-Richtline der EU fordert (Umweltbundesamt, 2021). Sie umfassen
folgende Produktgruppen: Kühlgeräte, Waschmaschinen und Waschtrockner, Geschirrspüler,
elektronische Displays (einschließlich Fernsehgeräte), Lichtquellen und separate Betriebsgeräte,
externe Netzteile, Elektromotoren, Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion (z. B. Kühlgeräte in Super-
märkten, Verkaufsautomaten für Kaltgetränke), Transformatoren und Schweißgeräte. Neben An-
forderungen an die Energieeffizienz und die Energieverbrauchskennzeichnung steht erstmals die Re-
parierbarkeit der Produkte im Mittelpunkt. Hersteller und Importeure dürfen nur noch Geräte auf den
Markt bringen, wenn sie zugleich Ersatzteile und Reparaturanleitungen bereitstellen. Ersatzteile müssen
mit allgemein verfügbaren Werkzeugen und ohne dauerhafte Beschädigung am Gerät ausgewechselt
werden können. Bundesumweltministerin Svenja Schulze gehen die aktuellen Verordnungen zur Repa-
rierbarkeit und dem Recycling von Elektronikprodukten noch nicht weit genug. Ginge es nach ihr, würde
sie die bestehenden Regularien um eine „[…] Herstellergarantieaussagepflicht erweitern. Damit würden
Hersteller verpflichtet, eine Angabe über die Lebensdauer ihres Produktes zu machen. Tritt ein Mangel
innerhalb dieses Zeitraums auf, hat der Käufer ein Recht auf Reparatur. So würde ein Wettbewerb
darum entstehen, wer das langlebigere Produkt entwickelt.“ (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2021).
Unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer steht am Ende des Lebenszyklus eines Elektronik-
bauteils immer die Frage nach der Entsorgung. Die Kreislaufwirtschaft besitzt diesbezüglich ein großes
Potenzial, den Ressourcenverbrauch durch Rohstoffrückgewinnung massiv zu senken und aufbereitete
Rezyklate bzw. Sekundärrohstoffe wieder in die Wertschöpfungskette zurückzuführen.
Dennoch besteht insbesondere an diesem Punkt des Lebenszyklus noch enormer Entwicklungsbedarf,
denn Elektro- und Elektronikabfälle stellen in der EU zwar den am stärksten zunehmenden
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 14
Abfallstoffstrom dar, gleichzeitig liegt aber die Recyclingquote in der EU unter 40 % (Deutschland:
38,7 %) (Europäisches Parlament, 2020). Beispielsweise sind einige elektronische Komponenten (z. B.
Leiterplatten) (noch) nicht im industriellen Maßstab wiederverwertbar. Für Entwickler gilt es also, neben
einem intelligenten, auf Recycling ausgelegten Produktdesign neue wirtschaftlich tragfähige Lösungen
zu entwickeln, um den Anteil an Sekundärrohstoffen zu erhöhen. Auch hier bieten sich große Chancen
für den Freistaat Sachsen, denn gerade die Region Freiberg mit der Technischen Universität
Bergakademie Freiberg und dem Helmholtz-Zentrum für Ressourcenökonomie Freiberg sowie auch die
Technische Universität Dresden und zahlreiche Fraunhofer-Institute am Standort sind stark im Thema
Kreislaufwirtschaft verankert und haben bspw. bezogen auf das Batterierecycling bereits viel erreicht.
2.2 Nachhaltigkeit als Unternehmensziel in der Mikroelektronik
Wie vorhergehend aufgezeigt, wird Nachhaltigkeit im gesamten Produktlebenszyklus der Branche
immer wichtiger. Auch die Relevanz im unternehmerischen Denken und Handeln gewinnt für Unter-
nehmen an Bedeutung und eine Auseinandersetzung damit wird unumgänglich, um den steigenden
Kundenanforderungen gerecht zu werden, Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. -vorteile zu erzielen,
aber auch um die Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte (Herz, 2021) zu erhöhen.
Für große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen mit im Jahresdurch-
schnitt mehr als 500 Arbeitnehmern ist seit 2017 die Berichterstattung über die Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung von Unternehmen verpflichtend. Dies regeln das CSR-Richtlinie-Um-
setzungsgesetz bzw. die CSR-Richtlinie 2014/95/EU, die Mindeststandards für nichtfinanzielle Informa-
tionen vorgeben, insbesondere über die Beachtung von Nachhaltigkeitsstandards. Die Anfangsbarriere
ist hoch, doch wie die folgenden Beispiele zeigen, kann der Gewinn für die Unternehmen über den
verantwortungsbewussten Beitrag zu den Klimazielen hinaus auch den wirtschaftlichen Erfolg erhöhen.
Es lohnt sich also, die Nachhaltigkeit in die Unternehmensziele aufzunehmen.
Ein Beispiel für die Berücksichtigung verschiedener ökologischer Aspekte bei der Herstellung
mikroelektronischer Chips und Module zeigt die Infineon AG. Das ökologische Nachhaltigkeitskonzept
des Unternehmens unterscheidet vier Bereiche: Wassermanagement, Energie, Treibhausgas-
Emissionen und Abfallmanagement. Das definierte Ziel ist es, bis 2030 CO2-neutral zu werden, mit dem
Zwischenziel, bis 2025 die Treibhausgas-Emissionen um 70 % gesenkt zu haben (Infineon
Technologies AG, 2021). Im Moment ergeben Messungen der Ressourcenverbräuche der
Halbleiterfertigung 1,6 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2020 für den Gesamtkonzern (Infineon
Technologies AG, 2020). Dem gegenüber stehen durch die Produkte von Infineon, z. B. in der
Leistungselektronik („Green by ICT“), Einsparungen von jährlich rund 56 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valenten, d. h. es ergibt sich eine deutliche Hebelwirkung (Infineon Technologies AG, 2020). Die
Umsetzung dieser Ziele hat durchaus eine wichtige strategische Bedeutung für den Konzern: Bereits
zum elften Mal in Folge listen sowohl der Dow Jones Sustainability™ World Index als auch der Dow
Jones Sustainability™ Europe Index die Aktie. Damit kann das Unternehmen den schon seit längerem
anhaltenden Trend der nachhaltigen Geldanlagen (Münch, 2021) nutzen.
Aber die Infineon Technologies AG ist nicht das einzige Beispiel für nachhaltige Unternehmen in
Sachsen. Neben vielen anderen ist die Robert Bosch GmbH ein weiteres Beispiel. Ihr Ziel war es, ab
2020 klimaneutral zu entwickeln, zu fertigen und zu verwalten (siehe auch Kapitel 2). Dieses Ziel wurde
erreicht, erforderte jedoch Investitionen, die Vermeidung schädlicher Substanzen und die Schulung der
Mitarbeiter zum Thema ökologische Lieferketten - ein besonders in puncto Beschaffung wichtiger Punkt.
Zu Beginn des Projektes erfolgte eine vorrangig monetäre Bewertung des Nutzens. Dabei zeigte sich,
dass eine Nachhaltigkeitsstrategie wirtschaftliche Vorteile bringt. Die Klimaneutralität ist für Bosch
bereits heute kostengünstiger. Die Rückgabe von mehr CO2-Zertifikaten als geplant führte zu
zusätzlichen Einsparungen von Kosten.
Ergänzend zu Nachhaltigkeitsstrategien und der Verankerung nachhaltigen Denkens und Handelns in
der Unternehmensphilosophie sind Zertifizierungen zum Nachweis von nachhaltigen Aktivitäten ein
wichtiges Mittel. Die sächsische Staatsregierung fördert die nachhaltige Wirtschaft und schafft Anreize
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 15
für eine nachhaltige Produktion, um über freiwillige Leistungen der Wirtschaft Nachhaltigkeit und den
betrieblichen Umweltschutz zu stärken. Sie fördert in kleinen und mittleren Unternehmen mit der
„Mittelstandsrichtlinie – Umweltmanagement“ zahlreiche Maßnahmen rund um Zertifizierungen und
Beratungen im Bereich des Umweltmanagements. Für Unternehmen, die sich diesen Zertifizierungs-
möglichkeiten stellen, ist es jedoch mitunter nicht leicht, in der Vielfalt möglicher Zertifizierungssysteme
die für sie jeweils optimale Lösung zu identifizieren, um erfolgte Nachhaltigkeitsaktivitäten nachzu-
weisen und damit öffentlichkeitswirksam aufzutreten. Tabelle 1 zeigt die gängigsten Nachweismöglich-
keiten und gibt wesentliche Merkmale wieder.
Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 (adressiert ökologische Nachhaltigkeit)
erstellt durch: International Standardisation Organisation (ISO)
Gegenstand: Geltungsbereich für Umweltaspekte der unternehmerischen Tätigkeiten,
Produkte und Dienstleistungen, welche die zu zertifizierende Organisation unter
Berücksichtigung des Lebenswegs als entweder von ihr steuerbar oder beeinflussbar
bestimmt
Aufwand: Zertifizierung notwendig
Relevanz im Markt: Zertifizierung von weltweit mehr als 300.000 Unternehmen und
Organisationen
weitere Informationen: www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-
umwelt/umwelt-energiemanagement/iso-14001-umweltmanagementsystemnorm
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (adressiert ökologische Nachhaltigkeit)
erstellt durch: Europäische Union
Gegenstand: entspricht im Aufbau des Umweltmanagementsystems der
Umweltmanagementnorm ISO 14001; zusätzlich Initiierung leistungsorientierter
kontinuierlicher Verbesserungsprozesse unter Einbindung der Beschäftigten
Aufwand: Zertifizierung notwendig
Relevanz im Markt: 1109 deutsche Organisationen gelistet (Stand 01.04.2021); davon 24
sächsische Unternehmen, keines in der Elektronikbranche
weitere Informationen: www.emas.de
Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)
erstellt durch: Rat für Nachhaltige Entwicklung
Gegenstand: Unterstützung des Aufbaus einer Nachhaltigkeitsstrategie und
Einstiegsmöglichkeit in die Nachhaltigkeitsberichterstattung; Sichtbarmachung der
Unternehmensentwicklung im Zeitverlauf
Aufwand: Erklärung zu 20 DNK-Kriterien und den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Relevanz im Markt: Anwenderkreis umschließt große, kleine, öffentliche, private
Unternehmen mit und ohne Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie berichtspflichtige
Unternehmen
weitere Informationen: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 16
Global Compact (adressiert hauptsächlich ökologische und soziale Nachhaltigkeit)
erstellt durch: United Nations
Gegenstand: eher Austauschplattform als Zertifizierungsansatz oder Regulierungsinstrument;
Austauschplattform im Format eines offenen Forums, das auf nationaler Ebene als Treffpunkte
und Ideenschmieden für konkrete Lösungsansätze angelegt ist
Aufwand: Erstellung eines jährlichen Berichts
Relevanz im Markt: weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle
Unternehmensführung; mehr als 15.000 Unternehmen und Organisationen aus
Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft in mehr als 160 Ländern
weitere Informationen: www.globalcompact.de
Nachhaltigkeitsbericht (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)
erstellt durch: Selbstbericht des Unternehmens
Gegenstand: Darstellung der Tätigkeiten und Leistungen einer Organisation in Hinblick auf
die nachhaltige Entwicklung
Aufwand: unternehmensabhängiger Turnus, z. B. jährlich
Relevanz im Markt: Sichtbarmachung der Initiative für verantwortungsvolle
Unternehmensführung; Einhaltung und Dokumentation sozialer und ökologischer Standards
wird in Kunden-Lieferanten-Beziehungen zunehmend eingefordert; Nachhaltigkeitsbericht
kann hier Zertifikate (siehe oben) teilweise ersetzen
weitere Informationen: www.csr-in-deutschland.de
Global Reporting Initiative (GRI) (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)
erstellt durch: Global Reporting Initiative (gegründet durch Ceres (Investors and
Environmentalists for Sustainable Prosperity) unter Mitwirkung des Umweltprogramms der
United Nations)
Gegenstand: Unterstützung für Nachhaltigkeitsberichterstattung aller Organisationen;
Zurverfügungstellung eines Leitfades für Organisationen
Aufwand: freiwillige Berichterstattung
Relevanz im Markt: bietet interessierten Parteien vergleichbare Entscheidungs- und
Orientierungshilfen; bietet gemeinsame Sprache und akzeptiertes Set von
Nachhaltigkeitsindikatoren; Einkäufer fordern GRI immer stärker von ihren Lieferanten, um
Risiken zu reduzieren
weitere Informationen: www.globalreporting.org
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 17
Umweltallianz Sachsen
erstellt durch: Sächsischer Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft
Gegenstand: Auszeichnung aktueller freiwilliger Leistungen zum Schutz der Umwelt (Katalog
mit freiwilligen Umweltleistungen wird auf der Homepage zur Verfügung gestellt.)
Relevanz im Markt: ca. 250 Auszeichnungen; regionale Aktivität mit niedrigen
Einstiegshürden; ideal für KMU und Unternehmen, die sich in kleinen Schritten dem Thema
nähern wollen
weitere Informationen: www.umweltallianz.sachsen.de/
Tabelle 1: Nachweismöglichkeiten nachhaltiger Aktivitäten (Auswahl)
Neben einer Zertifizierung als Nachweis nachhaltigen unternehmerischen Handels ist im Freistaat
Sachsen auch die Mitgliedschaft in der Umweltallianz Sachsen, einer Kooperation zwischen der
sächsischen Wirtschaft und der Staatsregierung, ein denkbares Instrument des kooperativen
Umweltschutzes. Sie würdigt mit ihrem Siegel die Bereitschaft zur Verbesserung des unternehme-
rischen Umweltmanagements, insbesondere in Verbindung mit anspruchsvollen Zertifizierungen, wie
zum Beispiel der Umweltmanagementsysteme EMAS und ISO 14001. Durch eine Analyse aller
Mitglieder des Clusters Silicon Saxony e.V. wurde ermittelt, inwiefern die Unternehmen der Mikro-
elektronik in Sachsen bereits zertifiziert sind. Im Ergebnis zeigte sich, dass ungefähr 10 % dieser
Mitglieder das Thema Nachhaltigkeit in ihren Unternehmenspräsentationen im Internet adressieren.
Etwa 10 % besitzen eine Umweltmanagementzertifizierung nach ISO 14001, ca. 3 % haben eine Zertifi-
zierung für ein Energiemanagementsystem. Von den rund 200 Unternehmen, die sich freiwillig um eine
Auszeichnung der Umweltallianz Sachsen beworben haben, sind gerade einmal neun Unternehmen
aus der Elektronikbranche vertreten. Hier besteht zweifelsfrei noch Entwicklungspotenzial, insbeson-
dere da eine nennenswerte Anzahl der Mitglieder des Silicon Saxony e.V. die Bedingungen für eine
Auszeichnung bereits oder nahezu erfüllt.
Ein weiteres Instrument zum Nachweis nachhaltiger Unternehmensaktivitäten im Freistaat ist der
Sächsische Umweltpreis. Damit würdigt die sächsische Staatsregierung seit 2001 alle zwei Jahre
herausragende Leistungen für den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. Zunehmend
soll der Wettbewerb auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Ein
Unternehmen der Elektronikbranche war bisher nicht unter den Preisträgern, gleichwohl es im Freistaat
Sachsen zweifelsfrei Innovationen der Branche im Umweltschutz gibt, wie die Auszeichnung der
Freiberger Compound Materials GmbH mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis für einen Prozess
zur Rückgewinnung von Gallium aus industriellem Abwasser beweist.
Der Druck der Verbraucher, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu stellen, wird für die Unternehmen im
Endverbrauchermarkt im Freistaat Sachsen zunehmend größer. Nachhaltigkeit in verschiedenen
Ausprägungen ist bereits fester Bestandteil der meisten Marketingstrategien, denn Produkte, die nicht
den Kundenanforderungen an die Nachhaltigkeit genügen, werden immer weniger gekauft. Auch für
Arbeitssuchende ist eine nachhaltige Firmenphilosophie zunehmend ein wichtiger Anreiz bei der Wahl
des Arbeitgebers. Gerade im Bereich der Fachkräftegewinnung sind solche Aspekte bereits für 40 %
der Arbeitsuchenden ausschlaggebend dafür, für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden. Dabei
würden sogar 30 % der Befragten ein niedrigeres Gehalt akzeptieren (Herz, 2021). Eine Zertifizierung
nach ISO 14001 oder EMAS kann hier bereits einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt der Arbeitgeber
darstellen.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 18
3 Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impulsgeber für
nachhaltige Wertschöpfung
Für Unternehmen besteht der Weg zur Nachhaltigkeit aus drei Bausteinen: nachhaltige Lieferketten,
nachhaltige Produktion und nachhaltige Produkte. Dabei ist der Hebel bei der Gestaltung der Produkte
und der Umstellung der Produktion am größten. Wenn sich entlang der Wertschöpfungsketten jedes
Unternehmen hier engagiert, ergibt sich bereits eine deutliche Auswirkung auf die Gesamtbilanz. Dafür
bedarf es jedoch neben der Bereitschaft, sich einer solchen Aufgabe zu stellen, in erster Linie neuer,
wirtschaftlich tragfähiger Ideen. Der Ideenreichtum sächsischer Erfinder ist bekannt und erstreckt sich
insbesondere auch auf die Mikroelektronik. Allerdings setzen sich nachhaltige Lösungen nur durch,
wenn die Gesamtkostenbilanz besser ist als vergleichbare etablierte Lösungen.
Ein bemerkenswertes Beispiel, wie sich Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz in innovativen Produkten
vereinen lassen, zeigt das 2006 gegründete Unternehmen intelligent fluids GmbH. Ansässig in Leipzig
3
entwickele, produziere und vertreibe es nach dem Firmenmotto „E3 - economy, ecolology, enabling“
gemäß eigenen Angaben unbedenkliche Alternativen für etablierte, häufig hochgradig umwelt- und
gesundheitsschädliche Lösemittel, die auch in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. Darüber
hinaus seien diese Produkte wesentlich effizienter als bisherige Chemikalien und erlaubten sowohl eine
Reduktion des Materialeinsatzes als auch eine deutliche Senkung der Prozesstemperaturen, was zu
einem geringeren Energieverbrauch in der Fertigung führe. Die Entsorgungskosten reduzieren sich
aufgrund der Unbedenklichkeit der innovativen Produkte ebenfalls. Insgesamt führe das im Vergleich
zu den derzeit typischerweise eingesetzten Lösemitteln bis zu 70 % Kosteneinsparungen. Daher
wundert es nicht, dass das Unternehmen derzeit mit größeren Halbleiterfertigern in Kontakt stehe und
erste Audits zur Qualifikation als Zulieferer bereits erfolgreich bestanden habe. Im nächsten Schritt
plane das Unternehmen auch bei den Ausgangsstoffen für die Produkte eine vollständige Umstellung
auf unbedenkliche Chemikalien. Damit verschaffe es sich gegenüber der Großchemie klare Wett-
bewerbsvorteile. Tatsächlich ist ein wichtiger Wunsch der Unternehmensführung ein über die Regu-
lierung des Umgangs hinausgehendes Verbot des Einsatzes umweltschädlicher Substanzen. Für unter-
nehmerische Entscheidungen in der Auswahl von Zulieferern müssen transparente Ökobilanzen
vorhanden sein. Nur so könne sich nachhaltiges Handeln durchsetzen.
Neue Innovationen bedürfen intensiver Forschung und Entwicklung (FuE) sowohl in den Unternehmen
als auch im vorwettbewerblichen Bereich an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Gerade
in der Mikroelektronik ist dies jedoch aufgrund hoher Kosten und Risiken nur durch staatliche
Unterstützung zu leisten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die folgenden
Absätze stellen die Durchführung von FuE-Projekten in Sachsen dar, die einen Bezug zu nachhaltiger
Elektronik besitzen. Ziel ist es, aufzuzeigen, welches Potenzial die sächsische Elektronikindustrie sich
über Jahre erarbeitet hat, um sich in diesem Thema als Lösungsanbieter ins Spiel zu bringen.
Basis für die Analyse der bundesweiten Förderdaten bildet die Datenbank FÖRDERKATALOG. Sie
enthält Daten zur Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF),
zur direkten Projektförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in den FuE-
Bereichen Energie-, Luftfahrtforschung, Multimedia und InnoNet sowie zu den Projektförder-
maßnahmen „Energieforschung und Energietechnologien“ des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Der Förderkatalog beinhaltet Angaben zu den
Zuwendungsempfängern und verfügt über eine einheitliche Leistungsplansystematik, die eine
thematische Einordnung der Förderaktivitäten erlaubt. Vorhabenbeschreibungen, die die genaue
Analyse der Inhalte der geförderten Projekte erlauben würden, liegen jedoch nicht vor. Die Analyse der
Beteiligung sächsischer Organisationen bzw. Unternehmen an bundesweiten FuE-Projekten erfolgte
durch Identifikation von 198 Projekten (Teilvorhaben) sächsischer Zuwendungsempfänger mit
Startdatum zwischen 2007 und 2020 durch eine Volltextsuche hinsichtlich eines eindeutigen Bezugs zu
3
Christian Römlein (Geschäftsführer der intelligent fluids GmbH)
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 19
den Themen Elektronik und Umwelt, Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz. Diese Projekte bilden ein
Gesamtfördervolumen von 100,4 Mio. Euro. Dabei entfallen ca. 31,8 Mio. Euro auf Hochschulen, ca.
22,4 Mio. Euro auf öffentliche Institutionen (darunter auch Forschungsinstitute), 43,5 Mio. Euro auf
Unternehmen und ca. 2,7 Mio. Euro auf Kammern/Verbände.
Abbildung 4: Verteilung der Fördermittel auf Bundesmittel mit bzw. ohne die Mittel für Cool Silicon sowie die sächsischen Mittel
für Cool Silicon
Der überwiegende Teil der Fördermittel sowohl des Freistaats Sachsen als auch des Bundes entfallen
auf das Spitzencluster „Cool Silicon“. Allein der Freistaat hat das Spitzencluster mit insgesamt über
32 Mio. Euro gefördert, das damit eine der ersten und die größte regionale FuE-Aktivität im Bereich
nachhaltiger Elektronik im Freistaat Sachsen ist. Von 2009 bis 2015 führten die Mitglieder in diesem
Rahmen insgesamt 47 technisch-wissenschaftliche Forschungsprojekte zu den Themen Mikro- und
Nanotechnologie, Kommunikations- und Sensornetzwerke mit den Schwerpunkten Energie- und
Ressourceneffizienz erfolgreich durch. Die Ergebnisse in den Bereichen energieeffiziente Daten-
kommunikation und energieautarke Sensorik hielten Einzug in heute wichtige Technologien wie WLAN,
Mobilfunk oder RFID-basierte Nahfeldkommunikation, bekannt vom Auflegen der EC-Karte beim
Bezahlen oder von Transponderschlüsseln, und helfen dabei, die Digitalisierung nachhaltiger zu
gestalten. Mittlerweile haben sich die Aktivitäten verlagert. Das Projekt CoolCarbonConcrete führte
2018 im Rahmen eines „Innovationsforum zur Elektrik- und Elektronikintegration in der gebauten
Umwelt unter Nutzung der neuartigen Bauweise Carbonbeton“ Teile der Arbeiten mit dem Cluster
Carbon Concrete Composite e.V. zusammen, der sich mit Themen des nachhaltigen Bauens mit
Textilbeton befasst. Weiterhin gingen die Aktivitäten des Clusters Cool Silicon teilweise im Arbeitskreis
„Forschung & Entwicklung“ des Silicon Saxony e.V. auf.
Vor dem Spitzencluster gab es im Freistaat Sachsen kaum geförderte FuE-Aktivitäten mit Bezug zur
Nachhaltigkeit im Bereich Mikroelektronik, doch wirkte die Bündelung der Kompetenzen offenbar als
Initialzündung (siehe Abbildung 4). Mit Beginn der ersten Förderphase ist ein rasanter Anstieg der über
die Clusterförderung hinausgehenden FuE-Mittel ersichtlich. Nach dem Auslaufen dieser Förderphase
blieb das Niveau der eingeworbenen Fördermittel von 2015 bis 2020 im Durchschnitt auf etwa
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 20
4,7 Mio. Euro jährlich erhalten (2009 bis 2014: 5,7 Mio. Euro). Die Abweichungen in den einzelnen
Jahresscheiben geben ungefähr die Periodizität wieder, mit der die Themen in der Förderung des BMBF
wiederkehren. Diese liegt angepasst an die typische Laufzeit der Projekte von rund drei Jahren bei
ebenfalls drei bis vier Jahren.
Ganz aktuell sind sächsische Projekte in Fördermaßnahmen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und
Mikroelektronik besonders stark vertreten, beispielsweise erfolgt die Koordination von vier der zehn
Wettbewerbsprojekte des Innovationswettbewerbs „Green-ICT“ des BMBF durch sächsische Ein-
richtungen. Dies gibt der sächsischen Industrie die Voraussetzungen im Wettbewerb um nachhaltige
Elektronik, wie er von den Branchengrößen ausgerufen wird, Fuß zu fassen und eine Vorreiterrolle zu
übernehmen.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 21
4 Zusammenfassung und Ausblick
Auf Grundlage der in diesem ZukunftsImpuls vorgenommenen Bestandsaufnahme zur Relevanz von
Nachhaltigkeitszielen für künftige Wertschöpfungspotenziale in der Mikroelektronik sowie den
spezifischen technologischen und strukturellen Herausforderungen für eine nachhaltige Transformation
der Branche lassen sich folgende Kernaussagen festhalten:
→ Ohne einen Wandel hin zu nachhaltigen Produkten und Prozessen ist ein weiterer wirtschaftlicher
Erfolg in der Elektronikbranche bereits mittelfristig fraglich. Dieser Wandel birgt zahlreiche
Herausforderungen.
→ Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Mikroelektronik im Freistaat Sachsen
verfügen bereits über Technologien und Kompetenzen, um eine schrittweise Transformation ihrer
Wertschöpfung zu realisieren.
→ Nachhaltige Produkte und Prozesse sind bereits heute mit klaren ökonomischen Vorteilen
verbunden.
→ Aufgrund der Komplexität der Wertschöpfungsketten und der individuellen Situationen gibt es
keine pauschale Lösung für die nachhaltige Transformation der Branche. Nur wenn sich alle
Akteure kritisch und mit einem zukunftsgerichteten Gestaltungsanspruch mit den zur
Transformation erforderlichen Schritten auseinandersetzen und individuellen Handlungsbedarf
identifizieren und adressieren, können sie die wirtschaftlichen Potenziale heben und den Erfolg
der Branche langfristig sichern.
→ Aufgrund der Komplexität mikroelektronischer Wertschöpfungsstrukturen kann die nachhaltige
Transformation nur schrittweise gelingen.
Für Akteure aus Industrie, Wissenschaft und Politik ergeben sich daher folgende Handlungsfelder, die
als Grundalge für den weiteren industriepolitischen Diskurs im Freistaat dienen können:
→ Wissenstransfer und branchenübergreifenden Austausch stärken
Um das Innovationspotenzial in der sächsischen Elektronikbranche voll auszuschöpfen und bereits
kurzfristig einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu leisten, müssen alle relevanten
Akteure ihre bestehenden Kompetenzen zielgerichteter in Netzwerken zusammenbringen. Nur
durch Austausch und Kooperation können sie innovative, spezifische Lösungen erarbeiten und in die
Breite streuen. Die typischen Konsortien der präkompetitiven Verbundfördervorhaben erlauben es, ohne
Konkurrenzdruck Grundbausteine und Lösungsansätze für nachhaltige Produktionstechnologien und
innovative, nachhaltige Produkte zu erarbeiten. Dabei profitieren die Unternehmen von der großen
Breite der Wertschöpfungskette im Freistaat Sachsen. Es ist erforderlich, dabei auch branchen-
übergreifende Kooperationen zu entwickeln und zu etablieren. Das Potenzial ist im Freistaat vor-
handen, da über Akteure der Elektronikproduktion, wie der Halbleiterfertigung, der Baugruppenproduk-
tion und der Systemebene, hinaus regional zahlreiche relevante Lieferanten von Rohstoffen und Pro-
zessmedien sowie spezialisierte Recyclingunternehmen ansässig sind.
Der Silicon Saxony e.V. mit seinen rund 350 Mitgliedern aus der Elektronikbranche könnte ein Nukleus
für umfassende Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette sein. Allerdings ist unter den 18
Arbeitskreisen derzeit keiner mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit bzw. offensichtlich verwandten
Themen wie Energieeffizienz ersichtlich. Auch thematisch angrenzende Cluster wie der Organic
Electronics Saxony e.V. oder das Automation Network Dresden sowie das AMZ – Netzwerk
Automobilzulieferer Sachsen widmen sich dem Thema nur sehr punktuell. Im Vergleich dazu räumt auf
Bundesebene der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) mit den
Themenschwerpunkten „Energie“ und „Gesellschaft & Umwelt“ dem komplexen Gesamtzusammen-
hang von Nachhaltigkeit und elektronischer Wertschöpfung einen breiten Raum ein.
ZukunftsWerkstatt INDUSTRIESie können auch lesen