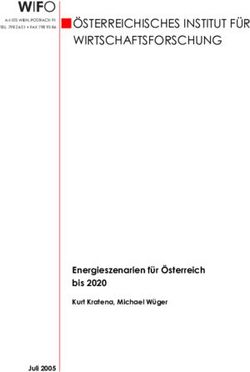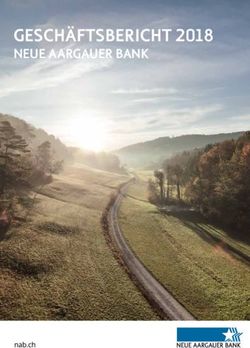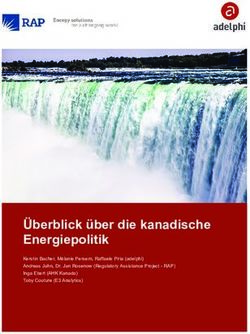ABSCHÄTZUNG DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG VON TREIBSTOFFABSATZ UND MINERALÖLSTEUEREINNAHMEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ASTRA/UVEK
ABSCHÄTZUNG DER KÜNFTIGEN
ENTWICKLUNG VON
TREIBSTOFFABSATZ UND
MINERALÖLSTEUEREINNAHMEN
GRUNDLAGENBERICHT
Bern, 20. Februar 2013
Mario Keller, Philipp Wüthrich
7254A_MINÖST_V6.DOCX
INFRAS
MÜHLEMATTSTRASSE 45
CH-3007 BERN
t +41 31 370 19 19
f +41 31 370 19 10
BERN@INFRAS.CH
BINZSTRASSE 23
CH-8045 ZÜRICH
WWW.INFRAS.CH2| INHALT ZUSAMMENFASSUNG _________________________________________________________ 4 RÉSUMÉ __________________________________________________________________ 7 SINTESI _________________________________________________________________ 10 1. Einleitung, Zweck ___________________________________________________ 13 Teil A _________________________________________________________________ 16 2. Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs _____________ 16 2.1. Der Kontext __________________________________________________________ 16 2.2. Absatz vs. Nachfrage ___________________________________________________ 17 2.3. Abgrenzungen, Segmentierung ___________________________________________ 19 2.4. Der Ansatz___________________________________________________________ 19 3. Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs ___________________ 22 3.1. Die Segmentierung im Strassenverkehr _____________________________________ 22 3.2. Die Modellschritte im Strassenverkehr ______________________________________ 22 3.2.1. Schritt 1: Fahrzeugbestandesentwicklung ___________________________________ 23 3.2.2. Schritt 2: spezifische Fahrleistungen _______________________________________ 25 3.2.3. Schritt 3: Modellierung des Energieverbrauchs _______________________________ 27 3.2.4. Schritt 4: Einbezug der Treibstoffqualität (Anteil biogener Treibstoffe) _____________ 31 4. Modellierung des Energieverbrauchs des Nonroad-Bereichs __________________ 32 4.1. Abgrenzungsfragen des Nonroad-Bereichs __________________________________ 32 4.2. Modellierung des Nonroad-Bereichs _______________________________________ 32 4.3. Modellierung des Energieverbrauchs des Schienenverkehrs ______________________ 33 4.3.1. Abgrenzungsfragen beim Schienenverkehr __________________________________ 33 4.3.2. Modellierung der Traktionsenergie des Schienenverkehrs _______________________ 34 4.3.3. Leistung- vs. Energiebedarf im Strombereich _________________________________ 37 5. Die Anwendung des Modells im Rahmen der Energieperspektiven 2050 _________ 38 5.1. Energiestrategie 2050 __________________________________________________ 38 5.2. Rahmendaten ________________________________________________________ 39 5.3. Kurz-Charakterisierung der Szenarien „WWB“, „NEP“ und „POM“ __________________ 40 5.4. Die wichtigsten Annahmen im Verkehrsbereich des Szenario‘s „WWB“ ______________ 41 5.5. Annahmen zum Tanktourismus ___________________________________________ 46 5.6. Ergebnisse Szenario „WWB“ gemäss Energieperspektiven 2050 ___________________ 46 INFRAS | 20. Februar 2013 | Inhalt
|3 Teil B _________________________________________________________________ 49 6. Die Berechnung der Mineralölsteuereinnahmen____________________________ 49 6.1. Die Komponenten der fiskalischen Einnahmen ________________________________ 49 6.2. Die bisherige Entwicklung der Einnahmen ___________________________________ 50 6.3. Vergleich Modell – EZV-Angaben __________________________________________ 51 7. Sensitivitätsrechnung zum Szenario „Weiter wie bisher“ ____________________ 53 7.1. Tanktourismus und Treibstoff-Preisentwicklung _______________________________ 53 7.2. Entwicklung eines vereinfachten Modells für den Tanktourismus __________________ 53 7.3. Neuberechnung des Energieverbrauchs („WWB-Sensitivität“) ____________________ 59 7.4. Ermittlung der Fiskaleinnahmen __________________________________________ 61 8. Einfluss von Preisvariationen auf die Nachfrage ___________________________ 64 8.1. Einleitende Bemerkungen _______________________________________________ 64 8.2. Elastizitäten zur Abschätzung des Nachfrageeffekts____________________________ 64 8.3. Illustration einer Wirkungsabschätzung ____________________________________ 66 Annex _________________________________________________________________ 68 ANNEX 1: Entwicklung des Energieverbrauchs im Sektor Verkehr bis 2011 __________________ 68 ANNEX 2: Gesamtverkehrsleistungsentwicklung in den Szenarien der Energieperspektiven _____ 69 ANNEX 3: Verkehrsmengengerüst im Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher) __________________ 70 ANNEX 4: Endenergieverbrauch im Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher) ____________________ 72 ANNEX 5: Kenngrössen und Steuertarife verschiedener Treibstoffe _______________________ 73 ANNEX 6: Treibstoffmengen des Tanktourismus bis 2012 _______________________________ 74 ANNEX 7: Fiskalerträge im Szenario „WWB-Sensitivität“________________________________ 75 Glossar _________________________________________________________________ 76 Literatur _________________________________________________________________ 79 INFRAS | 20. Februar 2013 | Inhalt
4|
ZUSAMMENFASSUNG
Die Finanzierung der Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr
auf Bundesebene (Spezialfinanzierung Strassenverkehr) ist hauptsächlich von den zweckge-
bundenen Einnahmen aus Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag abhängig. Diese wiede-
rum hängen letztlich vom Absatz bzw. Verbrauch der fossilen Treibstoffe wie Benzin und Diesel
ab. Seit 2009 ist der Absatz an Treibstoffen rückläufig - und damit einhergehend auch die ent-
sprechenden Steuereinnahmen1.
Aufgrund der geforderten und geförderten allgemeinen technologischen Entwicklung hin zu
verbrauchsärmeren Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit anderen Antriebsenergien wie bspw. Erd-
gas oder Elektrizität ist künftig mit einer weiteren Reduktion des spezifischen Treibstoffver-
brauchs zu rechnen. Diesen Trend verstärken u.a. auch umweltpolitische Massnahmen. So dür-
fen – gemäss dem im März 2011 revidierten CO2-Gesetz – neue Personenwagen ab 2015 im Flot-
tendurchschnitt nicht mehr als 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen. Weitere Absenkungs-
vorgaben sollen folgen, auch wenn diese noch nicht im Detail spezifiziert sind. Ähnliche Mass-
nahmen sind auch für andere Fahrzeugkategorien, namentlich die leichten Nutzfahrzeuge, in
Diskussion.
Vor diesem Hintergrund schätzt der vorliegende Bericht die künftige Entwicklung der Fis-
kalerträge und insbesondere die Einnahmen aus Mineralölsteuer und -steuerzuschlag ab. Basis
dafür ist der im Jahr 2012 vorgelegte Grundlagenbericht „Die Energieperspektiven für die
Schweiz bis 2050“ des Bundesamtes für Energie, welche in verschiedenen Szenarien die künftige
Entwicklung des Energie- und Treibstoffverbrauchs abschätzen. Ergänzend wurde neu ein Be-
rechnungstool entwickelt, mit dem sich abschätzen lässt, wie sich Veränderungen der Mineralöl-
steuertarife auf die Einnahmenentwicklung auswirken. Dabei spielen zwei Effekte eine Rolle:
› Zum einen beeinflusst das Preisniveau die Nachfrage, d.h. höhere oder tiefere Mineralölsteu-
ern werden den Absatz vermindern bzw. tendenziell erhöhen und sich damit direkt auch auf
die Einnahmen auswirken.
› Zum andern spielt der sog. Tanktourismus eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Tanktouris-
mus ergibt sich als Folge von Treibstoffpreisdifferenzen zwischen der Schweiz und dem Aus-
land. Eine einseitige Variation der Mineralölsteuertarife verändert diese Preisdifferenzen und
1 Als Basis für diesen Bericht waren Angaben bis 2011 verfügbar. Inzwischen ist bekannt, dass der Treibstoff-Absatz (Benzin +
Diesel, ohne Flugpetrol) im Jahr 2012 wieder marginal zugenommen hat (+0.7% gegenüber dem Vorjahr). Benzin nahm weiter-
hin ab (-3.5%), Diesel hingegen markant zu (+6.1%), was primär auf den nach wie vor steigenden Anteil von Dieselpersonen-
wagen zurückgeführt werden kann. Diesel wird zudem stark im Bau- und Transportgewerbe eingesetzt, der dank stabiler Bin-
nenkonjunktur einen hohen Absatz verzeichnet.
INFRAS | 20. Februar 2013 | ZUSAMMENFASSUNG|5 je nach Ausmass dieser Variation wird sich der Tanktourismus verändern, er kann auch das Vorzeichen wechseln, aus „Treibstoffexport“ kann „Treibstoffimport“ werden oder umgekehrt. Der vorliegende Bericht erläutert zuerst das Modell, mit dem der Mineralölabsatz nachgebildet wird, geht dann auf das Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher) der Energieperspektiven 2050 ein und zeigt anschliessend auf, wie sich die Mineralölsteuereinnahmen entwickeln werden. Auf- tragsgemäss werden keine konkreten Vorschläge zur Variation der Mineralölsteuertarife ge- macht. Vielmehr wird das ASTRA auf der Basis des hier entwickelten Mengengerüsts und des Berechnungstools die Wirkung solcher Tarifvariationen separat aufzeigen. Im Rahmen der Erar- beitung hat es sich als notwendig herausgestellt, die Mengengerüste aus den Energieperspekti- ven namentlich unter dem Aspekt Tanktourismus zu präzisieren und neu zu justieren, da dieser sich als Folge der wechselkursbedingten Änderungen der Preisrelationen der Treibstoffe in den Grenzgebieten in den letzten Jahre spürbar verändert hat. In der Folge ergibt sich im vorliegen- den Bericht eine leicht erhöhte Treibstoffabsatzentwicklung (hier als Szenario „WWB- Sensitivität“ bezeichnet) im Vergleich zum ursprünglichen Szenario „WWB“ der Energieperspek- tiven 2050. Ergebnisse Figur Z-1 zeigt, dass die Fiskaleinnahmen in Zukunft stetig abnehmen werden. Die Reduktions- rate beträgt knapp 1% pro Jahr. Die Mineralölsteuereinnahmen (Nettoerträge) werden im 2015 somit gemäss Modellrechnung rund 215 Mio. CHF tiefer ausfallen als im Jahr 2010. Diese Fehlbe- träge im Vergleich zu 2010 werden im Jahr 2020 auf gut 400 Mio. CHF, im 2025 auf 650 und im Jahr 2030 auf gut 900 Mio. CHF anwachsen. Dies ist die Kehrseite der geforderten und geförder- ten allgemeinen technologischen Entwicklung hin zu verbrauchsärmeren Fahrzeugen oder Fahr- zeugen mit anderen Antriebsenergien. INFRAS | 20. Februar 2013 | ZUSAMMENFASSUNG
6|
ENTWICKLUNG DER FISKALEINNAHMEN, BASIEREND AUF DEM SZENARIO „WEITER WIE BISHER -
SENSITIVITÄT“)
Fiskaleinnahmen REFERENZ: WWB
7'000
6'000
5'000 MWSt
4'000 weitere Gebühren (Carbura)
Mio CHF
Weitere Abgaben
3'000 Mineralölsteuerzuschlag
2'000 Mineralölsteuer
1'000
-
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Figur Z-1 Brutto-Fiskaleinnahmen im Szenario „WWB-Sensitivität“. Der Nettoertrag ist um ca. 4.5% tiefer als der Bruttoer-
trag; die Differenz ergibt sich aufgrund von Rückerstattungen und Erhebungskosten.
INFRAS | 20. Februar 2013 | ZUSAMMENFASSUNG|7
RÉSUMÉ
Au niveau fédéral, le financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière (fi-
nancement spécial pour la circulation routière) dépend principalement des recettes à affectation
obligatoire provenant de l’impôt et de la surtaxe sur les huiles minérales, lesquelles sont à leur
tour tributaires de la consommation de carburants fossiles comme l’essence et le diesel. Depuis
2009, les ventes de carburants reculent et, partant, les recettes fiscales correspondantes aussi2.
Compte tenu de la nécessité de développer des technologies permettant de concevoir des
véhicules moins gourmands en énergie ou à propulsion alternative (par ex. gaz naturel, électric-
ité) et des mesures d’encouragement en ce sens, il faut s’attendre à un nouveau recul de la con-
sommation spécifique de carburant. Une tendance renforcée notamment par la politique envi-
ronnementale mise en œuvre. Ainsi, conformément à la loi sur les émissions de CO2 révisée en
mars 2011, les nouvelles voitures de tourisme ne devront pas émettre plus de 130 grammes de
CO2 par kilomètre en moyenne du parc automobile à partir de 2015. D’autres prescriptions en ce
sens suivront, même si elles ne sont pas encore complètement définies. Des mesures similaires
sont également à l’étude pour d’autres catégories de véhicules, notamment les véhicules utili-
taires légers.
Dans ce contexte, le présent rapport livre une estimation de l’évolution future des recettes
fiscales et plus particulièrement de celles qui proviennent de l’impôt et de la surtaxe sur les
huiles minérales. Il se fonde sur le rapport de synthèse publié par l’Office fédéral de l’énergie et
intitulé „Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050”, qui évalue l’évolution future de la
consommation d’énergie et de carburants sous la forme de divers scénarios. Par ailleurs, un
nouvel outil de calcul a été développé pour évaluer comment la modification du barème de
l’impôt sur les huiles minérales se répercute sur l’évolution des recettes. A cet égard, deux effets
sont déterminants :
› D’une part, le niveau du barème influe sur la demande, autrement dit une augmentation ou
une diminution de l’impôt sur les huiles minérales tendra à faire baisser ou progresser les
ventes et aura donc aussi un effet direct sur les recettes.
2 Le rapport se fonde sur des données valables jusqu’en 2011. Dans l’intervalle, on sait que les ventes de carburant (essence +
diesel, hors kérosène) ont de nouveau augmenté de façon marginale en 2012 (+0,7 % par rapport à l’année précédente). La
consommation d’essence a continué de baisser (-3,5 %) et celle de diesel a par contre fortement augmenté (+6,1 %), en raison
principalement de l’accroissement persistant du nombre de voitures de tourisme roulant au diesel. Ce carburant est en outre
très utilisé dans les secteurs de la construction et des transports, qui enregistre un chiffre d’affaires élevé à la faveur d’une con-
joncture interne stable.
INFRAS | 20. Februar 2013 | RÉSUMÉ8| › D’autre part, le tourisme dit „à la pompe” joue un rôle non négligeable. Il résulte de différences de prix du carburant entre la Suisse et l’étranger. Une variation unilatérale du barème de l’impôt sur les huiles minérales modifie cette différence de prix et en fonction de son ampleur, influe aussi sur l’évolution du tourisme à la pompe. En ce qui concerne celui-ci, l’effet peut s’inverser : les importations peuvent devenir des exportations et vice-versa. Le présent rapport explique tout d’abord le modèle selon lequel sont représentées les ventes d’huiles minérales, aborde ensuite le scénario PPA (Poursuite de la politique énergétique ac- tuelle) des „Perspectives énergétiques 2050” puis montre enfin quelle devrait être l’évolution des recettes tirées de l’impôt sur les huiles minérales. Conformément au mandat, il ne contient aucune proposition concrète concernant la variation tarifaire de cet impôt. Les chiffres et outils de calcul présentés ici permettront plutôt à l’OFROU de mettre en évidence séparément l’impact de ces variations tarifaires. Lors de l’élaboration du rapport, il s’est avéré nécessaire de préciser et d’adapter les chiffres des perspectives énergétiques notamment sous l’angle du tourisme à la pompe, étant donné que celui-ci a changé de façon notable en raison de la modification des rapports de prix des carburants, due aux taux de change, qui a été observée ces dernières années dans les régions limitrophes. Il en résulte une évolution légèrement à la hausse des ventes de carburant (désignée ici comme scénario „PPA – sensibilité”) par rapport au scénario „PPA” initial des perspectives énergétiques 2050. Conclusions L’illustration R-1 montre que les recettes fiscales seront en recul constant à l’avenir. Cette baisse atteindra à peine 1 % par an. D’après le calcul modélisé, les recettes tirées de l’impôt sur les huiles minérales (recettes nettes) connaîtront donc en 2015 une diminution de quelque 215 millions de francs par rapport à 2010. Ce déficit passera à 400 millions au moins en 2020, à 650 millions en 2025 et à 900 millions au moins en 2030. Telle est la contrepartie du progrès techno- logique général et de l’apparition de véhicules moins gourmands en énergie ou à propulsion alternative. INFRAS | 20. Februar 2013 | RÉSUMÉ
|9 EVOLUTION DES RECETTES FISCALES, SUR LA BASE DU SCENARIO „Poursuite de la politique éner- gétique actuelle – sensibilité“ Illustration R-1 Recettes fiscales (brutes) avec le scénario „PPA – sensibilité“. Le revenu net tiré de l’impôt et de la surtaxe sur les huiles minérales est inférieur d’environ 4,5 % au revenu brut; cet écart s’explique par les remboursements et les coûts de perception. INFRAS | 20. Februar 2013 | RÉSUMÉ
10|
SINTESI
Il finanziamento dei compiti e delle spese legate al traffico stradale a livello federale (finanzia-
mento speciale per il traffico stradale) dipende principalmente dai proventi a destinazione vin-
colata dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali, i quali a loro
volta dipendono dalla vendita e dai consumi di carburanti fossili, come la benzina e il diesel. Dal
2009 la vendita di carburanti è in calo, e di conseguenza anche il gettito fiscale3.
Lo sviluppo tecnologico richiesto e promosso per giungere alla produzione di veicoli a con-
sumi più ridotti alimentati con energie alternative, ad esempio gas o elettricità, fa prevedere
un’ulteriore riduzione dei consumi specifici di carburante, una tendenza rafforzata anche dalle
misure adottate in ambito ambientale: dal 2015 le emissioni delle automobili nuove saranno
limitate per legge a 130 grammi di CO2 a chilometro in media sul parco veicoli, mentre sono in
arrivo altre prescrizioni di riduzione, attualmente non ancora definite nei dettagli; misure
analoghe sono discusse anche per altre categorie di veicoli, in particolare gli autofurgoni leg-
geri.
Il presente rapporto stima l’andamento futuro del gettito fiscale, con particolare riguardo
all’imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali prendendo a riferimento
lo studio Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050 (prospettive energetiche per la Sviz-
zera fino al 2050) pubblicato nel 2012 dall’Ufficio federale dell’energia, che esamina diversi
scenari del futuro andamento dei consumi di energia e di carburante. È stato inoltre messo a
punto un nuovo strumento di calcolo che permette di stimare l’impatto delle variazioni
d’imposta sulle entrate. Due i fattori chiave:
› il prezzo, che influisce sulla domanda: un’imposta sugli oli minerali più alta o più bassa fa
aumentare o diminuire le vendite e quindi influisce direttamente sulle entrate;
› il cosiddetto „turismo del pieno”, al quale va ascritto un ruolo non trascurabil, risultato delle
differenze di prezzo del carburante tra la Svizzera e l’estero. Se le aliquote dell’imposta sugli
oli minerali cambiano in maniera unilaterale, cambia anche questo rapporto tra i prezzi andan-
do a modificare il predetto fenomeno del turismo del pieno che può mutare di segno, ovvero
trasformarsi da esportazione in importazione di carburante o viceversa.
3 Il rapporto si è basato sui dati disponibili nel 2011; nel 2012 la vendita di carburante (benzina e diesel, carburante per aeromo-
bili escluso) ha fatto registrare un leggero aumento (+0.7% rispetto all’anno precedente), con un ulteriore calo della benzina (-
3.5%) e un forte aumento del diesel (+6.1%), riconducibile in primo luogo all’aumento delle autovetture diesel in circolazione.
Il diesel è inoltre molto usato nel settore edile e dei trasporti. Grazie alla situazione congiunturale stabile in questo ambito le
vendite sono quindi elevate.
INFRAS | 20. Februar 2013 | SINTESI|11 Il presente rapporto illustra dapprima il modello applicato per stimare la vendita di oli minerali, spiegando in seguito lo scenario „WWB” (Status quo) analizzato dal suddetto studio dell’Ufficio federale dell’energia, con una previsione del gettito dell’imposta sugli oli minerali. Non essendo previsto nell’incarico, non sono state formulate proposte concrete in merito alla variazione delle aliquote d’imposta. In base a quanto analizzato in questa sede e allo strumento di calcolo, l’USTRA potrà invece illustrare separatamente l’effetto di queste variazioni. Durante la fase di elaborazione è emersa la necessità di precisare e adattare l’evoluzione delle quantità nelle di- verse prospettive energetiche, in particolare dal punto di vista del predetto fenomeno del turis- mo del pieno, che negli ultimi anni è mutato sensibilmente per effetto dell’andamento del cam- bio che ha influito sui prezzi di carburante nelle zone di confine. Il presente rapporto mostra un leggero aumento della vendita di carburante (indicato come scenario „Sensitività WWB”) rispet- to a quanto previsto nello scenario originario „WWB” (Status quo). Risultati Il grafico S-1 evidenzia un andamento delle entrate fiscali in continua diminuzione (ca. -1 % all’anno). Secondo il modello di calcolo adottato, nel 2015 i proventi (netti) dell’imposta sugli oli minerali scenderanno di circa 215 milioni di franchi rispetto al 2010, calo che raggiungerà i 400 milioni nel 2020, i 650 milioni nel 2025 e i 900 milioni nel 2030. È questo il rovescio della medaglia dello sviluppo tecnologico richiesto e promosso per giungere alla produzione di veicoli a consumi più ridotti alimentati con energie alternative. INFRAS | 20. Februar 2013 | SINTESI
12| ANDAMENTO DELLE ENTRATE FISCALI SECONDO LO SCENARIO „SENSITIVITÀ WWB” Fig. S-1 Entrate fiscali lorde, scenario Sensitività WWB. I proventi netti dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali sono di ca. il 4,5 per cento inferiori ai proventi lordi; la differenza risulta dai rimborsi e dai costi di riscossione. INFRAS | 20. Februar 2013 | SINTESI
|13
1. EINLEITUNG, ZWECK
Die Finanzierung der Strassenaufgaben auf Bundesebene erfolgt über die „Spezialfinanzierung
Strassenverkehr (SFSV)“ und ist hauptsächlich von den zweckgebundenen Einnahmen aus der
Mineralölsteuer abhängig. Die künftige Finanzierung der SFSV hängt somit im Wesentlichen von
der Entwicklung der Mineralölsteuereinnahmen und diese wiederum letztlich vom Absatz bzw.
Verbrauch der fossilen Treibstoffe wie Benzin und Diesel ab, welche heute die Hauptbesteue-
rungsquelle bilden. Von 2009 bis 2011 war die insgesamt besteuerte Menge an Treibstoffen rück-
läufig und damit auch – bei unveränderten Steuertarifen – die Steuereinnahmen4. Hier interes-
siert die Frage, wie sich der Absatz von für die SFSV relevanten Treibstoffen/Energieträgern und
damit die Mineralölsteuereinnahmen künftig entwickeln werden.
Aufgrund der allgemeinen technologischen Entwicklung im Fahrzeugbau (speziell bei der
Antriebstechnik) hin zu verbrauchsärmeren Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit anderen An-
triebsenergien wie bspw. Erdgas oder Elektrizität ist künftig mit einer Reduktion des spezifi-
schen Treibstoffverbrauchs zu rechnen. In die gleiche Richtung kann auch eine weltweit wach-
sende Nachfrage nach Energie und damit eine zu erwartende Verteuerung der Energieträger
deuten. Zudem verstärken umweltpolitische Massnahmen verschiedener Länder diesen Trend
bzw. waren auch Auslöser dafür. Das gilt auch für die Schweiz. So haben die eidgenössischen
Räte im März 2011 eine Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen von neuen Personenwagen
beschlossen: bis Ende 2015 soll der Flottendurchschnitt von Neuwagen auf 130 g CO2/km absin-
ken. Das revidierte CO2-Gesetz sieht darüber hinaus weitere Absenkungen vor, auch wenn diese
noch nicht im Detail spezifiziert sind. Diese dürften weitgehend durch die Entwicklungen im
Ausland geprägt sein. So hat die EU bereits 2009 für Neuwagen einen Zielwert ab dem Jahr 2020
von durchschnittlich 95 g CO2/km festgelegt.
Vor diesem Hintergrund erläutert dieser Bericht derzeit auf Bundesebene verfügbare Grund-
lagen zur Entwicklung von Verkehr und Energieverbrauch. Die aktuellsten Angaben dazu stam-
men aus den Energieperspektiven 2050 des BFE (BFE 2012a), die in verschiedenen Szenarien die
künftige Entwicklung des Energieverbrauchs und des Treibstoffverbrauchs im Besonderen ab-
schätzen. Der vorliegende Bericht zeigt ergänzend dazu auf, wie sich die Mineralölsteuerein-
nahmen entwickeln werden. Zudem werden – und das ist eine Erweiterung bzw. Vertiefung ge-
4 Als Basis für diesen Bericht waren Angaben bis 2011 verfügbar. Die erst nach Fertigstellung des Berichts vorliegenden Absatz-
zahlen zeigen, dass der Treibstoff-Absatz (Benzin + Diesel, ohne Flugpetrol) 2012 erstmals wieder marginal zugenommen hat
(+0.7% gegenüber dem Vorjahr). Benzin nahm weiterhin ab (-3.5%), Diesel hingegen markant zu (+6.1%), was primär auf den
nach wie vor steigenden Anteil von Dieselpersonenwagen zurückgeführt werden kann. Diesel wird zudem stark im Bau- und
Transportgewerbe eingesetzt, der dank stabiler Binnenkonjunktur einen hohen Absatz verzeichnet.
INFRAS | 20. Februar 2013 | Einleitung, Zweck14|
genüber den Energieperspektiven – Abschätzungen gemacht, wie sich Veränderungen der Mine-
ralölsteuertarife auf die Einnahmenentwicklung auswirken werden. Eine mögliche Erhöhung
bzw. Absenkung der Mineralölsteuertarife wird – bei gleicher Nachfrage – selbstredend die Mine-
ralölsteuereinnahmen anheben oder senken. Allerdings spielen zwei zusätzliche Effekte eine
Rolle, welche in dieser Form bei den Energieperspektiven nicht im Vordergrund standen:
› Zum einen beeinflusst das Preisniveau die Nachfrage, d.h. höhere oder tiefere Mineralölsteu-
ern werden den Absatz tendenziell vermindern bzw. erhöhen und sich damit direkt auch auf
die Einnahmen auswirken.
› Zum andern spielt der sog. Tanktourismus eine nicht zu vernachlässigende Rolle, da eine ein-
seitige Variation der Mineralölsteuertarife die Preisdifferenzen der Treibstoffe zwischen der
Schweiz und dem Ausland verändert. Je nach Ausmass dieser Differenz wird sich der Tanktou-
rismus verändern, er kann auch das Vorzeichen wechseln, d.h. aus „Treibstoffexport“ kann
plötzlich „Treibstoffimport“ werden oder umgekehrt.
Bei den Energieperspektiven waren diese Punkte nicht im Fokus. Grundlage bildeten die Men-
gengerüste sowie die nationalen und internationalen Preise und Wechselkurse des Kalibrie-
rungsjahres 2010. Aufgrund der inzwischen eingetretenen wechselkursbedingten Änderungen
der Preisrelationen der Treibstoffe in den Grenzgebieten wurde der Aspekt Tanktourismus neu
beleuchtet und das Modell neu justiert. Der Bericht illustriert anschliessend beispielhaft die
Wirkung einer Steuersatzerhöhung. Es ist allerdings nicht Aufgabe dieses Berichts, A-fonds-
Evaluationen durchzuführen oder konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Vielmehr wurde zuhan-
den des ASTRA ein Rechentool entwickelt, das die Wirkung solcher Variationen abschätzt.
Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:
› Teil A erläutert die verfügbaren bzw. verwendeten Grundlagen zu Verkehr und Energie, auf
denen die Abschätzungen der Entwicklung der Mineralölsteuereinnahmen basieren. Das be-
zieht sich im Wesentlichen auf das sog. Bottom-up-Modell Verkehr, das heute von einzelnen
Ämtern des UVEK (namentlich BFE und BAFU) eingesetzt wird. Die Kapitel 2 bis 4 erläutern
dieses Modell, um Interessierten zu ermöglichen, Mengengerüste und Berechnungsweise zu
verstehen und die Modellergebnisse nachzuvollziehen, zumal die künftige Entwicklung ent-
scheidend von einigen einfliessenden Annahmen abhängig ist. Kapitel 5 illustriert die Anwen-
dung und Ergebnisse für das Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher). Dieses stützt sich auf die
heute geltenden rechtlichen Grundlagen und steht deshalb in diesem Bericht im Vordergrund.
› Teil B geht spezifischer auf die Entwicklung der Mineralölsteuereinnahmen ein. Kapitel 6 zeigt
die Berechnung der Mineralölsteuereinnahmen und die heutigen Steuertarife auf. In Kapitel 7
wird die Treibstoffpreisentwicklung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland sowie der
INFRAS | 20. Februar 2013 | Einleitung, Zweck|15 damit zusammenhängende Tanktourismus analysiert. Auf dieser Basis wird ein vereinfachtes Modell für den Tanktourismus abgeleitet und auf die Angaben aus dem Bericht Energieper- spektiven 2050 adaptiert, woraus sich leicht veränderte neue Zahlen ergeben. Kapitel 8 erör- tert den Effekt von Preisvariationen auf die Nachfrage und fügt eine Illustration an. INFRAS | 20. Februar 2013 | Einleitung, Zweck
16|
TEIL A
2. DIE BOTTOM-UP-MODELLIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS DES
VERKEHRS
2.1. DER KONTEXT
Einzelne Ämter des UVEK (namentlich BFE und BAFU) setzen heute ein sog. Bottom-up-Modell
ein. Dieses Modell bildet den Energieverbrauch in den einzelnen Verwendungssegmenten ab,
von Personenwagen über Busse und Bahnen bis hin zum sog. Non-Road-Bereich wie Baumaschi-
nen und Traktoren, welche traditionellerweise auch dem Verkehr zugerechnet werden. Ähnliche
Bottom-up-Modelle existieren auch für andere Sektoren (Haushalte, Industrie etc.) und werden
jeweils bei sektorübergreifenden Fragestellungen eingesetzt, namentlich bei den alljährlich
durchgeführten Ex-Post-Analysen (im Auftrag des BFE) oder bei Energieperspektiven. Mit diesen
Modellen werden die Energieverbräuche für die einzelnen Verwendungszwecke auf Basis der
Mengenkomponenten und der spezifischen Verbräuche ermittelt. Für die „Mengenkomponen-
ten“ – das sind z.B. Fahrzeugbestände oder Fahrleistungen – werden soweit als möglich statisti-
sche Grundlagen des BFS oder auch offizielle prognostische Angaben herangezogen wie z.B.
Verkehrsperspektiven des UVEK, welche ihrerseits auf Modellierungen des ARE basieren. Das
Bottom-up-Modell Verkehr wurde in den vergangenen Jahren von INFRAS im Auftrag von BAFU
und BFE erarbeitet und wird laufend weiterentwickelt, dies in der Regel wenn neue Fragestel-
lungen zu bearbeiten sind. Dieses Modell des Verkehrssektors wird auch für die Schadstoffemis-
sionsperspektiven (im Auftrag des BAFU) eingesetzt, d.h. es erlaubt nicht nur die Berechnung
des Energieverbrauchs, sondern auch der Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen.
Das Bottom-up-Modell Verkehr wurde letztmals für die Erarbeitung der Energieperspektiven
2050 eingesetzt (BFE 2012a). Darin lag der Schwerpunkt auf der mittel- bis längerfristigen Per-
spektive, indem es auch absehbare strukturelle Änderungen namentlich im Fahrzeugpark (d.h.
bei der Antriebstechnik) mit einschloss. Es stellt das gegenwärtig aktuellste Mengengerüst zu
Verkehr und Energie auf Bundesebene dar. Deshalb soll auf diesen Grundlagen auch die Ab-
schätzung der Entwicklung der Mineralölsteuereinnahmen erfolgen. Ausgangspunkt der Überle-
gungen zur Entwicklung der Mineralölsteuereinnahmen ist das in den Energieperspektiven 2050
entwickelte Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher“), das sich auf die heute geltenden rechtlichen
Grundlagen abstützt.
INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs|17
2.2. ABSATZ VS. NACHFRAGE
Die Mineralölsteuereinnahmen hängen direkt vom Treibstoffabsatz ab. Nun ist für die Modellie-
rung im Sektor Verkehr zu unterscheiden zwischen „Absatz“, d.h. den an den Tanksäulen abge-
setzten/verkauften Mengen (Absatzprinzip), und dem „Verbrauch“, d.h. der Energie, die auf den
Verkehrswegen der Schweiz „verbraucht“ wird (Territorialprinzip). Die Erfassung und Darstel-
lung des Absatzes basiert auf statistischen Grundlagen (GEST, Gesamtenergiestatistik) und wird
differenziert nach Energieträgern, während der Verbrauch „bottom up“ modelliert wird, d.h. es
wird der Energiebedarf je einzeln für die verschiedenen Verwendungszwecke und Verbraucher-
segmente ermittelt und anschliessend aggregiert. Bei dieser Modellierung wird die Unterschei-
dung nach Energieträgern beibehalten, so dass die summierten Modellwerte mit dem Absatz
verglichen werden können. Absatz und Verbrauch sind in der Regel nicht identisch, weil u.a. als
Folge von Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und den angrenzenden Ländern Importe oder
Exporte von Treibstoffen über die Grenzen hinweg bestehen. „Tanktourismus“ wird dabei im
Modell als Residualgrösse mitgeführt, um so eine Konsistenz zwischen Absatz und Verbrauch zu
erhalten. Darauf wird in Kapitel 7 speziell eingegangen.
Relevant sind in der Regel vor allem die Absatzzahlen. Dies gilt namentlich für die Mineral-
ölsteuereinnahmen, da diese absatzabhängig sind. Dasselbe gilt auch für die Treibhausgas-
Emissionen, da diese gemäss internationalen Vereinbarungen (wie etwa dem Kyoto-Protokoll)
nach dem Absatzprinzip und nicht nach dem Territorialprinzip berechnet werden.
Die nachstehende Figur 1 zeigt links den Energieverbrauch nach Energieträgern (Absatz-
prinzip) 2010 gemäss GEST (Gesamtenergiestatistik), rechts den gleichen Energieverbrauch,
jedoch gemäss Verwendungszwecken auf der Basis des derzeit verwendeten Bottom-up-Modells.
Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln zeigen auf, wie der Energieverbrauch in den ein-
zelnen Verbrauchergruppen modelliert wird. Figur 1 zeigt die Entwicklung des Energieabsatzes
1990-2011 (Details siehe Annex 1). Daraus geht hervor, dass der Verkehr zu rund 95% von fossi-
len Treibstoffen abhängig ist. Zudem nimmt der Benzinabsatz seit ca. 2000 ab und der Dieselab-
satz zu. Die Summe von Benzin und Diesel – den beiden entscheidenden Energieträgern des
Landverkehrs – ist seit 2009 rückläufig.
Sonderfall Flugverkehr:
Ein Sonderfall ist der Flugverkehr: Das Bottom-up-Modell Verkehr bildet den Flugverkehr nicht
ab. Gemäss internationalen Konventionen wird zwischen Inlandverkehr (alle Flüge von A nach B
innerhalb der Schweiz) und Auslandverkehr (alle Flüge von der Schweiz zu einer ausländischen
Destination) unterschieden. Die (geringe) Treibstoffmenge von rund 3.5 PJ (von total 61.2 PJ)
aus dem Inlandverkehr wird im Rahmen des Kyoto-Protokolls der Schweiz zugerechnet und ist
INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs18|
damit Teil des Bottom-up-Models. Aufgrund des geringen Anteils wird dieser Teil aber nicht
eigens modelliert. Die weitaus grössere Treibstoffmenge aus dem Auslandverkehr gehört zu den
so genannten „Bunkerfuels“, ist nicht Teil des Bottom-up-Models und wird deshalb hier nicht
weiter thematisiert.
ENERGIEKONSUM 2010 DES VERKEHRS
NACH ENERGIETRÄGERN NACH VERWENDUNGSZWECKEN
(ABSATZPRINZIP, GEMÄSS GEST) (GEMÄSS BOTTOM-UP-MODELL)
350 350
300 300 Flugverkehr (Internat.)
Kerosen
Tanktourismus (B, D)
250 250 Flugverkehr (nat).
Elektrizität
Off-Road
200 200
Biogene Tst. PJ Wasser
PJ
150 150 Schiene GV
Erdgas Schiene PV
100 100 Strasse Güter-V.
Diesel
Strasse Pers-V.
50 50
Benzin
0 0
2010 2010
Figur 1 Gemäss Energiestatistik betrug der Energieverbrauch des Sektors Verkehr (einschliesslich des sog. „Nonroad-
Bereichs“) gut 300 PJ/a. Links ist der Energieverbrauch nach Energieträgern gemäss GEST dargestellt, rechts eine model-
lierte Darstellung nach Verwendungszwecken.
ENTWICKLUNG DES TREIBSTOFF-ABSATZES (QUELLE: GESAMTENERGIESTATISTIK)
350
300
250
200
PJ/a
150
100
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Benzin Diesel Kerosen Elektrizität Biogene total übrige fossile Treibstoffe
Figur 2 Entwicklung des Energieabsatzes 1990-2011 (Detailzahlen siehe Annex 1). Benzin ist seit ca. 2000 rückläufig, dafür
nimmt Diesel laufend zu. Die Summe von Benzin und Diesel war von 2009 bis 2011 rückläufig. Die biogenen Treibstoffe
spielen quantitativ praktisch keine Rolle, auch Erdgas als Treibstoff ist vergleichsweise unbedeutend.
INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs|19
2.3. ABGRENZUNGEN, SEGMENTIERUNG
Segmente des Verkehrssektors
Dem Sektor Verkehr werden im Bottom-up-Modell folgende Segmente zugerechnet:
VERBRAUCHSKLASSEN, VERWENDUNGSZWECKE
Onroad (Strassenverkehr) Nonroad / Verkehr Nicht-Verkehr
Fossile Treibstoffe: Fossile Treibstoffe: Fossile Treibstoffe:
- Personenverkehr: - Schienenverkehr (v.a. - - Land-, Forstwirtschaft,
Personenwagen, Reisebusse, Li- Rangierbetrieb und Bauzüge) - Baumaschinen,
nienbusse, motorisierte Zweirä- - Schifffahrt - Industrie,
der - Flugverkehr (national) - Militär,
- Güterverkehr: - Flugverkehr (international) - Mobile Geräte (Gartenpflege)
Leichte u. Schwere Nutzfahrzeu-
ge
Elektrizität: Elektrizität:
analog zu - Öff. Personennahverkehr (Tram,
Trolleybus)
- Bahn: Personenverkehr
- Bahn: Güterverkehr
Tabelle 1 Aufteilung der Verbraucher im Kontext Verkehr in verschiedene Gruppen
2.4. DER ANSATZ
Der Berechnungsansatz in den Bottom-up-Modellen ist vergleichsweise einfach:
Der Energieverbrauch ergibt sich aus der Multiplikation der Aktivität und dem spezifischen Ver-
brauch, wobei die Aktivität typischerweise als Fahrleistung ausgedrückt wird (FzKm), die sich
ihrerseits ergibt aus dem Fahrzeugbestand multipliziert mit der mittleren Jahresfahrleistung
(km). Der Verbrauchsfaktor seinerseits wird als spezifischer Energieverbrauch ausgedrückt (z.B.
L Treibstoff/100km oder in g Treibstoff/Fzkm). Die Komplexität eines Bottom-up-Modells ergibt
sich primär aus der weiteren Differenzierung nach Segmenten, indem diese Berechnung für viele
einzelne Fahrzeuggruppen durchgeführt werden muss, weil der Energieverbrauch je Fahrzeug-
INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs20|
gruppe interessiert, dieser aber je nach Segment (PW, Liefer-, Lastwagen etc.), Grösse, Alter,
Technologie etc. sehr unterschiedlich ausfällt und überdies je nach Verkehrssituation variiert
(z.B. Autobahn oder städtischer Verkehr, flüssiger oder stockender Verkehr). Dazu kommen
weitere Einflussfaktoren wie etwa Kaltstart-Verhalten, zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlagen
u.a.m. Deshalb sind Bottom-up-Modelle äusserst „datenhungrig“.
Für die Vergangenheitsentwicklung kann man sich – soweit verfügbar – auf empirische
Grundlagen abstützen. Für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung sind zwangsläufig
Annahmen zu treffen. Zu einzelnen Parametern, etwa der Entwicklung der Verkehrsleistung,
bestehen gewisse Vorgaben aus anderem Kontext (z.B. UVEK-Verkehrsperspektiven von Seiten
des ARE). Für andere Grössen, etwa der Einschätzung der Entwicklung der Flottenzusammenset-
zung (z.B. Einführung Elektromobilität) oder des spezifischen Verbrauchs, sind Hypothesen zu
formulieren. Üblicherweise wird dies in Form verschiedener Szenarien gemacht, da gerade bei
der Antriebstechnologie relativ grosse Unsicherheiten bestehen, wie und wie schnell sich tech-
nologische Neuerungen im Markt durchsetzen werden.
Der oben skizzierte Berechnungsansatz gilt in dieser Form für den Strassenverkehr. Für den
Schienenverkehr und den Nonroad-Bereich gilt grundsätzlich der gleiche Ansatz, hingegen sind
die Definitionen und Einheiten der Kerngrössen anders: bei der Schiene ist das Zugsgewicht eine
zentrale Grösse; deshalb wird der spezifische Energieverbrauch üblicherweise in Wattstunden
pro Brutto-Tonnen-Km (Wh/Btkm) ausgedrückt, und die Aktivitäten (Zugskm) sind deshalb
jeweils ergänzend in Btkm (Brutto-Tonnenkm) zu transformieren. Beim Nonroad-Bereich (Bau-
maschinen, Landwirtschaft etc.) wird üblicherweise der spezifische Energieverbrauch in g Treib-
stoff pro kWh gefasst, weshalb die Aktivitäten als Betriebsstunden zu formulieren sind.
Da der Energieverbrauch im Verkehrssektor durch die Fahrzeugtypen bestimmt wird, wird
die Aktivität primär als Fahrleistung (Fzkm, Zugskm) ausgedrückt und die Energieberechnung
auf dieser Ebene durchgeführt. Weil aber oft auch intermodale Vergleichsgrössen interessieren,
werden im Bottom-up-Modell auch die zugehörigen Verkehrsleistungen (Pkm, Tkm) mitbetrach-
tet, welche sich über Besetzungsgrade (P/Fz) oder Auslastungsgrade (T/Fz) ermitteln lassen. So
lassen sich der Energieentwicklung auch gesamtverkehrliche Aktivitätsentwicklungen (z.B.
total Pkm, total Tkm) gegenüberstellen.
Der mit dem Bottom-up-Ansatz ermittelte Energieverbrauch über alle Verwendungszwecke
kann – für die Vergangenheitsentwicklung – dem Absatz gemäss Energiestatistik gegenüberge-
stellt werden. Die sich aus diesem Vergleich ergebende Differenz wird als „Tanktourismus“ inter-
pretiert. Das heisst, der „Tanktourismus“ wird im jetzigen Bottom-up-Modell nicht eigenständig
modelliert. Selbstredend lässt sich dies nur für die Vergangenheitsentwicklung durchführen, für
INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs|21 die eigenständige Absatzzahlen vorliegen. Weil der so ermittelte Tanktourismus sich aus einer Differenz von zwei grossen Zahlen ergibt, ist die Unsicherheit dieser Angabe sehr gross. Eine Untersuchung zum Tanktourismus (CEPE et.al. 2008) hat ergeben, dass die so ermittelte Grös- senordnung (zwischen 5 und 10% des Absatzes) zumindest als plausibel erachtet werden kann. In Kapitel 7 wird vertieft auf diesen Aspekt eingegangen. INFRAS | 20. Februar 2013 | Die Bottom-up-Modellierung des Energieverbrauchs des Verkehrs
22|
3. MODELLIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS DES STRASSENVER-
KEHRS
3.1. DIE SEGMENTIERUNG IM STRASSENVERKEHR
Wie aus Figur 1 hervorgeht, ist der Strassenverkehr für den überwiegenden Anteil des Energie-
verbrauchs im Verkehr verantwortlich. Deshalb ist im Rahmen der Bottom-up-Modellierung die-
sem Sektor die Hauptaufmerksamkeit zu widmen. Insbesondere sind verschiedene Segmente
innerhalb des Strassenverkehrs auszuscheiden, um deren verschiedenen Eigenheiten (z.B. zwi-
schen PW und Lastwagen) besser berücksichtigen zu können.
Figur 3 zeigt die Segmentierung im Verkehr. Die sechs Fahrzeugkategorien werden weiter in
Grössenklassen sowie Antriebstechnologie (oder äquivalent: Treibstoffarten) eingeteilt. Für die
Energieberechnungen wird dann jeweils jedes Segment weiter nach Baujahr aufgeteilt, für die
Emissionsberechnungen werden diese dann zu „Emissionsstufen“ gemäss Abgasgesetzgebung
aggregiert; gleichzeitig werden Sondertechnologien (wie Partikelfilter) oder Zusatzverbraucher
(wie Klimaanlagen) berücksichtigt.
SEGMENTIERUNG DER FAHRZEUGE DES STRASSENVERKEHRS
Abkürzungen:
- PW: Personenwagen; SNF: Schwere Nutzfahrzeuge (Solo-Lastwagen, Lasten-/Sattelzüge)
- LPG: Liquefied Petroleum Gas; CNG: Erdgas; FFV: Flex-Fuel-Vehicle; BEV: battery electric vehicle; PHEV: Plug-in hybrid electric vehicle
- SCR: selective catalytic reduction; EGR: Exhaust gas recirculation
Figur 3 In der Segmentierung der Fahrzeuge des Strassenverkehrs können neben konventionellen Antrieben auch neue
Konzepte berücksichtigt werden.
3.2. DIE MODELLSCHRITTE IM STRASSENVERKEHR
Die Modellierung erfolgt im Wesentlichen je Fahrzeugsegment in vier Schritten: der Modellie-
rung des Fahrzeugbestandes, der spezifischen Fahrleistung, dem spezifischen Verbrauch und der
Treibstoffqualität bzw. der CO2-Intensität der Treibstoffe (vgl. Figur 4). Letztlich lässt sich so der
INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs|23 Energieverbrauch (wie auch der Schadstoffausstoss) je Segment und Treibstofftyp ermitteln und beliebig aggregieren und auswerten. MODELLIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS DES STRASSENVERKEHRS Figur 4 Der Energieverbrauch des Strassenverkehrs wird in vier Schritten modelliert. 3.2.1. SCHRITT 1: FAHRZEUGBESTANDESENTWICKLUNG Der erste Schritt modelliert die Fahrzeugbestandesentwicklung. Die Vergangenheit wird über statistische Angaben gemäss MOFIS, dem automatisierten Fahrzeug- und Fahrzeughalterregister der Eidgenössischen Fahrzeugkontrolle (EFKO) beim Bundesamt für Strassen (ASTRA), zu Be- stand und Altersverteilung abgebildet. Ausgehend von einem Basisjahr, d.h. dem letzten Jahr, zu dem statistische Angaben zu Bestand und Altersverteilungen vorliegen, wird die künftige Entwicklung anhand von Annahmen zu Neuzulassungen und sog. Überlebenswahrscheinlichkei- ten (oder äquivalent Ausfallraten) ermittelt. Das heisst, für jedes neue Jahr wird ausgehend vom Vorjahr anhand von altersabhängigen Überlebenswahrscheinlichkeiten bestimmt, wieviele Fahr- zeuge im Folgejahr noch im Markt sind bzw. wieviele aus dem Markt fallen. Zusätzlich kommen neue Fahrzeuge dazu, welche in der Regel Neufahrzeuge sind, die aber auch – z.B. als Import- Occasionen – einen älteren Jahrgang haben könnten. So wird Jahr für Jahr der „vehicle turno- INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs
24|
ver“ vom Bezugsjahr bis zum Endbetrachtungsjahr modelliert. Im Bottom-up-Modell, das für die
Energieperspektiven 2050 eingesetzt wurde, wurde 2010 als Bezugsjahr und 2050 als Endbe-
trachtungsjahr gewählt5. Dieses Verfahren (Kohortenmodell) wird für jede Fahrzeugkategorie
separat durchgeführt, wobei jeweils innerhalb der einzelnen Fahrzeugkategorien noch weiter
differenziert wird, z.B. bei den „konventionellen“ PW nach 6 Segmenten, d.h. nach Die-
sel/Benzin-PW und zusätzlich nach drei Hubraumklassen (2 l); zudem kön-
nen bei der künftigen Entwicklung neue Technologien wie batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV)
oder Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) einbezogen werden. Die nachstehende Figur zeigt links
ein Beispiel einer Überlebenswahrscheinlichkeitskurve, rechts die Entwicklung des PW-
Bestandes inklusive Altersverteilung, worin der Teil vor 2010 auf MOFIS-Angaben beruht, der
Teil nach 2010 auf Modellannahmen.
ILLUSTRATION DER BESTANDESENTWICKLUNG (BEISPIEL PW)
p
1.20 5'000'000 Statistik Kohortenmodell
1.00
4'000'000
0.80
0.60 3'000'000
0.40
2'000'000
0.20
0.00 1'000'000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Jahr 0
1990 2000 2010 2020 2030
Überlebenswahrscheinlichkeit Kumulierte Wahrsch.
Figur 5 Die Grafik links zeigt illustrativ die Überlebenswahrscheinlichkeitskurve der PW (Stand 2001/2002). Die schwarze
Linie zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug (in Abhängigkeit seines Alters) im Folgejahr noch im Verkehr ist, die
orange Kurve zeigt die kumulierten Werte (= „Lifetime-function“) und macht eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit, dass ein
Fahrzeug nach x Betriebsjahren noch im Verkehr ist.
Rechts ist die Entwicklung des Schweizer PW-Bestandes dargestellt, inkl. Neuzulassungen und allmählichen Ausfällen aus
dem Verkehr. Durch einen vertikalen Schnitt in einem bestimmten Bezugsjahr lässt sich die entsprechende Altersverteilung
der Fahrzeuge ablesen. Damit lassen sich Rückschlüsse auf deren baujahr-spezifischen Treibstoffverbrauch machen.
Dieses Verfahren wird je Segment angewendet. Konkret zeigt die nachstehende Figur am Bei-
spiel der Personenwagen, welche Annahmen im Szenario „WWB“ (Weiter wie bisher) zum Neuwa-
gen-Mix getroffen wurden (links in Figur 6). Das Modell simuliert anschliessend den Flottenmix
über den Verlauf der Jahre (rechts links in Figur 6).
5 Im Rahmen weiterer Aktualisierungsarbeiten wie etwa im Kontext der ExPost-Analysen werden diese Datengrundlagen jeweils
laufend aktualisiert.
INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs|25
BEISPIEL: ENTWICKLUNG DER PW-FLOTTENZUSAMMENSETZUNG IM SZENARIO „WWB“ DER
ENERGIEPERSPEKTIVEN 2050
ANTEILE DER VERSCHIEDENEN SEGMENTE ANTEILE DER VERSCHIEDENEN SEGMENTE
BEI DEN NEUWAGEN (INPUT) IN DER FLOTTE (MODELL-ERGEBNIS)
Figur 6 Die Grafik links zeigt die Annahmen (Input), wie sich die Zusammensetzung des Neuwagenparks entwickeln wird,
rechts das Modellergebnis, d.h. der Mix der gesamten Flotten im Verlauf der Zeit. Das Beispiel bezieht sich auf das Szenario
„WWB“ (Weiter wie bisher) der Energieperspektiven 2050 (BFE 2012a). Die zugehörigen Zahlen finden sich im Annex 3.
3.2.2. SCHRITT 2: SPEZIFISCHE FAHRLEISTUNGEN
Der zweite Schritt bildet die Fahrleistungen nach: Auf der Basis diverser Erhebungen (wie
LSVA-Auswertungen, PEFA [„Periodische Erhebung Fahrleistungen“ durch Strassenverkehrsäm-
ter, ARE 2002] u.a.m.) werden je Fahrzeugkategorie und -segment die spezifischen Fahrleistun-
gen bestimmt (in km pro Jahr und Fahrzeug). Diese wird gleichzeitig differenziert nach Alter
und Grössenklassen. So haben beispielsweise Diesel-PW höhere Fahrleistungen als Benzin-PW,
schwerere Fahrzeuge fahren mehr als leichtere, neuere fahren mehr als ältere etc. Diese Informa-
tion wird für die Zukunft fortgeschrieben, unter Beachtung struktureller Änderungen wie etwa
der Verlagerung von Benzin-PW hin zu Diesel-PW (vgl. Figur 7), welche dazu führt, dass der Mit-
telwert zwar etwa konstant bleibt, die Werte der Diesel- bzw. Benzin-PW jedoch in beiden Fällen
sinken. Gleichzeitig wird berücksichtigt, dass ein Teil der Fahrleistung im Ausland, aber auch
ein Teil der Fahrleistung auf Schweizer Strassen durch im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge
zurückgelegt wird. Anschliessend wird diese Fahrleistung je Fahrzeugkategorie auf die drei
Strassentypen verteilt (Autobahnen, ausserorts, innerorts). Bei den Nutzfahrzeugen wird neben
den Gewichtsklassen nach Typen (Solo-LW, Lastenzüge, Sattelzüge) differenziert, was mittler-
INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs26|
weile anhand empirischer Grundlagen aus dem Kontext der LSVA möglich ist. Zudem interessiert
auch der Beladungsgrad zur Charakterisierung der SNF-Fahrleistungen, weil dieser sowohl den
Energieverbrauch als auch den Schadstoffausstoss mit beeinflusst.
BEISPIEL PW: ENTWICKLUNG DER SPEZIFISCHEN FAHRLEISTUNG (IN KM/A UND FZG)
Spez. Fahrleistung
20'000
19'000
18'000
17'000
16'000
15'000
14'000
13'000
12'000
11'000
10'000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Jahr
Mittelwert Benzin Mittelwert Diesel Mittelwert Gesamt
Figur 7 Entwicklung der spezifischen Fahrleistung der PW nach Treibstoff im Zeitraum 1990 – 2035.
Diese Bottom-up-Modellierung von Fahrzeugbestand und spezifischer Fahrleistung wird abge-
glichen mit den externen „Makro-Vorgaben“ zur künftigen Entwicklung der Fahrleistung wie
etwa den Verkehrsperspektiven (ARE 2004, ARE 2006). Im Kontext mit den Energieperspektiven
2050 (BFE 2012a) wurden dazu vom ARE einige Ergänzungen eingeführt, welche der Entwick-
lung der letzten Jahre und aktualisierten Bevölkerungsprognosen durch das BFS Rechnung tra-
gen (ARE 2012). So ergibt sich schliesslich aus Schritt 2 kombiniert mit Schritt 1 die Fahrleis-
tung je Segment, d.h. differenziert nach Antriebstechnologie und Grössenklasse. Die Angaben
zur Fahrleistungsentwicklung finden sich in Annex 3.
INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des Strassenverkehrs|27
BEISPIEL: ENTWICKLUNG DER PW-FAHRLEISTUNG DIFFERENZIERT NACH ENERGIE-RELEVANTEN
SEGMENTEN
Mio. Fzkm/a
80'000
70'000
60'000
50'000
40'000
30'000
20'000
10'000
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
PW Benzin28|
PW (NEU-FAHRZEUGE): ENTWICKLUNG DES SPEZIFISCHEN TREIBSTOFFVERBRAUCHS (IN l/100 KM
BZW. g CO2/KM)
10.0 220 100%
9.5 90%
200
9.0 80%
8.5 70% D
180
g CO2/Km
D 60% B
8.0
L/100Km
B 160 50% Alle (CH)
7.5
Alle (CH) 40% %D CH
7.0 140 %D EU
30%
6.5
20%
6.0 120
10%
5.5 100 0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5.0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PW: ENTWICKLUNG VON HUBRAUM BZW. LEER- PW: VERGLEICH DER SPEZIF. CO2- EMISSION
GEWICHT DER NEU-FAHRZEUGE SCHWEIZ UND EU
2'000 220
1'900
1'800 200
1'700
180
1'600 CH
g CO2/km
1'500 160 EU
1'400
1'300 140
1'200
120
1'100
1'000 100
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hubraum (ccm) Leergewicht (kg)
Figur 9 Entwicklung von Kenngrössen der Neu-PW 1996 – 2011 (Angaben auto-schweiz, jährliche Auswertungen).
Tendenz zu leichteren Fahrzeugen beigetragen. Nachdem das Leergewicht der Fahrzeuge im
Zeitraum 1996-2006 um rund 200 kg zunahm, sanken Gewicht und insbesondere Hubraum
(downsizing) seit ca. 2007 ab; das Leergewicht nahm 2010/11 allerdings wieder leicht zu. Ein
Teil der ausgewiesenen Absenkung dürfte allerdings auch auf eine Optimierung des Normver-
brauchs im Typenprüfzyklus NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) zurückzuführen sein, da
dieser Wert neu als Basis für die Reglementierung des Flottenverbrauchswert verwendet wird.
Der effektive Verbrauch auf der Strasse ist in der Regel höher, weil der Normzyklus kein reales
Fahrverhalten abbildet und unter Laborbedingungen gefahren wird (z.B. kein Gepäckträger,
keine Strassenlängsneigungen, normiertes Beladungsgewicht etc.); insbesondere sind auch
zusätzliche Verbrauchsgeräte wie Klimaanlagen darin nicht eingeschlossen. Europäische Stu-
INFRAS | 20. Februar 2013 | Modellierung des Energieverbrauchs des StrassenverkehrsSie können auch lesen