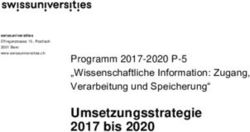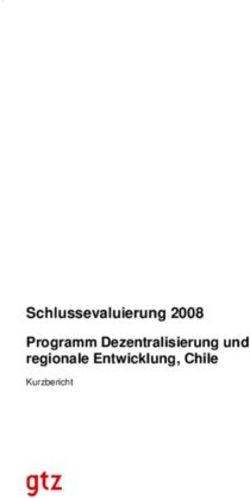Auf dem Weg zu einem europäischen oder deutsch-französischen Wirtschaftsgesetzbuch?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Auf dem Weg zu einem europäischen oder deutsch-französischen
Wirtschaftsgesetzbuch?
Stellungnahme von Prof. Dr. Peter Jung, Maître en droit, Universität Basel,
anlässlich der Arbeitsgruppensitzung der DFPV am 1. März 2021
I. Notwendigkeit und Realisierung eines europäischen oder deutsch-französischen
Wirtschaftsgesetzbuchs
A. Notwendigkeit einer supra- oder internationalen Kodifikation des Wirtschaftsrechts
Eine Harmonisierung oder besser eine Vereinheitlichung des Wirtschaftsrechts in Europa ist
wünschenswert (siehe den Bericht von Valérie Gomez-Bassac vom Juli 2019). Die Achtung der
Grundfreiheiten des EG-Vertrags impliziert notwendigerweise die Harmonisierung bzw. Ver-
einheitlichung des Wirtschaftsrechts. Auch nach dem Aachener Vertrag sollen die Hindernisse
bei der Umsetzung deutsch-französischer Vorhaben im Bereich der Wirtschaft überwunden
werden. Diesem Bedürfnis wird der derzeitige Pointillismus der Gesetzgebung der Europä-
ischen Union nur unzureichend gerecht. Das Unionsrecht offenbart sogar bisweilen Wider-
sprüche, verursacht Friktionen in den nationalen Rechtsordnungen und lässt immer noch
erhebliche Divergenzen fortbestehen. Eine Kodifizierung könnte diese Unzulänglichkeiten
überwinden. Das Gegenargument, dass der Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen bei
der Suche nach der am besten geeigneten Regelung positive Effekte zeitigen würde, ist nicht
überzeugend. Der freie Wettbewerb der Privatrechtssysteme ist eine Chimäre. Das Argument
überschätzt zudem die Rolle von Wirtschaftsrechtsnormen, die weitgehend technischer Natur
sind und eine dienende Funktion haben. Keinesfalls können mögliche Vorteile die Nachteile
der rechtlichen Divergenzen ausgleichen. Außerdem wird es bei einem Wettbewerb zwischen
dem Einheitsrecht und den außerhalb der Europäischen Union bestehenden Wirtschaftsrechts-
ordnungen bleiben.
Das kontinentale Recht ist durch das Ideal der Kodifikation geprägt, die sich nach Jeremy
Bentham durch ihre Universalität in Inhalt, Raum und Zeit sowie durch ihre systematische
Gestaltung und die größtmögliche Reduzierung des richterlichen Ermessensspielraums aus-
zeichnet. In dieser Tradition ist das Wirtschaftsrecht der Europäischen Union und ihrer Mit-
gliedstaaten mit Modifikationen kohärent zu kodifizieren. Eine bloße Verbesserung der EUR-
lex-Datenbank oder eine einfache Zusammenstellung des Bestehenden, mag den Zugang zum
EU-Recht zwar erleichtern, bringt ansonsten aber keinen Nutzen. Viele Bestimmungen des EU-
Rechts könnten auch gar nicht unverändert in ein unmittelbar geltendes Gesetzbuch über-
nommen werden. Ein deutsch-französisches Wirtschaftsgesetzbuch müsste ohnehin einen
neuen Inhalt haben, der die gefundenen Kompromisse widerspiegelt.
Die inter- oder supranationale Kodifizierung könnte auch das Wirtschaftsprivatrecht selbst
voranbringen, das teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Im Idealfall können die
Entscheidungen, die bei der Kodifizierung auf inter- oder supranationaler Ebene zu treffen sind,
nach der besten Lösung und unabhängig von nationalen Sachzwängen getroffen werden. Das
deutsche Handelsrecht könnte sich z. B. zum Unternehmensrecht weiterentwickeln, indem es
seinen Anwendungsbereich vom Kaufmann zum Unternehmer und vom Handelsgeschäft zum
unternehmensbezogenen Geschäft erweitert. Das französische Handelsgesetzbuch, das mit
seinem sog. Bercy-Gesetzgebungsstil zu einem Sammelsurium komplexer und schwer lesbarer
Regeln geworden ist, könnte eine klarere und schlankere Struktur erhalten.
1B. Umsetzung einer supra- oder internationalen Kodifikation des Wirtschaftsrechts
So notwendig eine Kodifikation zur Vereinheitlichung des europäischen Wirtschaftsrechts ist,
so schwierig ist sie umzusetzen. Dies gilt sowohl für ihren Inhalt als auch für die Widerstände,
die bei ihrer Umsetzung zu überwinden sind.
Da allein schon die Kodifikation des deutsch-französischen Wirtschaftsrechts eine Herausfor-
derung darstellt, sollte sie auf die Kernbereiche des Wirtschaftsrechts beschränkt werden. Auch
die Europäische Kommission hat den Anwendungsbereich des in ihrem Weißbuch zur Zukunft
Europas bis 2025 ins Auge gefassten Wirtschaftsrechtskodex auf das Gesellschaftsrecht, das
Handelsrecht und verwandte Bereiche beschränkt (COM(2017) 2025). Dies schließt nicht aus,
dass auch andere Rechtsgebiete von Anfang an oder zu einem späteren Zeitpunkt in dieses
Gesetzbuch aufgenommen werden, wenn sich bei ihnen relativ leicht ein Kompromiss finden
sollte, wie dies beim Insolvenzrecht der Fall sein könnte, wo sich auf EU-Ebene und in den
deutsch-französischen Beziehungen neue Impulse abzeichnen. Wichtig wäre aber, dass diese
Rechtsfragen dem Unternehmensrecht im engeren Sinne zugerechnet werden können, damit
das Gesetzbuch nicht nur auf einem sehr abstrakten Niveau kohärent ausgestaltet werden kann
und damit es kein unübersichtliches Sammelsurium bildet, wie dies beim monströsen belgi-
schen Wirtschaftsgesetzbuch von 2013 der Fall ist.
Selbst wenn ein verbindliches supranationales Gesetzbuch angestrebt werden sollte, würde dies
nicht ausschließen, dass der erarbeitete Text zunächst noch das nationale Recht gelten lässt,
wenn sich die Vertragsparteien nicht ausdrücklich für die Anwendung des supranationalen oder
internationalen Gesetzbuchs entschieden haben (opt in) oder wenn sich die Parteien gegen die
Anwendung des Gesetzbuchs entschieden haben (opt out). Es ist auch möglich, ein opt-out bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten mit einem opt-in bei inländischen Sachverhalten zu
kombinieren. Auf diese Weise könnten Widerstände gegen das Gesetzbuch abgebaut und
gleichzeitig die Attraktivität, Umsetzbarkeit und Praktikabilität der Regeln getestet werden.
Wenn man von einem verbindlichen Gesetzbuch träumt, aber kein Träumer ist, muss man ein
europäisches Gesetzbuch in einer Pioniergruppe entwickeln und zu unterschiedlichen Zeiten in
den Mitgliedstaaten in Kraft setzen, d. h. insbesondere mit einer deutsch-französischen und für
andere EU-Mitgliedsländer offenen intergouvernementalen Zusammenarbeit außerhalb der
Europäischen Union beginnen. Diese bilaterale Arbeit kann sich auf eine teilweise gemeinsame
Tradition und auf vergleichende Arbeiten stützen, die bereits eine Auflistung und kritische
Analyse der Konvergenzen und Divergenzen zwischen den beiden Rechtsordnungen vorge-
nommen haben. Neben der Arbeit am Kodex selbst könnten sich Frankreich und Deutschland
auch generell bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien besser abstimmen. Dies würde
die zukünftige Vereinheitlichung des Wirtschaftsrechts konkret und schrittweise erleichtern.
Da das Gesetzbuch in den gleichermaßen gültigen Amtssprachen der Unterzeichnerstaaten
verfasst werden würde, muss eine beschreibende Sprache verwendet werden, die Begriffe
vermeidet, die bereits mit einer bestimmten Konnotation in den nationalen Rechtsordnungen
verwendet werden. Um dieselben Regeln auf Unternehmen anzuwenden, ist es außerdem
notwendig, eine supranationale Rechtsprechung zu schaffen. Es würde nämlich nicht ausrei-
chen, die Bestimmungen zu vereinheitlichen, ohne ihre einheitliche Anwendung zu garantieren.
Diese Gerichte sollten nach dem Vorbild der Federal und State Courts in den Vereinigten
Staaten neben den nationalen Gerichten eingerichtet werden.
2II. Deutsch-französische Kodifikation des Gesellschaftsrechts
A. Konvergenzen und Divergenzen
Das deutsche und das französische Handels- und Gesellschaftsrecht haben viele Gemeinsam-
keiten. Die beiden Privatgesetze beruhen jeweils auf zwei Kodifizierungen: einem Zivilgesetz-
buch und einem Handelsgesetzbuch. Traditionell befassen sich beide Gesetze mit den gleichen
Gesellschaftsformen. Beide Gesellschaftsrechte haben die gleichen Funktionen, sie müssen die
gleichen Probleme lösen und unterliegen den gleichen allgemeinen Grundsätzen. Die Rechte
von Aktiengesellschaften werden heute insbesondere vom Unionsrecht und in geringerem
Maße vom anglo-amerikanischen Recht beeinflusst. Manchmal kann man sogar eine direkte
Übernahme von rechtlichen Lösungen aus dem anderen Land beobachten (z. B. die Übernahme
des GmbH-Modells in Frankreich).
Doch jenseits dieser großen Gemeinsamkeiten, die sich auch auf europäischer Ebene im
Bereich des Kapitalgesellschaftsrechts in der Vorlage eines European Model Companies Act
(EMCA) widerspiegeln, kann man viele Unterschiede feststellen, die sich nicht auf die Rechts-
technik und Details beschränken. So wundert sich der deutsche Jurist etwa darüber, dass das
französische Recht mit Ausnahme der société en participation den Personengesellschaften
Rechtspersönlichkeit verleiht und die société civile der Registerpublizität unterwirft. Er ist
erstaunt über den großen Erfolg der SAS in denjenigen Bereichen, die in Deutschland von der
GmbH abgedeckt werden, während die in Deutschland sehr verbreitete GmbH & Co.KG in
Frankreich ein marginales Phänomen geblieben ist. Er stellt fest, dass das französische Recht
eine Rechtsprechung entwickelt hat, um das Problem der Interessenkonflikte in einem Konzern
zu lösen, während das deutsche Aktienrecht in diesem Bereich seit 1965 eine ausdifferenzierte
Gesetzgebung kennt. Das sind nur ein paar augenfällige Beispiele.
B. Ein erster Schritt: Der Regelungsentwurf zur vereinfachten europäischen Gesell-
schaft (SES)
Es ist kein Zufall, dass der erste Teilentwurf der an einem europäischen Wirtschaftsgesetzbuch
arbeitenden Gruppe das supranationale Statut einer geschlossenen Kapitalgesellschaft (Société
européenne simplifiée) betrifft. Geschlossene Kapitalgesellschaften sind die häufigste Form
von Unternehmensträgern auf dem Kontinent. Sie werden sowohl von KMUs als Organisa-
tionsform als auch von großen Unternehmen als Rechtsform für ihre Tochtergesellschaften
genutzt. Ein entsprechendes Statut kann problemlos unabhängig von anderen Teilen des Ge-
setzbuchs verabschiedet werden. Die Wahl des Regimes ist fakultativ und die neue suprana-
tionale Gesellschaftsform tritt damit lediglich in einen belebenden Wettbewerb mit den weiter-
hin bestehenden nationalen Gesellschaftstypen. In einer solchen Wettbewerbssituation muss
man nur darauf achten, dass die supranationale Rechtsform einerseits nicht so unattraktiv
ausgestaltet wird, dass sie sich später als Todgeburt erweist, und dass sie andererseits nicht zur
massenhaften Umgehung zwingender nationaler Regelungen missbraucht werden kann. Bei der
Ausarbeitung und Verabschiedung des Statuts kann man aus den Erfahrungen ähnlicher erfolg-
reicher Projekte wie der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) oder gescheiterter Projekte wie
der Europäischen Privatgesellschaft (SPE) oder der Societas Unius Personae (SUP) lernen.
Außerhalb des Gesellschaftsrechts existiert bereits der deutsch-französische optionale Güter-
stand als Vorbild. Inhaltlich kann man sich auf die durch das Gemeinschaftsrecht harmoni-
sierten Regelungen zum Gesellschaftsrecht, die erfolgreichen Regelungen der französischen
Société par actions simplifiée (SAS) und der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) sowie den Vorschlag für einen European Model Companies Act (EMCA) stützen.
Umgekehrt können die supranationalen Bestimmungen des SES-Statuts auch als Vorbild für
3die Harmonisierung des nationalen Gesellschaftsrechts dienen. Es handelt sich also um ein
gleichermaßen wünschenswertes wie realisierbares Projekt.
Der Vorentwurf der Association Henri Capitant zum Statut der Société européenne simplifiée
(SES) ist ein guter Ausgangspunkt für die entsprechenden Arbeiten. Dieser Vorschlag, für den
die Vorarbeiten bis in die 1990er Jahre zurückreichen (Initiative der Pariser Industrie- und
Handelskammer), steht in der deutsch-französischen Tradition einer geschlossenen Kapitalge-
sellschaft. Diese Tradition war im Kommissionsentwurf von 2008 zum Statut der Europäischen
Privatgesellschaft (KOM(2008) 396), der stark vom angelsächsischen Recht beeinflusst war,
vernachlässigt worden. Das vorgelegte Statut ergänzt das prinzipiell attraktive SAS-Regime
(etwa 60 % der Gesellschaftsgründungen in Frankreich erfolgen aktuell in dieser Form) um
einige aus deutscher Sicht wichtige Elemente der GmbH. Der Vorschlag vermeidet dabei die
meisten der kontroversen Themen, welche die Verabschiedung eines solchen supranationalen
Statuts, insbesondere in Deutschland, verhindern könnten. Folglich nimmt das Statut nicht zu
den umstrittenen Fragen der Form des Gesellschaftsvertrages, der Übertragung von Anteilen
oder eines Gesellschaftsbeschlusses und damit zur zwingenden Einschaltung eines Notars Stel-
lung (Art. 2.1.2. Abs. 3, Art. 3.1.8. Abs. 1, Art. 3.1.14. Abs. 1). Obwohl das Statut auf ein
grenzüberschreitendes Element bei der Gründung der Gesellschaft verzichtet und es somit jeder
Gesellschaft erlaubt, diese Rechtsform anstelle einer nationalen Gesellschaftsform anzuneh-
men, hindert es den Staat des realen Hauptverwaltungssitzes nicht daran, die eigenen zwingen-
den Regeln auf andere als die im Statut behandelten Rechtsfragen anzuwenden. Damit wird
vermieden, dass die SES außerhalb des Regelungsbereichs des Statuts zur Umgehung zwingen-
der Vorschriften genutzt wird. Dies gilt insbesondere für die Regelungen zur Beteiligung der
Arbeitnehmer in den Verwaltungs- oder Aufsichtsgremien der Gesellschaft, da deren Miss-
achtung das Projekt in Deutschland politisch untragbar machen würde. Der Vorschlag sieht
auch einen Vorbehalt zugunsten nationaler Rechte vor, welche die Identität von Satzungs- und
Hauptverwaltungssitz verlangen (Art. 2.1.5 Abs. 2). Die vorgeschlagene SES muss zwar über
ein Mindeststammkapital verfügen, doch wurde dessen Höhe moderat auf 12.000 EUR festge-
legt. Außerdem müssen Bareinlagen bei der Eintragung der Gesellschaft nur zu einem Viertel
geleistet sein (Art. 2.1.3.). Da Dienstleistungen nach deutschem GmbH-Recht als Einlage-
leistungen unzulässig sind, werden sie auch im vorgeschlagenen Statut ausgeschlossen (Art.
2.1.3. Abs. 2). Die SES darf nur dann eine Vermögensausschüttung vornehmen, wenn danach
das Vermögen der Gesellschaft ausreicht, um die Verbindlichkeiten und das gebundene Kapital
vollständig zu decken, was einer Kumulation von sog. Solvenztest und sog. Bilanztest gleich-
kommt (Art. 4.1.1. Abs. 2). Die Business Judgement Rule ist verankert, allerdings nur als
einfache Vermutung (Art. 3.1.5. Abs. 2). Das Erfordernis der Genehmigung von Transaktionen
mit nahestehenden Personen ist nur eine Satzungsoption (Art. 3.1.11.). Die Möglichkeit einer
Mitgeschäftsführung (Art. 3.1.2. Abs. 2) ist aus französischer Sicht sogar ein attraktives
Merkmal des Statuts, da die SAS noch keine echte Ko-Präsidentschaft kennt.
Mit seinen umsichtigen und ausgewogenen Regeln scheint das vorgeschlagene Statut für viele
Mitgliedstaaten, einschließlich Frankreichs und Deutschlands, durchaus akzeptabel zu sein.
Man kann höchstens kritisieren, dass der Vorschlag teilweise ein wenig zaghaft ist. Insbeson-
dere die Verweise auf die für die nationale Referenzrechtsform geltenden Vorschriften des
Registrierungsstaats sind zu zahlreich oder zumindest zu weit gefasst (z. B. Art. 3.1.7. Abs. 3
und Abs. 4, Art. 3.1.8. Abs. 1, Art. 3.1.15. Abs. 3, Art. 4.1.5.). Die Verfasser des Vorschlags
weisen zwar beispielsweise zu Recht darauf hin, dass die Regelung der Anfechtungsklage eng
mit den einzelstaatlichen zivilprozessualen Vorschriften verknüpft ist. Dies sollte sie jedoch
nicht daran hindern, spezifische gesellschaftsrechtliche Vorschriften für solche Klagen (Klage-
frist, Anfechtungsgründe, Wirkungen) festzulegen, anstatt allgemein auf das für die nationale
Referenzrechtsform geltende Recht des Registrierungsstaats zu verweisen. Für den Fall des
4Austritts (Verweis in Art. 3.1.15. Abs. 3) gibt es im deutschen Recht auch noch gar keine
gesetzliche Regelung, sondern lediglich Rechtsprechungsgrundsätze. Zwar stehen die Verweise
auf das autonome Recht des Registrierungsstaats unter dem Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit
dem supranationalen Recht des Statuts, doch führen solche generellen und zwangsläufig
unbestimmten Kompatibilitätsvorbehalte vielfach zur Rechtsunsicherheit. Das kennt man in
Frankreich etwa auch von dem generellen und ebenfalls mit einem Kompatibilitätsvorbehalt
versehenen Verweis des SAS-Rechts auf das subsidiär anwendbare Aktienrecht. Mit einem
Verweis des SES-Rechts auf das SAS-Recht in einem Bereich, in dem dieses wiederum auf das
Aktienrecht und höchstsubsidiär auf das allgemeine Gesellschaftsrecht des Code civil verweist,
können sich die Probleme dann sogar noch kumulieren. Man kann sich auch fragen, was es
z. B. für die Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer (eingeschränkt bei der SAS), für den Straftat-
bestand des abus des biens sociaux (wichtig in Frankreich) und für die fakultative Wahl des
Einkommensteuerregimes (unter bestimmten Bedingungen möglich bei der SAS) bedeutet,
wenn das Statut die Mitgliedstaaten nicht daran hindern will, «das am Verwaltungssitz der
Gesellschaft geltende [zwingende] Recht für andere als die in diesem Kapitel behandelten
Rechtsfragen anzuwenden». Bei alledem darf man nicht vergessen, dass das SES-Recht so
einheitlich und präzise wie möglich sein sollte, damit es nicht seine Attraktivität im Vergleich
zu einer nationalen Gesellschaftsform wie der SAS oder der GmbH verliert, deren Regime
bereits durch eine umfangreiche Rechtsprechung ausbuchstabiert ist.
Manchmal sind die vorgeschlagenen Regelungen des Statuts auch weniger attraktiv als die-
jenigen der französischen SAS (kein Stammkapital unter EUR 12.000; keine Option für ein
variables Kapital; keine Geschäftsanteile gegen Dienstleistungen) oder der deutschen GmbH
(Restliberierung innerhalb von fünf Jahren; schriftlicher Geschäftsführungsbericht). Aber das
wird dann eben der akzeptable Preis für die Nutzung einer supranationalen Rechtsform sein.
Diese Stellungnahme stützt sich auf folgende Veröffentlichungen des Autors und die darin ent-
haltenen Zitate:
Jung, Le droit privé communautaire face à la codification, in : Annuaire de droit européen 2003 Vol. 1, Paris 2005,
p. 838–853
Jung, Vers une convergence des droits allemand et français des sociétés ?, Revue internationale de droit comparé
(RIDC) 2008, p. 861–884
Jung, Entreprise et droits européens, in : Cachard/Nau (dir.), Droit privé européen : l’unité dans la diversité –
Convergences en droit de l’entreprise ?, Munich 2012, p. 1–30
Jung, La société européenne en Allemagne – Du vaisseau amiral au canot de sauvetage, Revue Lamy Droit des
Affaires 2012, p. 131–134
Jung, Les droits français et allemand – Pionniers du droit privé européen, in : La Lettre du CFDC no 68, p. 12 s.
Jung, Vers un Code européen des affaires – Une proposition d’Emmanuel Macron aussi nécessaire qu’audacieuse,
in : Storck et al. (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz, Paris 2018, p. 391–406
Basel, den 19. Februar 2021
5Sie können auch lesen